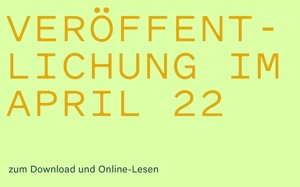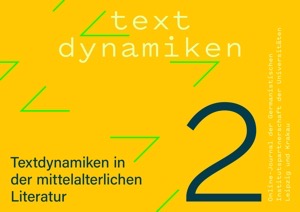Einleitung: Germanistische Institutspartnerschaft textdynamiken (DAAD)
Im Jahre 2019 entstand der Gedanke, dass das Institut für Germanische Philologie der Jagiellonen-Universität in Kraków und das Institut für Germanistik der Universität Leipzig eine Institutspartnerschaft aufbauen sollten. In den Jahren zuvor hatte es schon eine intensive Zusammenarbeit einzelner Forscher:innen beider Institute gegeben, so dass der Schritt zu einer Partnerschaft nahelag. Konkretisiert wurden die Pläne einer Kooperation im Jahr 2020. Nach einem Planungstreffen in Krakau zu Beginn des Jahres, bei dem Vertreter:innen der Sprach- und Literaturwissenschaft beider Institute sich über mögliche Themen und Maßnahmen austauschten, wurde im Sommer 2020 ein Projektantrag unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Griese (Mediävistik, Universität Leipzig) auf den Weg gebracht. Erfreulicherweise wurde dieser Antrag vom DAAD bewilligt, so dass zwischen 2021 und 2023 verschiedene gemeinsame Ideen um das verbindende Thema der „Textdynamiken“ herum umgesetzt werden können. Auf diese Weise lassen sich die verschiedenen Formen der Kooperation in der Forschung besser bündeln, wobei die Forschungsergebnisse in verschiedenen Lehrformaten auch in die germanistische Ausbildung eingebracht werden sollen. Forschungsinteressen in Leipzig und Krakau sind beispielsweise die Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Literatur, Briefliteratur und Briefhandschriften, Autorkonzepte der Moderne, kurze sprachliche Formen im öffentlichen Raum, Gesprächslinguistik und Online-Kommunikation. Das Projektteam besteht aus acht Wissenschaftler:innen: Prof. Dr. Zofia Berdychowska (Krakau, Sprachwissenschaft, Textlinguistik, Pragmatik), Dr. Stephanie Bremerich (Leipzig, Neuere deutsche Literatur, Projektassistenz), Dr. phil. habil. Magdalena Filar (Krakau, Sprachwissenschaft, Pragmatik), Prof. Dr. Sabine Griese (Leipzig, Ältere deutsche Literatur, Projektleitung), Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal (Krakau, Literaturwissenschaft, Projektkoordination in Krakau), Prof. em. Dr. Frank Liedtke (Leipzig, Sprachwissenschaft, Pragmatik), Dr. Robert Mroczynski (Leipzig, Sprachwissenschaft, Pragmatik) und Dr. Pawel Zarychta (Krakau, Literaturwissenschaft).
Textdynamiken spielen in germanistischen Forschungszusammenhängen sowie in der Lehre eine zentrale Rolle. So ist die Produktion von Texten in Wort und Schrift eine der Zielkompetenzen in der Ausbildung der Studierenden. Texte sind jedoch keine fest gefügte, unveränderliche Einheit, sondern sie existieren in ganz unterschiedlichen Aggregatformen: Texte werden mündlich oder schriftlich verfasst, Texte stammen aus der Gegenwart wie aus der Vergangenheit, sie betreffen fast alle Lebensbereiche des Menschen, sie sind Kommunikationsmittel sowie Alltags- und Kulturgut. Texte beziehen sich aufeinander, und zwar im realen wie im fiktiven Raum (der Literatur und Künste).
Diese Vielfalt der Texte und ihrer Funktionen ist der Ausgangspunkt für die Arbeit in der Germanistischen Institutspartnerschaft: Wir erfassen die Veränderung von Texten in Raum und Zeit, aber auch das Entstehen von Texten im Kopf der Leser:innen und Hörer:innen, mit dem Stichwort der „Textdynamiken“. Damit benennen wir die Phänomene des Wandels kommunikativer Praxen, die an Texten ebenso beobachtbar sind wie die jeweiligen Prozesse, denen Texte auf ästhetischer, kultureller, diachroner sowie produktions- und rezeptionsorientierter Ebene unterworfen sind. Diese Veränderungen von Texten und ihre spezifischen Formen und Zustände wollen wir zum Schwerpunkt des gemeinsamen Forschungs- und Lehrgesprächs machen. Dabei greifen wir auch intensiv auf digitale Formen und Ressourcen in Forschung und Lehre zurück.
Zur Debatte steht der Textbegriff selbst mit Fokus auf seiner Dynamik, also der Entstehung, der Veränderung sowie der individuellen Verarbeitung unter sozialen, kulturellen wie medialen Bedingungen. Zu diesem Vorhaben tragen die Vertreter:innen der Teildisziplinen auf jeweils unterschiedliche Weise bei.
Fragen nach Textdynamiken sind in der germanistischen Mediävistik eng verbunden mit Fragen nach der Textüberlieferung; hierbei ist zu klären, wie Texte vor dem Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit verfasst und wie sie über die Zeit weitertradiert werden. Texte werden vor der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts handschriftlich kopiert, um sie zu vervielfältigen, auch mündlich tradiert, und auch später werden sie noch vielfach manuell kopiert. Bei diesen Überlieferungsformen sind Veränderungen des Textes beinahe obligat, denn für das mündliche Erzählen sind diese ganz natürlich gegeben; für die schriftliche Tradierung durch Abschreiben sind Veränderungen ebenfalls der Normalfall. Für die Literatur des Mittelalters gibt es demnach keinen festen, unveränderlichen Text, sondern jeder Überlieferungsträger eines Werks stellt gleichsam einen Text eigener Güte dar.
Für die neuere deutsche Literaturwissenschaft wiederum ergibt sich folgendes Bild: Hier haben Strukturalismus und Poststrukturalismus in der Theoriebildung des 20. Jahrhunderts zu einer Abwendung vom Begriff des ‚Werkes‘ und zu einer Hinwendung zum Begriff des ‚Textes‘ geführt. Text wird in seiner poetischen Organisiertheit als eigenständiger Untersuchungsgegenstand aufgefasst, steht aber auch als ein mit anderen Texten und Medien prinzipiell verbundener Gegenstand (Intertextualität / Intermedialität) im Fokus. Techniken des Fragmentierens und Montierens spielen in der literarischen Praxis eine zentrale Rolle, ebenso wie sie für die Erweiterung des Kunstbegriffes und die Öffnung des Textbegriffes stehen. Sie werden bereits in der Frühromantik um 1800 und der literarischen Moderne um 1900 akut und verbinden sich zum Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit einer Tendenz zur medialen Grenzüberschreitung des Textes.
Einen weiteren Schwerpunkt der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Germanistischen Sprachwissenschaft bilden Textdynamiken kurzer Formen in Bezug auf Sprache und Multimodalität, wie sie vor allem im öffentlichen Bereich vorkommen. Hierbei ist an Kurzformen gedacht, wie sie sich modalitätsspezifisch und raumsemiotisch beispielsweise auf Hinweisschildern, Tastflächen oder in Form von akustischen Durchsagen manifestieren. Charakteristisch für diese Texte ist ihre Prägnanz, sie enthalten schnell zu erfassende Botschaften. Angesichts der Kürze und Kompaktheit der Botschaften ist bei ihrer Analyse die jeweilige Zeit- und Raumkonstellation, die situative Einbettung und das jeweils vorausgesetzte Wissen der Rezipient:innen zu berücksichtigen, die ihnen eine besondere, verarbeitungsbedingte Dynamik verleihen. Neben Kurzformen im physischen oder virtuellen Raum werden auch öffentliche Online-Diskurse berücksichtigt. Hier sollen Diskursstränge im Fokus stehen, die interaktiv von den spontanen Diskursakteur:innen konstruiert werden und so eine besondere Form der Dynamik aufweisen. Diese Diskurse sind von denjenigen abzugrenzen, die aus monologisch von Journalist:innen konzipierten Texten und anderen Diskursfragmenten bestehen.
In der Arbeit an dem Begriff der ‚Textdynamiken‘ treffen sich die drei Teildisziplinen, und dadurch wird im Austausch zwischen den Instituten und ihren Vertreter:innen eine wechselseitige Bereicherung auch vor dem Hintergrund der nationalen Fächerkulturen möglich sein. Dies in der Lehre zu vermitteln ist, neben dem wissenschaftlichen Austausch, eines der wichtigen Ziele der Partnerschaft. Entsprechend sind der kontinuierliche Austausch im Bereich der Lehre, die Einbeziehung studentischer Beiträge sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses integrale Bestandteile der im Rahmen der Institutspartnerschaft verfolgten Maßnahmen. Dazu gehören kooperative Lehrformate (Team-Teaching), der gegenseitige Austausch von Doktorand:innen, die Einrichtung von Tutorien und neuen Vorlesungsreihen (digitale Einführungsvorlesung Mediävistik) in Krakau und die Durchführung einer gemeinsamen Sommerakademie in Krakau.
Und dazu gehört – nicht zuletzt – das vorliegende Online-Journal „Textdynamiken“, das als Jahrbuch der Partnerschaft und Open-Access-Publikation erscheint. Das Online-Journal soll sowohl die Ergebnisse des wissenschaftlichen Austausches im Rahmen der Institutspartnerschaft abbilden als auch engagierten Studierenden und jungen Nachwuchswissenschaftler:innen ein Forum zur Publikation bieten. Der Titel „Textdynamiken“ wird dabei von den Herausgeber:innen programmatisch verstanden: als Dynamiken von Texten, die in den verschiedenen Beiträgen aus verschiedenen Fachperspektiven untersucht werden, und als Dynamiken, die sich in der Zusammenarbeit zwischen Krakau und Leipzig in der eigenen Textpraxis vollziehen.
Als Projektteam und Herausgeber:innen möchten wir uns bei den Personen bedanken, die die Institutspartnerschaft und das Journal unterstützt und mit auf den Weg gebracht haben. Unser großer Dank geht an den Deutschen Akademischen Austauschdienst, dessen Förderung diese Institutspartnerschaft überhaupt erst möglich gemacht hat. Namentlich danken möchten wir Karin Führ für ihre Beratung. In dieser Hinsicht möchten wir uns außerdem herzlich bei Tabea Mager und Dr. Isabelle Maringer von der Stabsstelle Internationales der Universität Leipzig für ihr Engagement und ihre professionelle Unterstützung bei der Beantragung und Umsetzung der Partnerschaft bedanken. Ferner danken wir Katharina Triebe und Tim Grützner für Design und Programmierung von Website und Online-Journal. Danken möchten wir auch Adriana Slavcheva vom Open Science Service der Universitätsbibliothek Leipzig sowie Alexander Böhle und Anna Luise Klemm, die das Projekt als Studentische Hilfskräfte unterstützt haben. Ganz besonderer Dank gebührt Franziska Röder für ihren unermüdlichen Einsatz in organisatorischen und administrativen Belangen.
Beitrag 1
Bericht zu GIP Lehraustausch-Textdynamiken: Tutorium Der Zauberberg
Das Ausrichten des Tutoriums zu Thomas Manns Zauberberg im Zuge des GIP-Lehraustauschs – Textdynamiken zwischen der Universität Leipzig und der Universität Krakau war für mich eine wichtige Erfahrung. Einerseits lag das am Gegenstand, da auch vertraute Texte im Zuge einer didaktischen Aufbereitung noch einmal eine ganz andere Form der Beschäftigung nötig machen. Andererseits freute ich mich aber auch auf die Möglichkeit, an einem internationalen Lehrprojekt teilzunehmen. Schwierigkeiten hatte ich in der Vorbereitung vor allem bei der Formulierung einer Zielstellung des Tutoriums, da zwar ein repräsentativer Überblick über prominente Themen und ästhetische Besonderheiten wünschenswert ist, aber mit bloß vier Sitzungen sehr wenig Zeit zur Verfügung stand. Didaktisch zeichnen sich Tutorien traditionell durch ein hohes Maß an Beteiligung von Studierendenseite aus, was auch hier durch die kleine Gruppengröße naheliegend war. Diesen Spagat zwischen einer repräsentativen Behandlung des Romans unter Vermeidung grober Vereinfachungen und der Beibehaltung des offenen und mitarbeitsintensiven Formats in einem sehr engen Zeitrahmen muss ich rückblickend als größte Herausforderung betrachten. Ich glaube, dass es mir sehr gut gelungen ist, entscheidende Inhalte und Formelemente des Romans durch thematische Abstraktionen und Bündelung von über den gesamten Roman verteilten Texteinheiten auf vier Sitzungen aufzuteilen. Die dafür notwendige Verdichtung des Stoffs führte jedoch zu einer enormen Komplexität, der man im Vorlesungsformat vermutlich durch sukzessive, konzentrierte Argumentation gerecht werden kann. Die in meinen Augen entscheidenden Inhalte diskursiv mit den Studierenden aus dem Text herauszuarbeiten erwies sich als herausfordernd und bedurfte mitunter stärkerer Anleitung, als ich es didaktisch vorgesehen hatte. Aufgrund des sehr engen Zeitrahmens und einem verständlicherweise geringen Vorwissensstand der Studierenden bezüglich literarischer, biographischer und philosophischer Bezüge des Zauberbergs schien mir jedoch keine ganz zufriedenstellende Symbiose zwischen komplexem, bedeutungsvollem Lehrinhalt und offener, diskussionsfreudiger Lehrmethode möglich. Dies sollte bei künftigen Tutorien im Voraus bedacht und Ziele, Inhalte und Methoden entsprechend abgestimmt werden.
Trotz der didaktischen Herausforderungen erscheint mir dieses Tutorium als gelungenes Beispiel für eine Internationalisierung der Hochschullehre. Der Austausch zwischen mir als deutschem Muttersprachler in der lehrenden Rolle und den polnischen Studierenden der Germanistik über den Zauberberg – einen hochkanonischen deutschsprachigen Roman – verlief reibungslos, was auch am hohen sprachlichen Niveau der Studierenden lag. Die von den Teilnehmer:innen zu Beginn angeführten Berührungsängste mit diesem sehr langen und komplexen Roman konnten durch meine muttersprachliche Perspektive reduziert und Unklarheiten schnell aufgeklärt werden. Ein hoher Kompetenzzuwachs sollte bei den Germanistikstudierenden zusätzlich dadurch erreicht worden sein, dass sie literaturwissenschaftliche Diskussionen über den gesamten Zeitraum des Tutoriums ausschließlich in deutscher Sprache geführt haben.
Beitrag 2
Erfahrungsbericht zum Phonetik-Tutorium im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft
Das Phonetik-Tutorium im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft Leipzig-Krakau (GIP) war für mich in erster Linie eine Gelegenheit herauszufinden, was es heißt, ein:e Tutor:in zu sein. Als Masterstudierende hatte ich bisher nur wenig Berührungspunkte mit der Lehraktivität und war deshalb besonders motiviert, in diesem Bereich erste Erfahrungen zu sammeln.
Bereits während der Planungsphase hat sich ein Problem offenbart, das das Tutorium über die gesamte Dauer hinweg begleiten sollte und mir zugleich die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen eines Online-Tutoriums aufzeigte: die Technik. (Die Universität Krakau verwendet für die Online-Lehre das Programm ‚Microsoft Teams‘, welches mit meiner Version von Teams anfangs nicht kompatibel war). Ich war daher gezwungen, kreative Lösungen für wiederkehrende technische Probleme zu finden, z. B. der gelegentliche Ausfall der Bildübertragung oder fehlende Administrationsrechte, sodass ich als Tutorin von den Krakauer Student:innen in den mir zur Verfügung gestellten Raum eingeladen werden musste.
Ich musste lernen, diese Hindernisse nicht als solche zu sehen, sondern mit den Gegebenheiten zu arbeiten. Meine Betreuerin, Frau Dr. Radzik, hat mir thematische Orientierungshilfen gegeben, mir aber sonst relativ viele Freiheiten bzgl. der Planung und der Durchführung des Tutoriums gegeben. Die Vorteile waren für mich, dass ich verschiedene Übungsformen mit den Studierenden ‚ausprobieren‘ und so für mich feststellen konnte, welche phonetischen Übungen im Rahmen eines Online-Tutoriums gut oder weniger gut funktionieren und wieso. Dieser Lernprozess hat auch in Bezug auf die Studierenden stattgefunden. Als Tutorin habe ich gelernt, auf die spezifischen Bedürfnisse der Krakauer Studierenden einzugehen, die als Nicht-Muttersprachler:innen völlig andere Bedürfnisse und Anforderungen an ein Tutorium stellten, als es bei deutschsprachigen Studierenden der Fall sein würde. Selbstverständlich war mir bewusst, dass ein Tutorium im Rahmen einer Institutspartnerschaft „anders“ verlaufen würde, als ein „reguläres“ Phonetik-Tutorium vor deutschsprachigen Germanistikstudierenden, doch habe ich zu Beginn noch fehleingeschätzt, wie die Wünsche der Krakauer Studierenden an das Tutorium konkret aussähen. Daher habe ich im Laufe des Tutoriums auch bemerkt, dass meine ursprüngliche Vorstellung bzgl. der Planung des Tutoriums von der tatsächlichen Umsetzung korrigiert wurde. Ich lernte, in der Lehre flexibel zu bleiben und mich weniger darauf zu konzentrieren, den zu lehrenden Stoff in der jeweiligen Einheit in Gänze abzuarbeiten, sondern vielmehr auf die Studierenden selbst einzugehen, um so als Tutorin deutsche Aussprache und Aussprachephänomene besser vermitteln zu können, und so auch in einen Dialog mit den Krakauer Student:innen zu kommen.
Rückblickend war das Tutorium trotz technischer Widrigkeiten eine wichtige und wertvolle Erfahrung, die ich auch jederzeit wiederholen würde und anderen Studierenden nur empfehlen kann.
Beitrag 3
Textdynamiken der Neueren deutschen Literatur Im Spannungsfeld von Archiv, Schrift und Intermedialität
Ein wichtiger Baustein der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen Krakau und Leipzig ist der Lehr- und Lernaustausch. Die globale Pandemie stellt diesen Austausch vor erhebliche Herausforderungen; zugleich bieten sich durch die gestiegene Nutzung und Akzeptanz digitaler Instrumente neue Möglichkeiten für die Internationalisierung der Lehre und den Austausch von Dozierenden und Studierenden verschiedener Länder. Im Bereich der Literaturwissenschaft wurden zwei regulär im Curriculum verankerte Seminare am jeweiligen Standort um gemeinsame Werkstätten ergänzt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal, Dr. Stephanie Bremerich und Dr. Paweł Zarychta kamen im Mai 2021 Studierende und Lehrende aus Krakau und Leipzig in zwei digitalen Blocksitzungen live zusammen. Textdynamiken, das meinte hier auch: Dynamiken des Lehr- und Lerndialogs.
Im Fokus des literaturwissenschaftlichen Team-Teachings standen Textdynamiken der Schrift im Spannungsfeld von editionsphilologischen, archivarischen und intermedialen Dimensionen.
Die erste Werkstatt am 15. Mai wurde von Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal und Dr. Paweł Zarychta geleitet.
Sich auf seine bisherige Beschäftigung vor allem mit den deutschsprachigen Archivalien in den Beständen der Jagiellonen-Bibliothek stützend, ging Paweł Zarychta auf die in Krakau befindliche Sammlung Varnhagen ein, um einen Versuch zu unternehmen, diese Kollektion als Text zu interpretieren und auf dessen mögliche Dynamiken hinzuweisen. Ausgegangen wurde dabei zunächst von der These Ulrich von Bülows, dass Nachlässe eine Art Kosmos darstellen, der von diversen inneren und äußeren Kräften geformt und beeinflusst wird. Wenn sie oft auch im Zustand der Latenz bleiben, gilt es diese aufzudecken und zu interpretieren. Archive und Nachlässe werden dabei einerseits als individuelles Funktionsgedächtnis, andererseits als Texte verstanden, denen eine komplexe Semantik innewohnt, die sich aus diversen Gesichtspunkten beleuchten und verfolgen lässt. Nach der kursorischen Besprechung dieser theoretischen Aspekte stellte Zarychta zunächst die Geschichte der Sammlung Varnhagen und deren Weg von Berlin nach Krakau vor, um dann in den weiteren Teilen des Workshops auf diverse in Frage kommende Dimensionen der (Text-)Dynamik mit Blick auf die Sammlung Varnhagen hinzuweisen. So wurden z. B. die Dynamiken der Sammlungsformation, der darin festgehaltenen Individualnarrationen, der wissenschaftlichen Erforschung sowie, last but not least, die Dynamiken des handschriftlichen Materials anhand der ausgewählten Beispiele aus der Sammlung Varnhagen in den Beständen der Jagellonen-Bibliothek Krakau angesprochen, womit eine Brücke zu den Ausführungen Katarzyna Jaśtals geschlagen wurde. Dadurch konnte zumindest im Ansatz gezeigt werden, dass Nachlässe nicht zwangsläufig als passive Orte irgendwo in verstaubten Archiven, sondern als Quellen einer aktiven Wissensproduktion mit einer hohen Attraktivität für die Forschung erscheinen können.
Das Konzept des Textes als mehrschichtiges Gefüge, dessen Dynamik u.a. durch Überlagerung der einander potenzierenden bzw. widersprechenden sinntragenden Schichten in Gang gesetzt wird, war leitend für die von Katarzyna Jaśtal vorgenommene Darstellung von drei ausgewählten Korrespondenzen Heinrich von Kleists. Zunächst wurde das Phänomen „Brief-Handschrift“ im Sinne der aktuellen Materialitätsforschung als eine Mitteilungsform reflektiert, bei der die materiellen Aspekte nicht nur die Dynamik des realen Schreibprozesses selbst erkennen lassen, sondern vor dem Hintergrund zeitgeschichtlicher epistolarer Konventionen auch als sinntragend zu interpretieren sind. Am Beispiel eines Briefs Heinrich von Kleists an Achim von Arnim und zweier Briefe an seine Halbschwester Ulrike wurde gezeigt, wie die in bedeutungstragender Funktion eingesetzten materiellen (insbesondere brieftopographischen) Elemente die verbal deklarierte Schreibabsicht des Autors bestätigen, potenzieren bzw. unterlaufen, und somit, wie ein Brieftext unter der Hand eines Korrespondenten im 19. Jh. in Bewegung gerät.
In ihrer Arbeit Zu Dynamiken des Schreibens in den Korrespondenzen Ingeborg Bachmanns und Paul Celans anhand Paul Celans Brief vom 31.10.–1.11.1975 untersucht Maria Igolkina die Textdynamiken des im Titel genannten, komplexen Briefs, den sie als ein repräsentatives Beispiel der genannten Dichterkorrespondenz betrachtet. Igolkina analysiert die dynamische Verfasstheit des Textes, in dem die für Celan und Bachmann zentralen Aspekte des Sprechens, Schreibens und Schweigens eine besondere Kontur gewinnen. Indem sie sich auf die strukturellen Aspekte des Textes vor der Folie der epistolaren Konventionen konzentriert, zeigt sie, wie Celan das Thema der Reise, d.h. der Bewegung im Raum, mit einer Imagination des Textraumes verknüpft, in dem er sich durch Sprünge bewegt.
Im Beitrag „Als Liebesbriefwechsel nicht wahrnehmbar?“ Zwei Briefe Rahel Levin Varnhagens an Karl August Varnhagen wendet sich Justyna Bartyzel der Korrespondenz zwischen dem berühmten Berliner Intellektuellenpaar Varnhagen zu. An zwei ausgewählten Briefen von Rahel Levin Varnhagen an ihren (künftigen) Ehemann reflektiert Bartyzel die kontroverse Frage der Zuordnung der genannten Korrespondenz zur Gattung „Liebesbrief“. Sie konzentriert sich auf Passagen, in denen die Zuneigung der Korrespondentin zum Empfänger und ihre emotionale Bewegtheit während des Schreibprozesses artikuliert wurden, und untersucht einschlägige lexikalische und syntaktische Merkmale der Texte. Dabei stellt sie heraus, wie bestimmte textuelle Strategien von der Briefautorin fortgesetzt und modifiziert werden, womit den Lesern des Beitrags ein (partieller) Einblick in die Dynamik der genannten Korrespondenz gewährt wird.
In der zweiten Werkstatt am 29. Mai wies Stephanie Bremerich exemplarisch auf die Dynamiken zwischen sprachlichen und visuellen Zeichensystemen in der Avantgarde hin. In den Avantgardebewegungen sind literarische Verfahren (Montage, Collage, Intertextualität, Intermedialität) sowohl im Hinblick auf ihre poetologischen Grundlagen (Innovationsanspruch, Sprengung von Gattungsgrenzen und Formtraditionen, Verbindung von Kunst und Lebenspraxis) als auch auf deren texttheoretische Konsequenzen (Erweiterung des Textbegriffes) zu befragen. Anhand von Unica Zürns Haus der Krankheiten (1958), einem in der Tradition des Surrealismus stehenden hybriden Text, in dem sich Handschrift und Handzeichnung kongenial gegenüberstehen und in dem die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion, Traum und Wirklichkeit verschwimmen, wurden intermediale Spannungen zwischen Bild und Text diskutiert .
In Der Schlaf der Vernunft gebiert Abenteuer wendet sich Maraike Katharina Szesny dem ebenso rätselhaften wie faszinierenden Collageroman La femme 100 têtes (1929) von Max Ernst zu. Von besonderem Interesse ist André Bretons vorgeschaltete Anweisung für den Leser – ein programmatischer Text des Surrealismus, der von der Forschung bislang wenig beachtet wurde. Szesny begegnet diesem Desiderat, indem sie die Dynamiken zwischen Text und Paratext aufzeigt. Die Spannungen zwischen den Bildcollagen in La femme 100 têtes und Bretons Vorwort untersucht sie sowohl unter rezeptionsästhetischen Gesichtspunkten (Lektürelenkung) als auch im Hinblick auf poetologische: Bretons Anweisung weise nicht nur deutlichen „Manifest-Charakter“ auf, sondern sei „Schlüssel der Interpretation von Ernsts Roman“.
Jan König wendet sich in seinem Beitrag einer wichtigen deutschen Dadaistin zu. In Der Garten der Hannah Höch als Teil eines künstlerischen und persönlichen Netzwerks am Beispiel des Briefaquarells ‚Selbst im Garten‘ setzt er die Technik des Collagierens in Bezug zum Garten Höchs, der während der Zeit des Nationalsozialismus und der damit verbundenen Isolation ebenso Refugium wie künstlerische Inspirationsquelle für die Künstlerin war. „Die Verflechtung von Höchs gärtnerischer Tätigkeit mit persönlichen Erlebnissen, politischen Ereignissen und ihrem künstlerischen Wirken“ rückt König als eine besondere Form der Textdynamik in den Blick, wie er anhand eines Briefaquarells, in dem sich Bild- und Textelemente verbinden, herausarbeitet.
Beitrag 4
Zu Dynamiken des Schreibens in dem Brief Paul Celans an Ingeborg Bachmann vom 31.10.–1.11.1975
Zwei der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts, Ingeborg Bachmann und Paul Celan, finden im Mai 1948 im Nachkriegswien zusammen. Von Anfang an gibt es in ihrer Beziehung einen Platz für Dramatik, was nach Barbara Wiedemann und Bertrand Badiou in der Diskrepanz der Schicksale der Dichter begründet bleibt. Bachmann und Celan begegnen sich als eine „Philosophie studierende Tochter eines frühen österreichischen Mitglieds der NSDAP und ein staatenloser Jude deutscher Sprache aus Czernowitz, der beide Eltern in einem Konzentrationslager verloren und selbst ein rumänisches Arbeitslager überlebt hatte.“ (Wiedemann / Badiou 2008: 215) Während sie in den darauffolgenden Jahren als Menschen, Dichter und Schriftsteller reifen, durchläuft ihre Liebesgeschichte spannungsvolle Entwicklungen. Ihre Entsprechung finden sie in dem Briefwechsel, dessen Texte nicht auf die persönliche Beziehungsebene beschränkt bleiben, sondern sich selbst und die theoretischen Fragestellungen des Schreibens, darunter die Autorschaft, das Ringen um die Sprache und literarische Kompromisse, erörtern sowie intertextuelle Verweise auf Werke anderer Autoren und Lyrik der Korrespondenten enthalten.
Versucht man die Dynamik dieses gesamten Briefwechsels festzuhalten, wären folgende Fakten zu nennen: Zu seinem Korpus zählen insgesamt 196 Dokumente, darunter Briefe (hierzu werden von der Wissenschaft auch nicht abgesandte Briefe und Briefentwürfe gerechnet), Postkarten, Telegramme, Widmungen und eine Gesprächsnotiz. Die erhaltene Korrespondenz beginnt im Mai 1948, als die knapp zweiundzwanzigjährige Bachmann und der siebenundzwanzigjährige Celan in der literarischen Gesellschaft kaum bekannt sind. Bis 1952 fallen an ihrem epistolaren Dialog zwei thematische Dominanten auf, nämlich die Beziehung zwischen den Korrespondenzpartnern und die Bedingungen des Büchermarktes. Widmen Bachmann und Celan dem ersten Thema, bei dem insbesondere die Begegnungen und Trennungen reflektiert werden, gefühlsbetonte Zeilen, erscheinen ihre Hinweise auf Zeitschriften, Publikationsmöglichkeiten und Verleger sachlich und nüchtern. In dieser Zeit spielt Bachmann die führende Rolle in der Korrespondenz (vgl. ebd.: 218).
Im Jahre 1952 wurde der Briefwechsel unterbrochen und es sollte über fünf Jahre dauern, bis er nach einem zufälligen Treffen der Partner bei einer im Herbst 1957 in Wuppertal organisierten Konferenz wieder aufgenommen wurde. Nach diesem Wendepunkt der Liebesgeschichte wurden nach fünf Jahren des Schweigens sowohl die Liebesbeziehung als auch die Korrespondenz wieder aufgefrischt. In dieser Phase der Korrespondenz, in der beide Schriftsteller bereits mit anderen Partnern zusammen waren – der Dichter heiratete 1952 die Künstlerin Gisèle Lestrange, die Lyrikerin begann 1958 ihre literarisch folgenreiche Beziehung mit Max Frisch –, war es Celan, der die Initiative ergriff und den bestimmenden Anteil an der Korrespondenz hatte: „[…] [E]r überschüttet[e] sie [Bachmann] mit Briefen und Gedichten“ (ebd.: 220). Nach 1961 lief die Korrespondenz aus, außer zwei kurzen Briefen Celans, die unbeantwortet blieben, herrschte Schweigen.
Im Folgenden möchte ich mich einem der Briefe Celans aus der zweiten Phase der Beziehung zuwenden, d.i. einer Phase, bei deren Erforschung vor allem die Zeit um 1959 fokussiert wird. Damit wird vordergründig ein Zeitraum unter die Lupe genommen, in dem der Schriftsteller unter den gegen ihn ins Feld geführten Plagiatsvorwürfen von Claire Goll und einer vernichtenden Kritik des Lyrikbandes Sprachgitter aus der Feder des Journalisten Günter Blöcker litt, was seine Korrespondenz mit der Geliebten wesentlich beeinflusste. Der von mir gewählte Brief entstand zwei Jahre vor dieser kritischen Lebensphase, nämlich 31.10.–1.11.1957. Entscheidend für meine Wahl waren der repräsentative Charakter und die dynamische Verfasstheit dieses Schreibens. Der dichte Text verbindet die für das literarische Schaffen Celans und Bachmanns zentralen Fragestellungen des Sprechens, Schreibens und Schweigens mit dem Thema der Liebe und verankert sie biografisch. Zugleich stellt er das Thema der mit der Hoffnung auf ein Treffen verbundenen Reisen und damit die Bewegung im Raum heraus. Er realisiert eigenwillig die konventionellen Merkmale der Briefstruktur, wobei er u.a. eine Imagination des Textraumes entfaltet, in dem sich der Briefschreiber durch Sprünge bewegt.
Der Text des Briefes vom 31.10.–1.11.1957 lautet:
am 31. Oktober 1957.
Heute. Der Tag mit dem Brief.
Zerstörung, Ingeborg? Nein, gewiß nicht. Sondern: die Wahrheit. Denn dies ist ja wohl, auch hier, der Gegenbegriff: weil es der Grundbegriff ist.
Vieles überspringend:
Ich werde nach München kommen, Ende November, gegen den 26ten.
Ins Übersprungene zurück:
Ich weiß ja nicht, was all das bedeutet, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Bestimmung, vielleicht, Schicksal und Auftrag, Namensuche hat keinen Sinn, ich weiß, dass es so ist, für immer.
Auch mir gehts wie Dir: daß ich Deinen Namen aussprechen und aufschreiben darf, ohne mit dem Schauer zu hadern, der mich dabei überkommt – für mich ists, trotz allem, Beglückung.
Du weißt auch: Du warst, als ich Dir begegnete, beides für mich: das Sinnliche und das Geistige. Das kann nie auseinandertreten, Ingeborg.
Denk an ,In Ägypten‘. Sooft ichs lese, seh ich Dich in dieses Gedicht treten: Du bist der Lebensgrund, auch deshalb, weil Du die Rechtfertigung meines Sprechens bist und bleibst. (Darauf habe ich wohl auch damals in Hamburg angespielt, ohne recht zu ahnen, wie wahr ich sprach.)
Aber das allein, das Sprechen, ists ja gar nicht, ich wollte ja auch stumm sein mit Dir.
Eine andere Gegend im Dunkel:
Warten: ich habe auch das erwogen. Aber hieße das nicht auch darauf warten, daß das Leben uns in irgendeiner Weise entgegenkommt?
Uns kommt das Leben nicht entgegen, Ingeborg, darauf warten, das wäre wohl die uns ungemäßeste Art, da zu sein.
Da sein, ja, das können und dürfen wir. Da sein – für einander.
Und wenns nur ein paar Worte sind, alla breve, ein Brief, einmal im Monat: das Herz wird zu leben wissen.
(Und doch, eine konkrete Frage, die Du schnell beantworten mußt: Wann fährst Du nach Tübingen, wann nach Düsseldorf? Man hat mich ebenfalls dorthin eingeladen.)
Weißt Du, daß ich jetzt wieder sprechen (und schreiben) kann?
Ach, ich muß Dir noch viel erzählen, auch Dinge, die selbst Du kaum ahnst.
Schreib mir.
Paul
P.S.
Seltsamerweise mußte ich, auf dem Weg in die Nationalbibliothek, die Frankfurter Zeitung kaufen. Und auf das Gedicht stufen, das Du mir zusammen mit der Gestundeten Zeit schicktest, auf einem Papierstreifen geschrieben, mit der Hand. Ich hatte es immer für mich ausgelegt, und nun kommts wieder auf mich zu – in welchem Zusammenhang!
1.XI.57.
Verzeih, Ingeborg, verzeih die dumme Nachschrift von gestern – ich will vielleicht nie wieder so denken und sprechen.
Ach, ich bin so ungerecht gegen Dich gewesen, all diese Jahre, und die Nachschrift war wohl ein Rückfall, der meiner Ratlosigkeit zu Hilfe kommen wollte.
Ist ,Köln, Am Hof‘ nicht ein schönes Gedicht? Höllerer, dem ichs neulich für die Akzente gab (durfte ich das?), meinte, es sei eines meiner schönsten. Durch Dich, Ingeborg, durch Dich. Wäre es je gekommen, wenn Du nicht von den ,Geträumten‘ gesprochen hättest. Ein Wort von Dir – und ich kann leben. Und daß ich jetzt wieder Deine Stimme im Ohr hab!
(Celan 1957: 64f.)[^1 Im Folgenden wird die Edition des Briefes mit der Sigle PC und der Seitenangabe zitiert.]
1. Ein Briefanfang ohne Anrede
Über lange Zeit, von 1948 bis 1967, stehen Ingeborg Bachmann und Paul Celan in brieflichem Kontakt. In den meisten Briefen Celans wird Bachmann, den brieflichen Konventionen entsprechend, mit ihrem Vornamen und häufig mit dem Adjektiv „lieb“ sowie auch mit dem Pronomen „mein“ angeredet, d. h. als „Ingeborg“,[^ PC 8] „Meine liebe Ingeborg“,[^ PC 12] „Liebe Inge“,[^ PC 32] „Meine liebe Inge“.[^ PC 34] Doch den Brief vom 31. Oktober 1957 beginnt Paul Celan ohne konventionelle Anrede, wonach er in einem weiteren Teil des Briefes deklariert, dass das Aussprechen des Namens der Geliebten für ihn eine Beglückung bedeutet. Doch er beginnt den Brief nicht mit einem solchen beglückenden Akt und verwendet erst in der oben zitierten Deklaration den früher ausgesparten Vornamen. Mit dieser im Hauptteil des Schreibens lokalisierten Ergänzung wird einerseits der Mangel des Namens am Briefanfang ausgeglichen, und es werden andererseits zwei Teile des Textes verbunden, was zur Steigerung seiner Kohärenz beiträgt.
Bevor es aber dazu kommt, beginnt er den Brief mit den auf die Datums- und Ortsangabe direkt folgenden Worten: „Heute. Der Tag mit dem Brief.“[^ PC 64] Die Ausdrücke beziehen sich nicht, wie zu erwarten, auf die Adressatin. Das Temporaladverb „Heute“ stellt den Gegenwartsbezug heraus, die darauffolgende substantivische Gruppe definiert diese Gegenwart durch den Bezug auf das Briefschreiben.
Die Verwendung der Substantive zu Beginn des Briefes wirkt prägnant und erscheint zugleich statisch. Bei der Lektüre hält die Bewegung der Lektüre bei diesen Worten inne. Die Interpunktion verlangsamt das Lesen, denn der Punkt zwischen den Ausdrücken scheint eine Denkpause zu markieren, die auch als eine Atempause realisiert werden kann, die die Bewegung des Lesens verlangsamt. Nach dem Ausdruck „Heute.“ hält die Leserin den Atem an, bevor sie weiterliest: „Der Tag mit dem Brief.“ Substantive sind Sprachformen, die dem Ausdruck der Bewegung nicht förderlich sind. Das Temporaladverb „Heute“ und Substantive, d.h. statische Elemente, mit denen Celan seinen Brief eröffnet, heben sich von dem Hauptteil des Briefes ab, für den die Bewegung im Briefraum und Bewegung im realen Raum eine wichtige Rolle spielen.
2. Zum Hauptteil des Briefes
Nach der Briefkonvention wäre nach dem Anfang, der salutatio, der Hauptteil zu erwarten, in dem nach einer captatio benevolentiae, d. i. Einstimmung auf die Situation der Leserin bzw. einer Einleitung des kommenden Themas, eine narratio, d. i. ein berichtender Teil, ferner eventuell eine petitio (eine Aufforderung oder ein Ersuchen) folgen, bevor der Hauptteil mit einer conclusio abgeschlossen wird, in der der Briefanlass noch einmal formuliert werden kann (vgl. Koch 1999: 546). Beendet wird der Brief darauffolgend mit einer Grußformel und der Unterschrift des Verfassers.
Die Auslassung der salutatio gleicht Celan nicht durch einen Versuch aus, auf eine traditionelle Art und Weise auf die aktuelle Lage der Empfängerin einzugehen, um mit dieser geläufigen Strategie ihr Wohlwollen zu gewinnen. Celans Worte orientieren sich aber doch an der Adressatin. Der Dichter geht nämlich direkt auf folgende bekümmerte Frage Bachmanns aus ihrem Brief vom 28.–29. Oktober 1957 ein: „Muß ich jetzt denken, daß ich Dich wieder unglücklich mache, wieder die Zerstörung bringe, für sie und Dich, Dich und mich?“ (Bachmann 1957: 63) Der Briefschreiber antwortet: „Zerstörung, Ingeborg? Nein, gewiß nicht. Sondern: die Wahrheit. Denn dies ist ja wohl, auch hier, der Gegenbegriff: weil es der Grundbegriff ist.“[^ PC 64] Durch die Lokalisierung dieser Antwort an einer so wichtigen Stelle wie dem Briefanfang wird ersichtlich, wie wichtig sie dem Schreiber gewesen ist. Er wiederholt den von Bachmann verwendeten Begriff, nennt erst hier zum ersten Mal den Namen der Adressatin und weist die Vermutung, dass die wieder aufgenommene Beziehung seine Ehe ruinieren wird, zurück. Die Wiederholung des Wortes „Zerstörung“ in Celans Brief verweist im doppelten Sinne zurück: nämlich nicht nur auf den oben genannten Brief der Geliebten vom 28.–29. Oktober 1957, sondern auch auf die frühere Phase der Beziehung, d.i. auf die vor fünf Jahren abgebrochene Korrespondenz. Indem er die Rückwärtsbewegung in die Vergangenheit thematisiert, weist der Absender darauf hin, dass er einen Sprung im Brieftext gemacht hat, indem er sich einer zukünftigen Reise und einem möglichen Treffen mit der Geliebten zuwandte. Die hier verwendete Metapher des Sprungs kann sowohl auf inhaltliche als auch formale Elemente des Briefes bezogen werden. Celan schreibt: „Vieles überspringend: Ich werde nach München kommen, Ende November, gegen den 26ten.“[^ PC 64] Die Lexeme „überspringend“ und „kommen“, die die Semantik von Fortbewegung zum Ausdruck bringen, stehen im Kontrast zum statischen Anfang des Briefes. Der Bewegung im Raum des Briefes entsprechen also das Thema der Reise und die Bewegungsverben auf der lexikalischen Ebene. Damit verbindet sich das strukturelle Merkmal des epistolaren Textes mit der Semantik der Aussage. Die Ansage der Reise kann als eine Textbewegung auch deswegen definiert werden, weil sie sich einem anderen Text, nämlich dem oben bereits zitierten Brief Bachmanns und dem darin artikulierten Wunsch („Wenn Du Ende November kommen könntest! Ich wünsche es mir.“ Ebd.: 63) öffnet.
Die dynamische Komponente in Celans Brief entspricht der von ihm in einem weiteren Teil thematisierten Entscheidung gegen das passive Warten auf eine Zeit, in der das Schicksal beiden Geliebten entgegenkommt. Die Entscheidung für ein aktives Verhalten erklärt er folgendermaßen: „Uns kommt das Leben nicht entgegen, Ingeborg, darauf warten, das wäre wohl die uns ungemäßeste Art, da zu sein“,[^ PC 65] womit er sich selbst und die Geliebte zum Handeln zu motivieren scheint. Nach der Ankündigung der Reise verweist der Absender auf einen Versuch, die Briefkonvention nicht außer Acht zu lassen und markiert im Text eine Rückwärtsbewegung mit den Worten „ins Übersprungene zurück“.[^ PC 64]
3. Zur Dynamik des Briefschlusses
Celan beendet seinen Brief auf eine konventionelle Art und Weise mit den Worten: „Ach, ich muß Dir noch viel erzählen, auch Dinge, die selbst Du kaum ahnst. Schreib mir“.[^ PC 65] Der Schreiber verbleibt im Rahmen der epistolaren Konvention, wenn er in die Zukunft, d. i. auf die Fortsetzung der Kommunikation verweist und die conclusio mit der petitio zusammenfallen lässt. Die den Brief abschließende Bitte wird mit einer Imperativform ausgedrückt. Der Schluss des Schreibens und die darin enthaltene Bitte sind knapp, einfach und prägnant; direkt danach kommt die Unterschrift „Paul“. Die Bewegung / Dynamik des Textes wird damit jedoch nicht abgeschlossen, ihr folgen zwei Postskripta, in denen Celan die literarischen Texte beider Korrespondenten thematisiert.
In dem ersten Postskriptum berichtet der Dichter, dass er in der Frankfurter Zeitung auf Bachmanns Gedicht stieß, das die Geliebte früher für ihn mit der Hand abschrieb und ihm mit dem Band Die Gestundete Zeit zuschickte. Dem Erlebnis, den von ihm bisher als eine intime an ihn gerichtete Nachricht verstandenen literarischen Text unerwartet in einer Zeitung lesen zu müssen, widmet der Autor keinen gesonderten Brief. Die Verwendung des Postskriptums gibt ihm die Möglichkeit, die Nachricht von einem irritierenden Ereignis an das zuvor Gesagte anzuschließen und zugleich die Dynamik des Schreibprozesses zu betonen, ohne den Text erneut beginnen zu müssen.
Nachdem Celan das erste Postskriptum beendet hat, fügt er ein weiteres hinzu, in dem er die Aussage des ersten zurücknimmt. Dieses beginnt er mit einer Datumsangabe, wobei er der von der Konvention vorgeschriebenen Struktur des Briefes folgt, da er darin Absätze, neue Gedanken und Überlegungen deutlich hervorhebt. Mit dem Datum trennt er erkennbar das am vorigen Tag geschriebene Postskriptum von dem am nächsten Tag hinzugefügten Teil. Gleichzeitig unterstreicht er die Kürze des Zeitraums, in dem sich seine Sichtweise änderte. In diesem zusätzlichen Teil des Briefes geht er auf die Worte aus dem ersten Postskriptum zurück, bittet die Empfängerin um Verzeihung für seine Aussage und verspricht, „nie wieder so [zu] denken und [zu] sprechen“ (ebd.: 65). Das finale Textstück ist sehr dicht. In ihm finden nicht nur die entschuldigenden Worte ihren Platz, sondern auch ein Geständnis, dass Celan jahrelang Bachmann gegenüber ungerecht war, und ein bewegendes Liebesbekenntnis. Der Dichter erklärt, ein einziges Wort der Geliebten sei ihm genug, um leben zu können. Dieses Postskriptum ist zeitlich sowohl rückwärts als auch vorwärts orientiert. Es wendet sich einerseits dem vorausgegangenen Textteil, andererseits der Vergangenheit der Beziehung zu und enthält ein Versprechen der Wiedergutmachung des Gewesenen. Mit dem doppelten Postskriptum zeigt Celan nicht nur die Dynamik der Textentstehung, er belegt, dass er seinen Standpunkt im Laufe eines Tages ändern kann.
4. Zu intertextuellen Bezügen des analysierten Brieftextes auf Celans Gedichte
In dem brieflichen Dialog zwischen Bachmann und Celan ist eine Vielzahl von Anspielungen auf ihre literarischen Texte zu erkennen (May u.a. 2012: 334). Es erscheint bemerkenswert, dass in dem analysierten Brief drei intertextuelle Bezüge vorliegen, die auf das Verhältnis des Brieftextes zur Literatur, in diesem Fall zu Gedichten, hinweisen. Es sind Verweise auf zwei lyrische Werke Celans (In Ägypten, Köln, Am Hof) und eins von Bachmann (der Name des Gedichtes wird im Brief nicht genannt, aber vermutlich ist von Im Gewitter der Rosen die Rede, vgl. Bachmann / Celan 2008: 278).
Celan betont, wie bedeutend die Rolle von Bachmann in seinem Leben sei im Hauptteil des Briefs mit den Worten:
Denk an ,In Ägypten‘. Sooft ichs lese, seh ich Dich in dieses Gedicht treten: Du bist der Lebensgrund, auch deshalb, weil Du die Rechtfertigung meines Sprechens bist und bleibst. (Darauf habe ich wohl auch damals in Hamburg angespielt, ohne recht zu ahnen, wie wahr ich sprach.)
Aber das allein, das Sprechen, ists ja gar nicht, ich wollte ja auch stumm sein mit Dir.
(Celan 1957: 64)
Die Wichtigkeit des hier genannten Gedichtes In Ägypten für die Beziehung und Korrespondenz der beiden Dichter kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es wurde von Celan 1948 zu Beginn der Bekanntschaft geschrieben und reflektiert die Liebe des lyrischen Ichs zu einer „Fremden“, womit die Ambivalenzen der Beziehung artikuliert werden. Seine Worte sollten bis zum Schluss des gesamten Briefwechsels für den Schriftsteller wichtig bleiben. Auch in dem hier analysierten Brief, der fast zehn Jahre nach der Entstehung des Gedichts geschrieben wurde, kehrt Celan zu ihm zurück. Damit wird die im Brief nicht erwähnte Fremdheit zwischen den Geliebten konnotiert. Zugleich wird das Gedicht im Brief zu einer Schwelle zwischen den Getrennten, denn die im zitierten Werk als „Fremde“ bezeichnete Geliebte wird von Celan 1957 als der „Lebensgrund“ und „die Rechtfertigung“ seines „Sprechens“ bezeichnet. (Ebd.: 65)
Celans zweites Gedicht, auf das sich der erwähnte Brief bezieht, entsteht im Oktober 1957 und heißt Köln, Am Hof (ebd.: 65). Es wurde wenige Tage nach der oben erwähnten Wiederbegegnung der Geliebten bei der Wuppertaler Tagung geschrieben und ist eine Erinnerung an den Neubeginn der Beziehung: an die Zeit, die Celan und Bachmann in Wuppertal während sowie nach der Tagung in einem Hotel in der Straße Am Hof verbracht haben (vgl. Renker 2017: 29). „Die Straße führt vom erzbischöflichen Palast bis zum Rathausplatz; das Gebiet war im Mittelalter den Juden zugewiesen. Die Straßenbezeichnung wurde zwischen Celan und Bachmann zu einer Art Codewort“ (Bachmann / Celan 2008: 275) in späteren Briefen. Das Gedicht beginnt mit dem Neologismus „Herzzeit“:
Herzzeit, es stehn
die Geträumten für
die Mitternachtsziffer.
Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,
einiges ging seiner Wege.
Verbannt und Verloren
waren daheim.
. . . . . . . . . . . . .
Ihr Dome.
Ihr Dome ungesehn,
ihr Ströme unbelauscht,
ihr Uhren tief ins uns.
(Bachmann / Celan 1957: 59f.)
In dem Zusatzteil seines Briefes vom 31.10–1.11.1957 hebt Celan hervor, dass das Gedicht dank Bachmann geschrieben wurde:
Ist ‚Köln, Am Hof‘ nicht ein schönes Gedicht? Höllerer, dem ichs neulich für die Akzente gab (durfte ich das?) meinte, es sei eines meiner schönsten. Durch Dich, Ingeborg, durch Dich. Wäre es je gekommen, wenn Du nicht von den ‚Geträumten‘ gesprochen hättest. Ein Wort von Dir – und ich kann leben. Und daß ich jetzt wieder Deine Stimme im Ohr hab!
(Celan 1957: 65)
Die Anspielung auf das Gedicht erinnert die Korrespondentin an eine bewegende Zeitphase nach der Wiederaufnahme der Beziehung. Mit der Anspielung wird sowohl auf einen vorausgegangenen literarischen Text als auch auf die spannungsvolle Lage der Geliebten zurückgewiesen, die sich in ihrer Beziehung sowohl „verbannt und verloren“ als auch „daheim“ fühlen. Der intertextuelle Bezug erhöht die Dynamik des Brieftextes.
5. Schlussfolgerungen
Der im vorliegenden Beitrag analysierte Brieftext zeichnet sich durch eine hohe Dynamik aus. Als dynamisch können die inhaltlichen Aspekte, d.h. die geplanten Reisen und die Spannungen in der Beziehung zwischen den Korrespondenten bezeichnet werden. Dynamisch erscheint auch die Form des Briefes, dessen Schreiber die Aufmerksamkeit der Empfängerin gekonnt steuert. Er überspringt oder realisiert eigenwillig die vorgeschriebenen Elemente der Briefstruktur und erzeugt den Eindruck einer sprunghaften Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, was die Aufmerksamkeit der Empfängerin erhöht. Er öffnet auch den Brieftext auf literarische Texte und lässt so eine Spannung zwischen den direkt ausgesprochenen und den verschwiegenen Aspekten der das Schreiben begründenden Beziehung erkennen. Die genannten Aspekte lassen den Brief zu einem bewegenden Dokument der Liebe beider Schriftsteller werden.
Primärliteratur
- Bachmann, Ingeborg / Celan, Paul (2008): Herzzeit. Der Briefwechsel. Mit den Briefwechseln zwischen Paul Celan und Max Frisch sowie zwischen Ingeborg Bachmann und Gisèle Celan-Lestrange. Hrsg. v. Bertrand Badiou u.a. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Sekundärliteratur
- Arnold, Heinz Ludwig (1995): Ingeborg Bachmann. TEXT+KRITIK. Bd. 6. München: Richard Boorberg, S. 124–135.
- Böschenstein, Bernhard / Weigel, Sigrid (Hrsg.) (1997): Ingeborg Bachmann – Paul Celan. Poetische Korrespondenzen. Vierzehn Beiträge. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Böttiger, Helmut (2017): Wir sagen uns Dunkles. Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan. München: Deutsche Verlagsanstalt.
- Hartmann, Florian (2013): Ars dictaminis. Briefsteller und verbale Kommunikation in den italienischen Stadtkommunen des 11. bis 13. Jahrhunderts. Ostfildern: Thorbecke.
- Gehle, Holger (1998): „Auschwitz“ in der Prosa Ingeborg Bachmanns. In: Braese, Stephan u.a. (Hrsg.): Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Frankfurt am Main / New York: Campus, S. 183–196.
- Koch, Peter (1999): Briefkunst. Ars dictaminis. In: Landfester, Manfred (Hrsg): Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Stuttgart / Weimar: Metzler, S. 545–551.
- May, Markus u.a. (2012) (Hrsg.): Celan-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: Metzler.
- Schöttker, Detlev (2008): Einführung: Briefkultur und Raumbildung. In: Ders. (Hrsg.): Adressat: NachwFelt. Briefkultur und Ruhmbildung. Paderborn: Fink, S. 9–16.
- Strob, Florian (2011): „Widerstand und Tradition. Das Schweigen der Dichterinnen und wie wir es lesen können.“ In: literaturkritik.de 8, https://literaturkritik.de/id/15645 (Abruf am 06.04.2022)
- Wimmer, Gernot (2014) (Hrsg.): Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Historisch-poetische Korrelationen. Berlin und Boston: De Gruyter.
Beitrag 5
„Als Liebesbriefwechsel nicht wahrnehmbar“ Zwei Briefe von Rahel Levin Varnhagen an Karl August Varnhagen
1. Einleitung
Die deutsche Intellektuelle jüdischer Herkunft und Berliner Salonnière Rahel Levin, verh. Varnhagen (1771–1833), war eine der Berühmtheiten ihrer Epoche. Obwohl sie kein literarisches Werk in publizierter Form hinterließ, werden ihre Briefe aufgrund der intellektuellen und ästhetischen Qualitäten heutzutage als literarische Texte gewürdigt. In der berühmten Korrespondenz der Autorin, die über 6000 Briefe hinterließ, nimmt der Briewechsel mit ihrem Ehemann, dem Diplomaten und Publizisten Karl August Varnhagen von Ense (1785–1858), als einer der umfangreichsten eine besondere Stellung ein. Die Ehe-Korrespondenz reflektiert sowohl die ungewöhnliche Beziehung der Meisterin der Briefkunst mit einem anerkannten Intellektuellen, Chronisten und Schriftsteller als auch die politischen und kulturellen Kontexte des bewegten 19. Jh. (vgl. Thomann Tewarson 1988: 99). Laut Barbara Hahn handelt es sich um eine „von vielen Legenden“ (Hahn 1990: 129) umstellte Korrespondenz. Sie wurde als ein wichtiges kulturgeschichtliches Zeugnis gelesen oder aber als „Dokument einer anstößig wirkenden Beziehung“ wahrgenommen, „in der die ältere Frau den dominierenden Part spielte und sich zu einem jüngeren und ihr in vielerlei Hinsicht unterlegenen Mann zuwandte; [a]ls Liebesbriefwechsel war er nicht wahrnehmbar […]“ (ebd.: 129). Die Schwierigkeit, diesen Briefwechsel als Liebeskorrespondenz zu klassifizieren, erklärt die Forscherin mit der Erkenntnis, dass in den genannten Briefen von der Liebe nur auf „eine schwer entzifferbare Weise die Rede“ sei (ebd.: 129).
Es ist anzunehmen, dass dieses kritische Urteil von der Kenntnis der biografischen Umstände des Ehepaares beeinflusst wurde. Die Verlobung von Rahel Levin mit dem jungen Diplomaten unterschied sich nämlich stark von ihren bisherigen, zwar unglücklichen und gescheiterten, aber am Anfang von Leidenschaft getragenen Bindungen: der Liebe zu Graf Karl Friedrich Albrecht Fink von Finckenstein (1772–1811) und der von Eifersuchtsausbrüchen des Geliebten geprägten Verlobung mit dem spanischen Gesandten Rafael Eugenio Rufino d’Urquijo Ybaizal y Taborga (1769–1839). Auch die mit einer kurzen Begegnung 1803 begonnene frühe Phase der Bekanntschaft von Rahel Levin mit Karl August Varnhagen verlief nicht ruhig. Die zukünftigen Eheleute waren zeitweise auch an anderen Partnern interessiert, was zu den sowieso schon zahlreichen (auch brieflich geführten) Auseinandersetzungen zwischen ihnen beitrug. Auf die Spannungen folgte Versöhnung: 1808 kam es zur Verlobung und am 27. September 1814 zur Heirat des Paares, mit der eine 19 Jahre lange, bis zum Tod der Schriftstellerin 1833 andauernde glückliche Ehe begann.
Der die Beziehung begleitende Briefwechsel ist, wie erwähnt, von beachtlichem Umfang. Nach eingehender Beschäftigung erscheint mir die Darstellung eines Überblicks über die gesamte Korrespondenz im Rahmen dieses Beitrags kaum möglich. So soll lediglich an zwei ausgewählten Beispielen aus dieser Korrespondenz, nämlich einem Brief Rahel Levin Varnhagens, der nach der Verlobungszeit am 26. September 1808 verfasst wurde und ihrem kurz nach der Heirat geschriebenen Brief vom 8. Oktober 1814, ein Teileinblick in die Dynamik dieses Briefwechsels geliefert werden. Die Konzentration liegt dabei auf der Zuordnung der genannten Briefe in die Kategorie ‚Liebesbrief‘. Dabei wird insbesondere auf inhaltliche und ausgewählt sprachliche Merkmale eingegangen, um diese als Markierungen von einerseits liebevoller Zuwendung und andererseits emotionaler Bewegtheit zu interpretieren.
2. Liebesbrief – Versuch einer Definition
Die Ersetzung eines Gesprächs zwischen den Abwesenden gilt als die Grundfunktion des Briefes. Einen wichtigen Platz nimmt der Brief in der Kommunikation der Verliebten ein, weil er dann zum Versuch wird, ihr intimes Verhältnis wiederzugeben und Emotionen, allen voran die Liebe, direkt und indirekt auszudrücken. Fest steht, dass der Liebesbrief als Medium der Offenbarung und Modellierung des Selbst und des Anderen die intime Beziehung der Korrespondenten als ein besonderes soziales System darstellt, das teilweise mithilfe einer eigenen Sprache funktioniert (vgl. Stauf u.a. 2013: 2f.). Die Herausgeber des Bandes Der Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart bezeichnen die Liebesbriefkultur als eine vielfältige, mehrstimmige Landschaft, in der verschiedene Formen der Kommunikation nebeneinander existieren. Dabei erkennen sie, dass typische Merkmale des Briefes – d.i. das Verbinden der Gegensätzlichkeiten Nähe und Ferne, Offenbaren und Verbergen, Selbst-Sein und Selbst-Mitteilen sowie die gegenseitige Wechselwirkung aufgrund der intimen Beziehung der Partner – in einem Liebesbrief besonders deutlich zu Tage treten (vgl. ebd. und Hübener u.a. 2020: 506).
Erfüllen die ausgewählten Korrespondenzen von Rahel Levin Varnhagen an ihren (zukünftigen) Ehemann diese Kriterien? Kann man in ihnen die Artikulation von bewegten Gefühlen erkennen?
3. Bewegte Gefühle: zum Brief Rahel Levins an Karl August Varnhagen vom 26. September 1808
Lieber Englischer! Gestern morgen gab man mir Deinen Brief! Im Gegentheil! Du schreibst hundertmal leichter, zusammenhängender und besser als ich! […] auch bin ich hier sehr zerstreut, sehr unterbrochen: muss für tausend Unwürdigkeiten sorgen, die mir den Kopf auseinandersetzen: aber alles besser, als in Berlin geblieben ohne Dich; denke ich an die Straßen und an die Orte von uns beiden, und daß ich dahin zurück muß, so zieht sich mir das Herz! – […] Du Lieber, theile mir alles mit; Du kannst mir alles sagen, und wie stolz, wie zufrieden macht es mich! Du gabst mir Festigkeit! Kurz, wir thun uns gut. (Wie sonderbar, wie scheinend und schmerzend war unser Umgang im Anfang!) Wie verlassen, ja wie ausgelacht komme ich mir ohne Dich vor. Mit Dir, neben Dir, hatte ich zu allem Muth; Du lehrtest mich ausführen, was ich für gut halte; Du lehrtest mich, was ich wohl in der Welt hätte haben können: Du bist der Einzige in der ganzen Welt, der mich je lieb hatte, der mich behandelt wie ich Andere. Ja ich bekenne es Dir gerne mit dem ganzen Drang der Erkenntlichkeit; von Dir lernte ich geliebt sein, und Du hast Neues in mir geschaffen. Nicht Eitelkeit – auch ist die nicht so schlecht, als man sie macht: nur das Lügen durch und für sie ist schlecht – ist es, die ewig mein Wesen mit Befriedigung durchdringt, Du wirst es wissen, Du! – bei dessen rechter Vorstellung die Thränen mir in die Augen dringen – es ist das endlich gesunde, kräftige, wahre, wirkliche Empfangen der Seele. Sie nimmt und giebt, und so wird mir ein wahres Leben geboren! […] Mit Dir war es mir anders als mit allen Menschen. […]. Ich liebe in Dir, daß Du mein Wesen erkennst, und daß das Erkennen sich in Dir ausdrückt, und wirkt, und äußert, wie es geschieht. Ich liebe Dich überaus zärtlich wieder, Du hast es hundertmal gesehen; ich könnte mein Leben mit Dir zubringen; es ist mein sehnlichster, ernster, jetzt einziger Wunsch; ich weihete Dir es in Freude und der größten Befriedigung; ich erkenne Deinen ganzen Werth, und nicht ein Pünktchen Deiner Liebenswürdigkeit, und Deines Seins – Skala hinauf und Skala hinunter – entgeht mir. Ich bin Dir treu aus Lust, Liebe und der gelassensten Wahl. […] endlich umfang’ ich Dich, Du lebst; und bist Du! Denke aber nicht, daß ich Dich ganz ohne Unruhe liebe. […]
(Varnhagen 1874: 44f.)
Die vorliegende umfangreiche Passage, aus der im Folgenden zitiert wird, erfüllt meines Erachtens repräsentativ die Kriterien eines Liebesbriefs: An mehreren Stellen drückt die Schreiberin ihre Liebe gegenüber dem Empfänger direkt aus und versichert ihm ihre Treue. Ein Sich-Verbergen erscheint ihr nicht nötig. Sie weiß um den Wert ihrer Liebe, behauptet, den Wert des Partners vollständig zu erkennen und sein völliges Vertrauen zu verdienen, ferner drückt sie die Überzeugung aus, dass auch Varnhagen sie vollständig versteht: „Ich liebe an Dir, dass Du mein Wesen erkennst“, schreibt sie und nimmt diesen Gedanken an einer weiteren Stelle im Text so auf: „Ich liebe Dich überaus zärtlich wieder, Du hast es hundertmal gesehen“. Mit diesen Behauptungen wird das Bild einer Verbindung gezeichnet, die v. a. auf gegenseitigem Verständnis baut. Rahel Levin akzentuiert das Besondere an dieser Beziehung, als sie dem Verlobten erklärt: „Mit Dir war es mir anders als mit allen Menschen.“ Diesen Zustand erklärt sie mit den Worten: „Du bist der Einzige in der ganzen Welt, der mich je lieb hatte […].“ Der Brieftext betont auch die Ausschließlichkeit der Beziehung beider Korrespondenten, dem Empfänger wird aber dabei viel Verantwortung auferlegt als dem einzigen Menschen, von dem sich die Briefschreiberin geliebt fühlt.
Die modellierende Kraft der Liebe erscheint in diesem Brief als ganz spezifisches Merkmal. Der Brief Rahel Levins lobt nämlich die Liebe ausdrücklich als eine lebenspendende Kraft, die zur Persönlichkeitsentfaltung der Autorin beigetragen hat. Sie schreibt: „Mit Dir, neben Dir, hatte ich zu allem Muth; Du lehrtest mich ausführen, was ich für gut halte; Du lehrtest mich, was ich wohl in der Welt hätte haben können“. Die Stelle, an der der jüngere Geliebte als ein Lehrer gelobt wird, ergänzt die Äußerung: „Du gabst mir Festigkeit!“, „[…] Du hast Neues in mir geschaffen“. Der Beitrag des jüngeren Partners zur Entwicklung der Persönlichkeit der 37-jährigen Partnerin wird mit diesem Eindruck mit Nachdruck akzentuiert.
In sprachlicher Hinsicht lässt sich im Text eine hohe Dichte der Personal- und Possessivpronomina nachweisen. Die oben kursiv wiedergegebenen Redeteile stehen im zitierten Brief vor allem in folgenden Formen: ich, du, mir, dir, mich, dich, mein, dein, wir, uns, unser; sie betreffen also die 1. und 2. Person Singular und 1. Person Plural. Sie und die ihnen entsprechenden Verbformen werden häufig innerhalb desselben Satzes aufeinander bezogen. Die meisten Sätze des Briefs betonen die Verbindung der Korrespondenten: Wenn „ich“ in der Subjekt-Funktion verwendet wird, dann kommt „du“ in der Rolle des Objektes und umgekehrt („du“ als Subjekt und „ich“ als Objekt). So wird nicht nur auf das Agens der jeweiligen Handlung hingedeutet, sondern es werden auch eine starke Wechselwirkung und das intime Verhältnis der Korrespondenten hervorgehoben. Dieses sprachliche Merkmal wird beibehalten, selbst in den seltenen Sätzen des Briefes, in denen äußere Gegenstände erwähnt werden. (Ein auffälliges Beispiel liefert der Satz: „[D]enke ich an die Straßen und an die Orte von uns beiden, und daß ich dahin zurück muß, so zieht sich mir das Herz!“) Mit der genannten Strategie wird die starke Subjektbezogenheit des Brieftextes akzentuiert. Ungeachtet des Gegenstands, von dem berichtet wird, werden die Liebenden und ihre Liebe immer in den Vordergrund gestellt.
Die Schreibhaltung der Korrespondentin akzentuiert die emotionale Bewegtheit, die offen genannt wird, wie z. B. in dem Satz „Du wirst es wissen, Du! – bei dessen rechter Vorstellung die Thränen mir in die Augen dringen –“. Dem Ausdruck der Emotionen entsprechen emphatische Wiederholungen (vgl. auch den früheren Satz: „Mit Dir, neben Dir hatte ich zu allem Muth.“). Darüber hinaus verwendet die Schreiberin zahlreiche Ausrufezeichen. Dazu kommt es bereits am Anfang des Briefes: „Lieber Englischer! Gestern morgen gab man mir Deinen Brief! Im Gegentheil!“ Eine besondere Dynamik bekommt der Text auch durch die Verwendung von mehreren Gedankenstrichen, die man in der Schrift dort verwendet, wo man in der gesprochenen Sprache deutliche Pausen macht oder wo man einen Einschub stärker als mit Kommata vom Rest des Satzes abheben möchte. An einer Stelle kombiniert die Briefautorin sogar die Verwendung der Gedankenstriche und Ausrufezeichen, um ihre Rührung auf der Ebene der Interpunktion wiederzugeben (vgl. „Du wirst es wissen, Du! – bei dessen rechter Vorstellung die Thränen mir in die Augen dringen –“).
Der zitierte Text verdient auch aus einem anderen Grunde Aufmerksamkeit. Viele Briefe Rahel Levins zeichnen sich durch originelle Metaphern und komplizierte, manchmal aphoristische Sätze aus, die mehrmalige Lektüren erfordern. Die Briefe Rahel Levins an Varnhagen enthalten diese Formen eher selten. Das erklärt Barbara Hahn folgendermaßen: „Varnhagen erschrickt vor Briefen, die keinen einfach benennbaren Inhalt haben, sondern in paradoxen Formulierungen und ungetümen Sätzen nach angemessenen Lösungen für Probleme suchen, für die es keine Sprache gibt.“ (Hahn 1990: 130) Im zitierten Schreiben bleiben die Sätze kurz, Satzgefüge liegen nicht vor. Dies lässt eine besondere Textdynamik entstehen. Mit dieser Schreibstrategie verweist die Absenderin darauf, dass sie sich von ihren Emotionen tragen lässt, denn im Zustand einer starken emotionalen Bewegtheit lassen sich keine logisch anspruchsvollen längeren Sätze konstruieren.
4. Ehepartner auf Reisen: Zum Brief Rahel Levin Varnhagens an Karl August Varnhagen vom 8. Oktober 1814
So eben, theurer, einziger, sehr geliebter Freund, habe ich Dir durch Barthold, denn ich den Brief adressirte, nach Wien geschrieben. Ich reise erst Montag nach Dresden, wohin ich meine Prager Briefe beschieden habe, an die Baronin von Grotthuß adressirt. Was soll ich so lange in Prag, wo ich ohne dich zu ungerne bin, im Finstern sitzen und warten! In Wien werde ich, allen Nachrichten zufolge, nicht hinein können: und dann wegen der Theuerung nicht hinaus!!! Ich bin sehr hypochondrisch drüber. Dieser Brief ist nur en l’air geschrieben; Du bist, wann er kommt, gewiß von Frankfurt. Der Wiener ist besser: und ärgerlicher, und doch besser. Noodt begleitet mich. Verlasse dich ganz auf meine innigste, zärtlichste, vertrauungsvollste Liebe; und sei gewiß, alles, was ich mit Dir zu bestehen habe, bestehe ich gerne und gut; und mit Freude, weil du bei mir bist. Du hast mich ganz erobert, und mir ist wohl dabei. Lebe auch wohl! Theurer! Wie sorgte ich, Dich die Nächte auf dem Felde zu wissen. Das kann mir, wie diese Trennung, der General nicht bezahlen. Sag ihm, was er mir anthut: aber ich bin stolz auf dies Opfer, wie ich mich immer fühle, wenn ich freudig bin. Ich umarme meinen geliebten August; und bin Deine R. R. […]
(Varnhagen 1875: 80)
Am 27. September 1814 heiratete Rahel Levin, die damals den Namen Robert trug, den vierzehn Jahre jüngeren Verlobten. Kurz darauf, Anfang Oktober, ging er nach Wien, um eine Stelle als preußischer Diplomat in Wien anzunehmen. Die Ehefrau sollte ihm bald folgen, am 20. Oktober 1814. Der Brief, aus dem auch im Folgenden zitiert wird, entsteht also einerseits in einer Zeit der Gewissheit – nach der langen Verlobungszeit sind die Korrespondenten ein Ehepaar geworden. Andererseits fällt er aber in eine bewegte Zeit. Die allgemeine politische und ökonomische Lage der deutschen Länder um 1814 ist instabil. Instabil ist auch die finanzielle und soziale Situation der Eheleute, die in der fernen österreichischen Stadt Fuß fassen sollen. Dem Brief wird das Thema der Bewegung eingeschrieben. Zu seiner Entstehungszeit befindet sich Varnhagen auf der Reise nach Wien, während seiner Frau diese Reise unmittelbar bevorsteht (vgl. Scurla 1979: 216).
Genauso wie in dem früheren wird auch in diesem Brief dem Empfänger die Liebe der Briefschreiberin mehrmals versichert. Die Zuneigung wird direkt ausgesprochen und mit den Epitheta „innigste“, „zärtlichste“, „vertrauungsvollste“ charakterisiert. Jedes dieser Epitheta wird im 19. Jh. häufig mit dem Substantiv „Liebe“ verwendet, auffallend an der Ausdrucksweise des Briefes ist aber ihre Häufung und Verwendung in superlativischen Formen. Eine Häufung der auf die Liebe der Briefschreiberin zum Ehemann hinweisenden Attribute („theurer, einziger, sehr geliebter“) wurde auch schon in der Grußformel verwendet. Damit entspricht die Ehefrau der Konvention: Solche Epitheta sind im Brief an den Ehemann üblich, durch ihre gehäufte Verwendung wirkt der Text emotional.
Ein deutlicher Unterschied gegenüber dem ersten Brief lässt sich in der Anredeform erkennen. Während sich die Briefschreibende an ihren Verlobten früher mit dem auf das ‚Übermenschliche‘ verweisende Wort „Englischer“ wandte, redet sie ihn hier zu Anfang des Briefes als Freund an. Die in der obigen Passage genannten Epitheta weisen diese Ehe-Freundschaft als einmalig und emotionsgeladen auf, zugleich werden beide Partner als Freunde auf dieselbe Stufe gestellt. Im Unterschied zum ersten Brief vom 26. September 1808 steht in dem späteren nicht das gegenseitige Verständnis, sondern das gegenseitige Vertrauen im Vordergrund. In demselben Satz, in dem die Korrespondentin ihre Liebe mit einem Superlativ als „vertrauungsvollst“ bezeichnet, versichert sie den Ehemann, dass auch sie selbst sein völliges Vertrauen verdient. Sie schreibt: „Verlasse dich ganz auf meine […] vertraungsvollste Liebe“. Am Schluss des Briefes wird der Empfänger als „mein lieber August“ angeredet und durch das Possessivpronomen der Korrespondentin ‚zugeordnet‘.
Dem an der Schwelle zu einer diplomatischen Karriere stehenden Ehemann bietet die Korrespondentin emotionale Unterstützung. Sie betont ihre Bereitschaft, Opfer für das Zusammensein des Paares mit Freude ertragen zu wollen. Dreizehn Tage nach der Heirat wird das Wesen der Beziehung nicht mehr erörtert. In dem früheren Brief vom 26. September 1808 verwies Rahel Levin auf den dynamischen Charakter ihrer Gefühle mit den Worten: „Denke aber nicht, daß ich Dich ganz ohne Unruhe liebe.“ Im Brief von 1814 scheint diese Spannung nicht mehr vorhanden zu sein. Die Autorin schreibt: „Du hast mich ganz erobert, und mir ist wohl dabei.“ In Bezug auf die emotionale Situation des Paares wird mit diesen Worten ein statischer Zustand angedeutet. Die Phase der Eroberung ist abgeschlossen, das Ziel des ‚Eroberers‘ Varnhagen wurde erreicht, die ‚Eroberte‘ erklärt sich mit dem erreichten Zustand zufrieden.
Die Herausgebenden des oben zitierten Bandes Der Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jh. bis zur Gegenwart erklären, dass jeder Liebesbrief im Modus einer vielfachen Bezugnahme stehe, aber ein gegebenes bzw. gesuchtes Verhältnis zu dem Adressaten oder der Adressatin immer als der Grundbezug zu betrachten sei (vgl. Stauf u.a. 2008: 1). Wie in dem früheren Brief Rahels steht auch in dem späteren die Beziehung zwischen der Absenderin und dem Empfänger im Vordergrund. Eingang in das Schreiben finden hier aber auch die Namen von Dritten, vor allem den Reisebegleitern beider Eheleute. Darüber hinaus wird über pragmatische Angelegenheiten wie Reisetermine und Reisestationen sowie finanzielle Befürchtungen berichtet. Diesem Themenbereich kann auch die fürsorgliche Erwähnung der Übernachtungsbedingungen des Adressaten (vgl. „die Nächte auf dem Felde“) zugeordnet werden, die zugleich auch mit dem anderen Thema des Briefes – der Liebe – im Zusammenhang steht. Diese Passage, in der beide Themenbereiche des Textes verbunden werden, trägt zur Kohärenz des Textes bei. Mit der Nennung der Namen von Freunden und Bekannten, d. h. mit der Einbeziehung von Dritten, wird das ‚Fenster auf die Außenwelt‘ geöffnet. Diese Öffnung ist allerdings nicht breit, denn alle erwähnten Namen beziehen sich auf Menschen, die mit der Reise bzw. mit dem Briefverkehr der Eheleute in Verbindung stehen, d. h. sie wieder zusammenbringen wollen.
Wie in dem früheren Brief lässt sich auch in dem späteren eine hohe Dichte der Personal- und Possessivpronomina in der 1. und 2. Person Singular nachweisen. Sie werden auch hier innerhalb eines Satzes aufeinander bezogen, um die Wechselbeziehung der Korrespondenten zu akzentuieren. Das erfolgt z.B. in den Äußerungen: „Was soll ich so lange in Prag, wo ich ohne dich zu ungerne bin, im Finstern sitzen und warten!“, „und sei gewiß, alles, was ich mit Dir zu bestehen habe, bestehe ich gerne und gut; und mit Freude, weil du bei mir bist.“ „Du hast mich ganz erobert, und mir ist wohl dabei.“
Auch in diesem späteren Brief verwendet die Absenderin Ausrufezeichen. Sie begleiten hier allerdings nicht den Textanfang, sondern beziehen sich auf den Ausdruck des Unwillens gegen einen einsamen Aufenthalt in Prag (vgl. den oben zitierten Satz „Was soll ich so lange in Prag […]“), Empörung über die teuren Reisebedingungen sowie die späteren Grußformeln („Lebe wohl! Theurer!“). Die Grußformel am Anfang des Briefes, die in den ersten Satz integriert wurde, enthält keine Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen werden in diesem späteren Brief nicht mehr effektvoll mit den Gedankenstrichen verbunden. Auch die Sätze dieses Briefs sind ähnlich wie im früheren nicht „ungetüm“ (Hahn 1990 :130), aber sie erscheinen länger als im früheren Brief. Die Briefschreiberin verwendet an einigen Stellen Satzgefüge (vgl. z. B. „Ich reise erst Montag nach Dresden, wohin ich meine Prager Briefe beschieden habe, an die Baronin von Grotthuß adressirt. Was soll ich so lange in Prag, wo ich ohne dich zu ungerne bin, im Finstern sitzen und warten!“). Der Rhythmus im zweiten Brief wirkt ruhiger als im ersten. Auch der spätere Brief erklärt und zeigt, dass er von Gefühlen getragen wird, sie erscheinen aber gemäßigter als diejenigen, die den ersten der Briefe getragen haben.
5. Schlussfolgerungen
Die Lektüre der in diesem Beitrag behandelten Briefe des Ehepaares Varnhagen erfolgte mit Fokussierung auf die Dynamik der Gattung Liebesbrief. Der erste analysierte Brieftext entstand nach der Verlobung, der zweite kurz nach der Heirat des Paars. Obwohl in der Forschung dem Briefwechsel der Varnhagens oft der Wert der Liebeskorrespondenz abgesprochen wurde, lassen sich in beiden Briefen Charakteristiken dieser Gattung finden. Dazu gehören die Artikulation der Liebesgefühle, Bezüge auf das intime Verhältnis beider Partner und die Betonung der modellierenden Kraft der Beziehung. In den Blick wurden vor allem Passagen genommen, in denen die Zuneigung zum Partner ausgedrückt und starke emotionale Bewegtheit der Korrespondentin während des Schreibprozesses suggeriert wird. Fokussiert wurden sprachliche Strategien, die dazu beitragen. Die hier analysierten Briefe gehören inhaltlich und formal nicht zu den berühmtesten und glänzendsten epistolaren Texten Rahel Varnhagens, sie liefern aber anschauliche Beispiele für die Fortsetzung und Modifikation von textuellen Strategien in den Briefen, die unterschiedliche Phasen ihrer Beziehung zu Karl August Varnhagen begleiten.
Primärliteratur
- Varnhagen, Rahel (1874): Brief an Karl August Varnhagen vom 26. September 1808. In: Assing-Grimelli, Ludmilla (Hrsg.): Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Erster Band. Leipzig: Brockhaus, S. 44–47.
- Varnhagen, Rahel (1875): Brief an Karl August Varnhagen vom 8. Oktober 1814. In: Assing-Grimmelli, Ludmilla (Hrsg.): Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Fünfter Band. Leipzig: Brockhaus, S. 80.
Sekundärliteratur
- Hahn, Barbara (1990): „Antworten Sie mir!“ Rahel Levin Varnhagens Briefwechsel. Basel / Frankfurt am Main: Stroemfeld / Roter Stern.
- Hübener, Andrea u.a. (2020): Liebesbrief / Erotischer Brief. In: Matthews-Schlinzig, Marie Isabel u.a. (Hrsg.): Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Berlin: De Gruyter, S. 506–514.
- Scurla, Herbert (1979): Rahel Varnhagen. Die große Frauengestalt der deutschen Romantik. Berlin: Verlag der Nation.
- Stauf, Renate u.a. (2008): Liebesbriefkultur als Phänomen, in: Dies. (Hrsg.): Der Liebesbrief: Schriftkultur und Medienwechsel vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Berlin: De Gruyter, S. 1–22.
- Thomann Tewarson, Heidi (1988): Rahel Levin Varnhagen mit Selbstzeugnissen und Briefdokumenten. Hamburg: Rowohlt.
Beitrag 6
Der Schlaf der Vernunft gebiert Abenteuer Eine Untersuchung des Vorwortes Anweisung für den Leser von André Breton und dessen Bedeutung für Max Ernsts Collageroman La femme 100 têtes (1929)
1. Einleitung
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer lautet der Titel der berühmten Grafik von Francisco de Goya aus seinem Zyklus Los Caprichos (ca. 1793–1799). Es scheint, als hätten die Surrealist:innen diesen Gedanken verkehrt, indem sie der Vernunft mindestens eine gewisse Skepsis entgegenbrachten und sich in besonderer Weise für die vermeintlichen Ungeheuer interessierten, die ihr Aussetzen hervorbringt. Ein Zeugnis davon liefert der Collageroman La femme 100 têtes (1929) von Max Ernst, der bereits Gegenstand vieler Untersuchungen in den Bereichen Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Psychologie, Philosophie u.A. geworden ist. So geschehen etwa in den Bänden Max Ernst. Collagen – Inventar und Widerspruch I und II des Kunsthistorikers Werner Spies (Spies 2008a, Spies 2008b) oder in dem Aufsatz Vampir und Verbrechen. Zu Max Ernsts Collagenroman ‚La femme 100 têtes‘ (1929) von Gabriele Wix (Wix 1990). Nicht nur die ungewöhnliche Form des Buches, ein Collagen-Zyklus, der von Bildlegenden begleitet ist und von Ernst als ‚Roman‘ bezeichnet wurde, erschwert eine Einordnung, auch inhaltlich gibt das Buch viele Rätsel auf. In unterschiedlichen Disziplinen wurden bereits einzelne Elemente und Symbole besprochen, Motiv-Gruppen identifiziert, die Struktur des Buches analysiert und das Verhältnis von Bildlegenden und Collagen kommentiert. Der Roman wurde unter anderem als ein ‚Bildungsroman‘ (Ch. Stokes), ein ‚visuelles Manifest des Surrealismus‘ (J. Pech) oder als ‚Bibel und Märchen zugleich‘ (G. Bauer) aufgefasst (vgl. Wix 1990: 52). Weniger oder kaum expliziter Gegenstand geworden ist hingegen das Vorwort von André Breton. Unter dem Titel Anweisung für den Leser eröffnet Breton, der zum theoretischen Sprachrohr der jungen surrealistischen Bewegung avancierte, die Lektüre des Romans und beeinflusst damit nicht nur die Rezeptionshaltung der Leser:innen, sondern auch maßgeblich die Deutung der folgenden Bilder und Texte. Die Prägung, die das Vorwort der Lektüre verleiht, seine Eigenschaften und Funktionsweisen sind Gegenstand dieser Ausarbeitung. Dafür nähere ich mich der Thematik zunächst durch einen kurzen Überblick über die surrealistische Bewegung um Breton, deren Anliegen und Techniken sowie die Adaption des Surrealismus durch Max Ernst an. Anschließend stelle ich den Inhalt und wesentliche Aspekte des Collageromans La femme 100 têtes und des Vorwortes dar. Den Kern der Arbeit, die Analyse und Interpretation des Vorwortes, führe ich anhand der Ausarbeitungen von Gérard Genette zu Typen und Funktionsweisen des Vorwortes durch, die dieser in seiner Publikation Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches (frz. 1987) darlegt. Ziel der Untersuchung ist es, die Arten der Beziehungen zwischen Ernsts Werk und Bretons Text aufzuzeigen.
2. Der Surrealismus: Gründung und Entwicklung eines Programms
Den Anfang des Surrealismus bildete eine kleine Gruppierung französischer Literaten. Die damaligen Studenten André Breton, Louis Aragon und Philippe Soupault verbanden nicht nur die Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, sondern auch, nach ihrer Rückkehr vom Feld, ihre Ablehnung des Pariser Bildungsbürgertums und der geistigen Aristokratie, darunter auch ehemalige Vorbilder der jungen Literaten, die anscheinend unberührt von den Gräueltaten ihren Gewohnheiten nachgingen oder gar in nationalistische Euphorie verfielen (vgl. Soupault 2018: 40–42). Sie lehnten den französischen Rationalismus sowie den Literaturbetrieb und dessen Konventionen ab, hegten Argwohn gegen die bürgerliche Kultur, die ihrer Ansicht nach an veralteten Traditionen und Sicherheit suggerierenden Vorurteilen festhielt, und waren anti-klerikal und anti-militärisch eingestellt (vgl. Lange 2005: 129 und Soupault 2018: 45, 58). Im Zuge der Bildung einer künstlerischen und gesellschaftlichen Vision experimentierten sie mit Schreibpraktiken und gaben gemeinsam die Zeitschrift Littérature heraus. Breton, der sich zunehmend zum theoretischen Kopf der Bewegung entwickelte, komprimierte die Annahmen und Ziele der Bewegung 1924 in einem ersten Manifest (Breton 2005, vgl. außerdem Soupault 2018:60 und Lange 2005: 129). Aus der Ablehnung des Rationalismus, der Herrschaft der Logik und des einseitigen und beschränkten Bildes des (Vernunft-)Menschen resultiert Breton zufolge im surrealistischen Programm die Hinwendung zum und die Erforschung des Unbewussten – ein Weg, den unter anderem Freud mit seiner Psychoanalyse und Traumdeutung eröffnet hat (vgl. Soupault 2018: 37, 61). Durch die Erforschung der Imagination soll eine neue Geisteshaltung erreicht werden, durch welche die „scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität“ aufgelöst werden (Breton 2005: 329, Herv. im Orig.; vgl. außerdem Soupault 2018: 37). Im „Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel des Denkens“, welche nur „ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Überlegung“ zu ihrer Entfaltung kämen, ermöglicht der Surrealismus laut Breton die „Lösung der hauptsächlichen Lebensprobleme“ (Breton 2005: 329). Breton räumt ein, dass man gerade erst am Beginn dieses Prozesses stehe und noch nicht klar sei, wie und durch wen (Künstler:innen oder Gelehrte) die Imagination erforscht werden könne.
Zu wichtigen technischen Hilfsmitteln des surrealistischen Zugangs zum Unbewussten entwickelten sich der Zufall und die Verfremdung (vgl. Möbius 2000: 177f.). Durch die Verfremdung, also das Herauslösen der Dinge aus ihrem ursprünglichen Kontext und ggf. die Herstellung neuer Verbindungen zwischen Dingen, können ihre poetischen und transzendenten Eigenschaften verstärkt zu Tage treten. In diesem Sinne operiert die von den Surrealist:innen gern zitierte „zufällige Begegnung von Nähmaschine und Regenschirm auf einem Seziertisch“ (nach Lautréamont, vgl. z.B. Ernst 1989: 25). Wenn im Umgang mit surrealistischer Kunst und Literatur von Zufall als Technik die Rede ist, müssen allerdings Einschränkungen gemacht werden, da dem ‚Zufall‘ immer ein gewisses Regelwerk zugrunde liegt (etwa die Akzeptanz der Syntax) und beispielsweise die Ablehnung des Alten und Konventionellen zwangsweise einen Filter auf die Produktion des Neuen legt (vgl. Möbius 2000: 177–181). Aufgrund ihrer Haltung und Interessen wundert es wenig, dass die Surrealist:innen ihre Inspiration vor allem auf Flohmärkten, in Schaufenstern, billigen Antiquariaten und Buchläden suchten, wo sie zufällig auf Objekte mit einem „verlorene[n], verrätselte[n] Gebrauchswert“ (Spies 2008b: 26) stoßen konnten, statt in Museen und ausgewählten Bibliotheken, den Zentren der bürgerlichen Kultur, zu verkehren (vgl. Lange 2005: 124).
3. Max Ernst: Annäherung an die Bewegung und Anwendung surrealistischer Prinzipien in der Collage
Max Ernst war einer der wenigen Bildkünstler, die sich der Gruppierung um Breton anschlossen. Im gleichen Maße wie Breton, Aragon und Soupault von den Eindrücken des Ersten Weltkriegs aufgerüttelt waren, begründete er mit Hans Arp und Johannes Theodor Baargeld den Kölner Dadaismus. Über Tristan Tzara, der mit Arp bekannt war, wurde der Kontakt mit den französischen Surrealist:innen hergestellt. Breton hat Ernst 1921 eingeladen, um ihm seine Werke in einer Pariser Galerie zu zeigen. Seine Mitstreiter waren begeistert von den eintreffenden Collagen. Der Eindruck, den Ernsts Arbeiten hinterließen, war nachhaltig prägend für die Entwicklung der Ästhetik und Praxis der Surrealist:innen (vgl. Soupault 2018: 57, Lange 2005: 129, 133 und Spies 2008a: 294, 296). Breton hält in seinem 1943 veröffentlichten Essay zur Genesis und künstlerischen Perspektiven des Surrealismus rückblickend fest:
Tatsächlich hat der Surrealismus seine unmittelbare Bestätigung in seinen [Ernsts] Collagen von 1920 gefunden, in denen sich eine völlig neue Auffassung der anschaulichen Ordnung niederschlägt, die dennoch dem entspricht, was schon Lautréamont und Rimbaud in der Dichtung gewollt haben.
(Breton 1976: 409; vgl. hierzu auch Wix 1990: 56)
Konkret faszinierte sie der in Ernsts Bildern entwickelte Umgang mit der De- und Neukontextualisierung von Objekten, also die bereits besprochene Verfremdung, die hier in visueller Form manifestiert wurde. Breton dazu weiter:
Der äußere Gegenstand hatte mit seiner Daseinsweise gebrochen, das ihm Wesentliche hatte sich gewissermaßen von ihm emanzipiert, um so mit anderen Dingen völlig neue Beziehungen eingehen zu können, wobei er zwar dem Prinzip der Wirklichkeit entfloh, was aber doch nicht ohne Folgen für dieses Wirkliche blieb; die totale Veränderung des Begriffs der Relation.
(Breton 1976: 409)
Hier wird noch einmal die Tragweite der Wirkung von Verfremdungen deutlich, die sich den Surrealist:innen durch die Collagen von Ernst offenbarte. Andersherum waren die Ideen des Surrealismus auch für Max Ernst bereichernd. Er übernahm den Anspruch eines gesellschaftlichen Bewusstseinswandels mittels der Erforschung
eines neuen, ungleich weiteren Erfahrungsgebiets, in welchem die Grenzen zwischen der sogenannten Innenwelt und der Außenwelt (nach der klassisch-philosophischen Vorstellung) sich mehr und mehr verwischen und wahrscheinlich eines Tages […] völlig verschwinden werden.
(Ernst 1989: 25)
Diese Erforschung, für die es für den Künstler keine erprobten Richtlinien gab, implizierte die Befreiung des Intellekts „aus dem trügerischen und langweiligen Paradies der fixen Erinnerungen“ und sei eine „Sache des Muts oder befreiender Verfahren“ (Ernst 1989: 25).
Ernst deutete das literarische Verfahren des automatischen Schreibens für seine Bildkunst um und sprach von einem ‚visuellen Zwang‘, der die bewusste Kontrolle aussetzen lässt, ihn gefangen nimmt und führt. Auf der anderen Seite verglich Breton das automatische Schreiben mit den Collagen Ernsts, da in beiden Fällen eine Abgabe von Kontrolle an das Material (Bilder bzw. Wörter) erfolgt, die den Zugang zum unbewussten Automatismus erleichtert (vgl. Möbius 2000: 183 und Spies 2008a: 303). Max Ernst treibt diese Überlegungen 1936 in seinem Essay Jenseits der Malerei noch weiter, indem er formuliert: „Wer Collage sagt, meint das Irrationale.“ (Ernst 1976: 333; vgl. auch Möbius 2000: 185).
Vor dem 20. Jahrhundert waren Collagen (franz. ‚coller‘: kleben, von griech. ‚kólla‘: Leim) vor allem Teil etablierter ästhetischer Alltags- und Festpraktiken (bspw. Kinderspiele, Dekoration etc.). Ab 1900 entdeckte die Avantgarde die Technik der Neu-Kombination aus bestehendem Material und Objekten für sich, entwickelte sie in verschiedene Richtungen weiter (z.B. Montage) und machte sie zu einem materialisierten Angriff auf die Ideale der akademischen und bürgerlichen Kunst, in deren Zentrum der / die Künstler:in als Schöpfer:in, die handwerkliche Befähigung und das Kunstwerk als Sinneinheit stehen. Der Begriff ‚Collage‘ wird vornehmlich für Bildkunst und Musik verwendet. Allerdings ist der Sprachgebrauch international uneinheitlich, so dass der Begriff, bezogen auf dieselbe Grundoperation, je nach Verwendungskontext verschiedene Techniken und Reflexionszustände bezeichnet (vgl. Möbius 2009: 65 und Spies 2008: 25). Max Ernst begann seine Auseinandersetzung mit der Collage 1919 in Köln. Sie wurde zur tragenden Technik seines Schaffens, wobei ein herausstechendes Merkmal war, dass seine Collagen häufig kaum als solche identifizierbar waren, da er den Herstellungsprozess kaschierte. Eine Variante der Collage, mit der Max Ernst früh experimentierte und die er ab 1929 in seinen Collageromanen verwendete, basierte auf Holzstichen des 19. Jahrhunderts, einem bis zur Verbreitung der Fotografie im ausgehenden 19. Jahrhundert bevorzugten Mittel zur Gestaltung und Illustration, welches jedoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts als sehr unmodern oder auch trivial empfunden wurde (vgl. Spies 2008a: 23f., 359, 448f.).
4. La femme 100 têtes: Entstehung und Inhalt des Collageromans
La femme 100 têtes ist der erste von drei Collageromanen, die Max Ernst veröffentlichte. Die Bezeichnung ‚Roman‘ – und damit das Gattungssignal für diesen Buchtypus – legte Max Ernst erst beim letzten seiner Collageromane und rückwirkend für die beiden vorangegangenen fest (vgl. Spies 2008a: 453). Das Buch erschien 1929 und umfasst 146 Collagen (durch die doppelte Verwendung einer Collage sind es insgesamt 147 Blätter) mit Bildlegenden. Ernst fertigte die von Anfang an als Zyklus gedachten Collagen während eines mehrwöchigen Aufenthalts im Landhaus seiner Schwiegereltern in Le Fex de Vesseaux an. Beim Ausgangsmaterial handelt es sich um Illustrationen, vorwiegend Holzstiche, die er Trivialromanen und Roman-Feuilletons, Zeitschriften und Galerieführern des späten 19. Jahrhunderts entnommen hatte. Für die Publikation wurden die Collagen fotomechanisch abgelichtet, wodurch sie rein technisch nicht mehr als Collagen erkennbar sind. Das Buch ist in neun Kapitel gegliedert und endet mit der gleichen Collage, die den Anfang bildet, doch darüber hinaus lassen sich kaum Regelmäßigkeiten oder eine narrative Struktur der Bildabfolge erkennen. Wiederkehrende Motive und Konstellationen geben zwar eine Orientierung, doch lassen sich daraus keine eindeutigen Erzählverläufe oder Sinnzusammenhänge rekonstruieren. Auch die einzelnen Collagen geben mehr Rätsel auf, als sie lösen. Werner Spies spricht diesbezüglich von einer „elementaren Unausdeutbarkeit“ (Spies 2008a: 450; vgl. außerdem ebd.: 455f. sowie Lange 2005: 138).
Die Bildlegenden, häufig nur ein kurzer Satzabschnitt, bewirken zwar teilweise eine Gruppierung der Collagen, verfolgen aber kein durchgängiges Narrativ. Sie sind vielmehr eine „Abfolge sprunghafter Verweise von Elementen einzelner Bilder“ oder stehen sogar in einer „partielle[n] Differenz“ zu ihnen (Möbius 2000: 188), wodurch sie, so befand es bereits Aragon, weniger zu einer Entschlüsselung und mehr zu einer Verrätselung der Collagen beitragen (vgl. Möbius 2000: 186). Für die Beurteilung des Verhältnisses von Bild und Text ist es wichtig zu erwähnen, dass Ernst während der Herstellung seiner Collagensuite gar nicht beabsichtigt hatte, Bildlegenden beizufügen. Erst nach seiner Rückkehr aus Le Fex de Vesseaux gab er auf Drängen von Breton den einzelnen Collagen, deren Reihenfolge zu diesem Zeitpunkt bereits festgelegt war, Unterschriften (vgl. Spies 2008a: 456). Dieser Umstand ändert zwar nichts daran, dass Text-Bild-Relationen, Assoziationen und Dissonanzen von Ernst in der endgültigen Version zusammen gedacht wurden, doch bin ich der Ansicht, dass ein Zyklus, der ausschließlich von der Bildsprache ausgeht, völlig anders konzipiert wird als eine Bild-Text-Narration. Daher sehe ich den einseitigen Ansatz einiger Autor:innen, bei der Rezeption von La femme 100 têtes von einer sich gegenseitig bedingenden Einheit von Bild und Bildlegende auszugehen, durchaus kritisch. Diese drängt sich eher bei Ernsts zweitem Collageroman auf, der von Anfang an mit Bildtexten konzipiert wurde (vgl. Spies 2008a: 457).
Die sprachliche Mehrdeutigkeit, die Max Ernst schon im Titel La femme 100 têtes anlegte (mit der französischen Aussprache des Titels kann im weitesten Sinne die ‚hundertköpfige‘, ‚kopflose‘, ‚blutsaugende‘ oder ‚starrsinnige‘ Frau gemeint sein), zieht sich durch den ganzen Collageroman und verdeutlicht sein Interesse an den sprachtheoretischen Fragestellungen seiner Zeit und deren surrealistischer Aneignung (vgl. Wix 1990: 53, 56 und Spiteri 2004: 14). Inhaltlich speisen sich die Collagen-Texte aus verschiedensten, divers kombinierten Referenzen aus Literatur, Mythen und Wissenschaft sowie Hinweisen auf antike, christliche und moderne Kultur. Wichtige Themen sind die Beziehungen und die Rollenbilder von Mann und Frau im Spannungsfeld zwischen Erotik, Liebe, Tod und Zerstörung. Als männlicher Repräsentant tritt mitunter „Loplop“ oder der „Vogelobre Hornebom“ auf – ein vogelähnliches Wesen, das Max Ernst in seinem Werk immer wieder als Alter Ego verwendete (vgl. Spies 2008b: 195–218). Wiederkehrende weibliche Figuren sind „Germinal, meine schwester, die Hundertköpfige Frau “, „Wirrwar, meine schwester, die Hundertköpfige Frau“, „die Schöne Gärtnerin“, „die Hundertköpfige“ und die „Femme 100 têtes“ (Ernst 1975, unpag., Groß- und Kleinschreibung wie im Orig.). Hinzu kommen autobiographische Bezüge sowie eine wiederkehrende Symbolik von Blindheit und Sehvermögen (Ei, Auge, verletzte und verdeckte Augen, Räder, Sphären), die in Zusammenhang mit den Theorien Freuds (Kastrationsangst und Ödipuskomplex) bzw. Anspielungen auf poetische Offenbarung gebracht werden können (vgl. Spies 2008b: 59–65, Wix 1990: 52 und Spiteri 2004: 12, 14).
5. Vorwort Anweisung für den Leser von André Breton
Die Uneindeutigkeit, die den Collageroman auszeichnet, bestimmt auch das von Breton verfasste Vorwort. Eine präzise Inhaltsangabe des Textes ist kaum möglich, da der Text sehr poetisch und mehrdeutig verfasst ist. Ich werde daher einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aspekte und Passagen geben, bei dem es mir unmöglich sein wird, nicht zu interpretieren.
Zunächst stellt Breton einen Bezug zum Ausgangsmaterial der Collagen her: Bei der Lektüre von illustrierten Volks- und Kinderbüchern werde bei den Rezipierenden etwas angesprochen, das man als Fantasie oder schlichte Imaginations- und Begeisterungsfähigkeit beschreiben könne. Mit „fortschreitende[r] erkenntnis“ (Breton 1975, unpag.) geht laut Breton dieser unbescholtene Zugang verloren, und die Bücher verlieren ihren Reiz, doch die Erinnerung an und die stark nachwirkende Prägung durch diese Lektüreerfahrungen bleiben erhalten. Es scheint, als würde sich Breton mit dem Verweis auf die illustrierten Romane generell auf den unbewussten Bereich der fantastischen Träume und Wünsche beziehen, der zwar in der Kindheit selbstverständlich angesprochen und gefördert wird, aber in der modernen und rationalen Gesellschaft der Erwachsenen keinen Platz bekommt. Dennoch lebt er laut Breton in allen Menschen als Prägung und Potenzial weiter. Fast beiläufig schreibt er, dass sich dieses Potenzial „am tage der revolution“ (Breton 1975, unpag.) – möglicherweise meint er den von den Surrealist:innen angestrebten Geisteswandel – Geltung verschaffen werde. Anschließend beschreibt er die bereits angesprochene Schwierigkeit, sich dem Unbewussten bzw. in seinen Worten: den „höchst suggestiven bewegungen beseelter oder nicht beseelter wesen“ (Breton 1975, unpag.) mit künstlerischen Mitteln anzunähern. Nach diesem hier sehr verkürzt besprochenen Abschnitt widmet sich Breton dem Collageroman, den er als „kunstvolle[s] gitterwerk“ (Breton 1975, unpag.) beschreibt, das als visuelle künstlerische Annäherung an das Unbewusste alternativlos erscheint. Dieses Gitterwerk aus Collagenelementen, die ihrem Kontext enthoben wurden, stellt Breton zufolge eine „anzahl so irreführender mutmaßungen dar, daß sie kostbar werden“, und drückt eine Erregung aus, „die um so außergewöhnlicher ist als uns ihr vorwand verborgen bleibt“ (Breton 1975, unpag.). Dann geht er auf die Beschaffenheit der Collagen ein und schreibt:
Es findet sich kein element in ihnen [den Seiten des Romans], das nicht im entscheidenden sinne zufällig wäre und das man, ohne den dehnbaren begriff der wahrscheinlichkeit zu verletzen, nicht für ganz andere absichten verwenden dürfte.
(Breton 1975, unpag.)
Damit umschreibt Breton meiner Ansicht nach nicht nur den bei der gegebenen Zusammenstellung der Elemente in den Collagen wirksamen Zufall, sondern auch den Bruch mit einer konventionellen, an einem chronologischen Erzählverlauf orientierten Rezeptionshaltung. Dies führt er in der folgenden Passage aus, in welcher deutlich wird, dass die Rezeption der Collagen und des ganzen Romans nicht entsprechend eines vorgegebenen Ablaufs erfolgt. Vielmehr erzeugt das Unbewusste jedes Individuums eine Ordnung, die es durch das Buch leitet. Breton spricht hier von einer „wunderbare[n] ordonnanz, die die seiten überspringt“ (Breton 1975, unpag., Herv. im Orig.). In diesem Zusammenhang beschreibt er den dem Unbewussten folgenden Weg zu der „jede[m] von uns eigentümliche[n] wahrheit“ als ein „patience-spiel“ (Breton 1975, unpag.), bei dem eine Intuition für das Wichtige und Unwichtige entwickelt werden könne. Auf den letzten beiden Seiten führt Breton aus, dass Max Ernst erfolgreich die Technik der Verfremdung, „die hauptfunktion aller surrealität“ (Breton 1975, unpag.), verwendet habe, um das Unbewusste ansprechen zu können. Zudem erklärt er in einigen Einschüben, worum es sich dabei seiner Meinung nach technisch handelt und wie die Überwindung moralischer Konventionen und anerkannter Naturgesetze die Türen für transzendente Eigenschaften der Dinge und andere mögliche Welten öffnet, also die Grundlagen der surrealistischen Lebens- und Weltauffassung. Max Ernst, als Autor des Collageromans, wird von ihm zuletzt als fortschrittlicher Künstler und kühner Visionär beschrieben, der die überholten malerischen (Form-)Problemstellungen und Traditionen hinter sich lässt und sich stattdessen dem surrealistischen Geisteswandel verschreibt. Der Collageroman wird laut Breton „par excellence das bilderbuch unserer zeit sein“, das die „idee des fortschritts, für einmal voll glück und ungeduld mit kinderaugen sehen zu können“, in greifbare Nähe holt (Breton 1975, unpag., Herv. im Orig.). Damit beschließt er sein Vorwort durch einen Verweis auf den Anfang des Textes.
6. Analyse und Interpretation des Vorworts und seiner Beziehung zum Collageroman anhand der Ausarbeitungen zu Vorworttypen und -funktionen von Gérard Genette
Ein Paratext ist Genette zufolge „jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als solches vor die Leser und, allgemeiner, vor die Öffentlichkeit tritt.“ (Genette 1992: 10) Empirisch bestehen Paratexte aus einer „vielgestaltigen Menge von Praktiken und Diskursen“ (ebd.), die zwischen Text und Kontext eine Zone der Transaktion schaffen und den Text einrahmen (ich verwende für das bessere Verständnis den Begriff ‚Primärtext‘). Das Vorwort ist ein spezifischer Typ des Paratextes. Dabei können Form, Ort, Zeitpunkt der Entstehung, Autor:in (Genette spricht von ‚Adressant‘) und Adressat:innen eines Vorwortes variieren. Der Bestimmung des / der Adressant:in kommt in Bezug auf den Typ und die Funktion eines Vorwortes eine besondere Bedeutung zu. Diese wird von Genette detailliert ausgeführt: Er unterscheidet zwischen Rolle und Grad, wobei der / die Adressant:in eine auktoriale Rolle (angebliche:r oder tatsächliche:r Verfasser:in des Primärtextes), eine aktoriale Rolle (etwa als Figur der Handlung) oder eine allographe Rolle (in Form einer dritten Person) einnehmen kann. Graduell zu unterscheiden ist ferner zwischen der bestätigten Autorenschaft einer realen Person (authentisch), einer angezweifelten Autorenschaft einer realen Person (apokryph) oder einer fiktiven Autorenschaft (vgl. Genette 1992: 173). Genette benennt verschiedene Funktionen, die Originalvorworte (also Vorworte, die an die Erscheinung von Primärtexten gebunden sind) und andere Typen von Vorworten (etwa nachträgliche Vorworte) erfüllen.
An diesem Punkt nehme ich eine erste Bestimmung vor: Bei der Anweisung für den Leser handelt es sich um einen Prosadiskurs, den laut Genette „häufigste[n] formale[n] (und modale[n]) Status“ eines Vorwortes (Genette 1992: 166). Es ist dem Collageroman vorangestellt und wurde zusammen mit dem Collageroman erstveröffentlicht (das Jahr 1929 wurde am Ende des Textes von Breton vermerkt und wird auch im Text erwähnt). Es handelt sich also um ein Originalvorwort. Die Adressat:innen sind, wie es der Titel schon ankündigt, schlicht die Leser:innen des Collageromans. Auch die Bestimmung des Autors / Adressanten ist eindeutig, da Breton den Text mit seinem Klarnamen unterschrieben hat. Es handelt sich bei Anweisung für den Leser demnach um ein allographes und authentisches Originalvorwort.
Der Funktionstyp dieses Vorworts entspricht laut Genette in etwa dem des auktorialen Originalvorworts und dessen Zweck, „die Lektüre zu fördern und zu lenken“ (Genette 1992: 253; vgl. außerdem ebd.: 157–189). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werde ich im Folgenden die Darstellung der hier relevanten Funktionen auktorialer und allographer Originalvorworte (vgl. Genette 1992: 192–227) und die Analyse des Textes von Breton direkt verbinden. Genette unterscheidet zwischen Aufwertungsfunktionen (‚warum zu lesen sei‘) und Informationsfunktionen (‚wie zu lesen sei‘). Die Besonderheit der allographen Originalvorworte liegt in der Perspektive der Funktionen: Die Aufwertung wird zur Empfehlung, und die Information wird zur Präsentation. Aspekte der Aufwertung, die in einem Vorwort zum Tragen kommen können, sind beispielsweise Hinweise auf die Bedeutung eines Themas (Nützlichkeit, Neuheit, Tradition) sowie auf die Einheit und Wahrhaftigkeit eines Primärtextes (vgl. Genette 1992: 193–201). Die Darstellung der Bedeutung des Werkes ist wohl eine der Hauptfunktionen, die im Vorwort von Breton deutlich wird. Einerseits hebt er Aspekte hervor, die den Collageroman als einen Fortschritt in der Kunst- und Literaturtradition auszeichnen, andererseits betont er die gesellschaftliche Dringlichkeit der Sache, also die surrealistische Revolution, in deren Dienst sich der Roman laut Breton stellt. Seine Beteuerung dessen spitzt er in der Formulierung „bilderbuch unserer zeit“ (Breton 1975, unpag.) zu. Die Betonung der Einheit eines Werkes dient laut Genette eigentlich der Aufwertung von Sammlungen von Gedichten, Novellen, Essays etc. und soll einem scheinbar chaotischen Sammelsurium einen roten Faden geben. Diese Funktion findet sich ebenfalls im Vorwort von Breton, wenn auch eher indirekt, indem er das Wesensmerkmal des Romans, den Zufall, und das der Rezeption, die „wunderbare ordonnanz“ (Breton 1975, unpag.), herausstellt und damit das Fehlen einer vorgegebenen Einheit zum vereinheitlichenden Prinzip der Collagen erklärt. Mit der Wahrhaftigkeitsbekundung bezeichnet Genette Versicherungen über die reale Entsprechung eines Textinhalts bzw. die Aufrichtigkeit des Unterfangens. Hier bietet das Vorwort Bretons eine interessante Abwandlung der Funktion, denn es lässt nicht nur keinen Zweifel an der Richtigkeit der dargestellten Wahrnehmungsweise der Gesellschaft und der Wesenszüge des Menschen, sondern reklamiert sogar eine tiefer gehende Wahrhaftigkeit für sich – eine Surrealität.
Unter die Informationsfunktionen eines Vorwortes fallen u.a. Angaben über die Entstehung eines Textes, das angesprochene Publikum, den Titel, die Reihenfolge der Lektüre und die Absicht eines Autors oder einer Autorin. Aspekte, die die Entstehung eines Textes betreffen, sind für Genette mögliche Beweggründe für die Erstellung eines Textes, die Umstände und Etappen der Niederschrift sowie mögliche Quellen eines Textes. Zu all diesen Aspekten lassen sich im Vorwort Bretons umschreibende Angaben finden. Er macht deutlich, dass La femme 100 têtes von Anfang an im Hinblick auf die inhaltliche Motivation und technische Umsetzung an dem von den Surrealist:innen entwickelten Programm ausgerichtet war und dass es eine gemeinsame Idee des Fortschritts gibt, die sich im Roman manifestiert. Die besondere charakterliche Eignung Max Ernsts für die Herstellung eines solchen Werkes, die gleichzeitig eine Erklärung für eine mögliche persönliche Motivation von Ernst beinhaltet, liefert Breton durch die Beschreibung von Ernst als Autor, der „die kraft besaß, über den abgrund zu springen“, der das „wunderbar-besessene gehirn ist, dem es auf eine kleine beunruhigung mehr oder weniger nicht ankommt“, und der weiß, dass, im übertragenden Sinne, „die arche neu gebaut werden muß“ (Breton 1975, unpag.). Max Ernst ist laut Breton also nicht nur durch seine Fähigkeiten dazu berufen, einen surrealistischen Collageroman zu schaffen, sondern hat auch selbst die Dringlichkeit dieses Unterfangens erkannt.
Über die Quellen des Collageromans gibt Breton ebenfalls andeutungsweise Auskunft, indem er die illustrierten Roman-Feuilletons anspricht. Es ist anzunehmen, dass die Art der Holzschnitte und damit die Quellen der Collagen den damaligen Leser:innen vertraut waren, so dass sie die Andeutungen Bretons verstehen konnten. Zum anvisierten Publikum gibt Breton am Anfang zwei Hinweise. Einerseits spricht er von denjenigen, die schon „alles gelesen haben“ (Breton 1975, unpag.) und so in besonderer Weise von illustrierten Romanen angerührt werden, andererseits thematisiert er das Potenzial der Seele, die in allen Menschen wohnt, womit im Grunde niemand von der Lektüre ausgeschlossen wird. Einen Kommentar zur Bedeutung des Titels, wie er in praktisch jeder Analyse zum Collageroman ausgeführt wird, sucht man im Vorwort vergeblich. Einzig der letzte Satz stellt einen – allerdings poetisch-offenen – Bezug her: „während zu ihrer und zu unserer verwunderung die schwarze spitzenmaske fällt, welche die hundert ersten gesichter der fee verdeckte“ (Breton 1975, unpag.). Bezüglich der Reihenfolge der Lektüre kann auf das weiter oben erläuterte Prinzip der fehlenden Einheit und deren rezeptionsästhetische Konsequenz, die ‚wunderbare Ordonnanz‘, verwiesen werden. In Bretons Vergleich der „jede[m] von uns eigentümliche[n] wahrheit“ mit einem „patience-spiel“ (Breton 1975, unpag.) schwingt sowohl eine Anspielung auf die Geduld (patience) als auch auf das gleichnamige Kartenspiel mit, welches in der Regel allein gespielt wird. Der Vergleich kann somit auch als Hinweis auf die selektive Wahrheitsfindung und die jeweils individuelle ‚Reihenfolge‘ für die Leser:innen gedeutet werden. Der letzte Punkt, die Absichtserklärung, also die Darstellung einer vom / von der Autor:in entwickelten Theorie, die den Schlüssel zur Interpretation des Primärtextes bildet, ist zusammen mit der Darstellung der Bedeutung das Hauptanliegen von Bretons Vorwort. Durch die mehrfache Verwendung des Pronomens ‚wir‘ und die Textstruktur, die Rezension, Visionen und theoretische Darstellung untrennbar verwebt, stellt Breton einen Konsens über die von ihm, dem theoretischen Kopf der Bewegung, dargestellte surrealistische Lesart des Buches her. Bretons Gattungsdefinition als ‚Bilderbuch unserer Zeit‘ kann als Variation einer Absichtserklärung verstanden werden, insofern sie die Sprengung von Konventionen hervorhebt. Die plurimediale Neuheit des Buches schwingt bis heute im Begriff des ‚Collageromans‘ mit (zum Begriff der Plurimedialität vgl. Wolf 2014).
Nach Genette entspricht die hier ausgeprägte Funktion der Absichtserklärung einem ‚Manifest-Vorwort‘, das sich „für eine Sache einsetzten [kann], die über die literarische Gattung hinausgeht“ (Genette 1992: 221). Dabei kann es mitunter zu einer Aneignung oder Vereinnahmung durch Dritte kommen:
Es kommt auch vor, daß sich der Vorwortverfasser […] nahezu ‚alles erlauben‘ darf, die Umstände nutzt und das angebliche Objekt seines Diskurses zugunsten einer umfassenderen oder eventuell auch ganz anderen Sache hinter sich lässt. Das Werk […] wird dann zum bloßen Vorwand für ein Manifest, eine vertrauliche Abrechnung oder eine Abschweifung.
(Genette 1992: 259)
Die Stellung Bretons in der surrealistischen Bewegung legt nahe, dass er einen solchen ‚Freifahrtschein‘ besaß, und es ist nach meiner Analyse offensichtlich, dass er das Vorwort nutzte, um seine persönlichen Ansichten darzulegen. Allerdings ist auch anzunehmen, dass Max Ernsts Anliegen grundsätzlich im Einklang mit den Ausführungen Bretons stand und dass eine gegenseitige Legitimation von literarischem Vorwort und bildkünstlerischem Collageroman in seinem Interesse war.
7. Schlusswort
Das Vorwort Anweisung für den Leser vermittelt, anders als man es durch den Titel möglicherweise erwarten mag, nicht nur Anweisungen, die die Lektüre des Collageromans lenken. Es öffnet den Blick der Leser:innen für die surrealistische Auffassung vom Menschen und der wahrnehmbaren Welt(en) und gliedert den Roman damit in einen größeren Kontext ein.
Das Vorwort hat einige weitere Funktionen, die über eine ‚Anweisung‘ hinausgehen. Die Empfehlungsfunktion zeigt sich im Vorwort besonders durch die Herausstellung der Bedeutung des Romans. Indem Breton den Zweck surrealistischer Techniken und die Dringlichkeit des Themas (surrealistische Revolution) darlegt, deren Vermittlung in den Collagen laut Breton gelingt, und indem er die künstlerische Kühnheit von Max Ernst lobt, maximiert er die Bedeutung des Collageromans. In dieser Leseempfehlung ist die Begeisterung spürbar, die Breton seit der ersten Sichtung der Collagen von Max Ernst 1921 ergriff, aber damit auch seine Überzeugung, dass Ernst die visuelle Umsetzung des literarischen Surrealismus bestätige. Darin deutet sich ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit an, nämlich dass die zweite große Funktion des Vorworts in der Absichtserklärung liegt. Durch die Erläuterung theoretischer Aspekte wird Bretons Vorstellung des Surrealismus zum Schlüssel der Interpretation von Ernsts Roman und gewinnt darüber hinaus einen Manifest-Charakter. Dass Breton sich dazu teilweise einer deutungsoffenen und poetischen Sprache bedient, dient vor allem der eigenen surrealistischen Agenda, was sich wiederum durch eine künstlerische Aufwertung auf die Rezeption des Collagenromans auswirkt.
Die Analyse hat zudem auch in eine andere Richtung Erkenntnisse hervorgebracht, nämlich bezüglich der Funktionen, die das Vorwort nicht erfüllt. Wie bereits festgestellt wurde, beinhaltet es kaum klare Anweisungen für die Rezeption, sondern vermittelt diese über Umwege und ‚zwischen den Zeilen‘ durch eine Interpretation der Leser:innen. Statt etwa die Theorien Freuds explizit anzusprechen, schreibt Breton von dem Wunsch „voll glück und ungeduld mit kinderaugen sehen zu können“ (Breton 1975, unpag.), der, betrachtet man die oft düsteren und teilweise anrüchigen Collagen, etwas fehl am Platz wirkt. Andererseits schwingt der mit der Kindheit verbundene fantastische Charakter, der in den Ausführungen zum Unbewussten bei Breton anklingt, durch die Verwendung von Holzstichen aus illustrierten (Abenteuer-)Romanen auch in den Collagen mit.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dem Vorwort als einzigem sinnhaft zusammenhängenden Text des Buches und durch seinen poetisch-beschwörenden Stil, aber auch durch seinen Autor, ein besonderes Gewicht zukommt, das zum Erfolg des Collageromans beigetragen hat und dem Surrealismus ein weiteres ‚Manifest‘ bescherte.
Primärliteratur
- Breton, André (1975): Anweisung für den Leser [1929]. In: Ernst, Max: La femme 100 têtes. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, unpag.
- Breton, André (1976): Genesis und künstlerische Perspektive des Surrealismus [1940]. In: Metken, Günter (Hrsg.): Als die Surrealisten noch Recht hatten. Texte und Dokumente. Stuttgart: Reclam, S. 403–415.
- Breton, André (2005): Manifest des Surrealismus [1924]. In: Asholt, Wolfgang; Fähnders, Walter (Hrsg.): Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909–1938). Stuttgart / Weimar: Metzler, S. 329–332.
- Ernst, Max (1976): Jenseits der Malerei [1936]. In: Metken, Günter (Hrsg.): Als die Surrealisten noch Recht hatten. Texte und Dokumente. Stuttgart: Reclam, S. 326–333.
- Ernst, Max (1989): Was ist Surrealismus? [1934]. In: Max Ernst: Gemälde. Graphik. Skulptur [Aussst.-Kat.]. Eine Ausstellung des Sprengel Museum Hannover in der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle (22.10.1989–26.11.1989) und im Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Galerie Rähnitzgasse, Dresden, in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bearb. v. Norbert Nobis und Grit Wendelberger. Hannover: Sprengel Museum, S. 25f.
- Soupault, Ré (2018): „Wir haben uns geirrt: Die wahre Welt ist nicht, was wir geglaubt haben.“ Die Entstehung des Surrealismus[1974]. In: Dies.: Vom Dadaismus zum Surrealismus. Zwei Essays. Hrsg. v. Manfred Metzner. Heidelberg: Wunderhorn, S. 37–68.
Sekundärliteratur
- Genette, Gérard (1992): Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Lange, Barbara (2005): Entschlossene Revolutionäre: Surrealismus und die Krise hegemonialer Männlichkeit in den 20er Jahren. In: Kessel, Matina (Hrsg.): Kunst, Geschlecht, Politik. Geschlechterentwürfe in der Kunst des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Frankfurt am Main.: Campus Verlag, S. 123–146.
- Möbius, Hanno (2000): Montage und Collage. Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Möbius, Hanno (2009): Collage oder Montage [Art.]. In: Van den Berg, Hubert; Fähnders, Walter (Hrsg.): Metzler Lexikon Avantgarde. Stuttgart / Weimar: Metzler, S. 65–67.
- Spies, Werner (2008a): Max Ernst. Collagen – Inventar und Widerspruch I. Berlin: Berlin University Press.
- Spies, Werner (2008b): Max Ernst. Collagen – Inventar und Widerspruch II. Berlin: Berlin University Press.
- Spiteri, Raymon (2004): Envisioning Surrealism in ‚Histoire de l‘œil‘ and ‚La femme 100 têtes‘. In: Art Journal (63), S. 4–18.
- Wix, Gabriele (1990): Vampir und Verbrechen. Zu Max Ernsts Collagenroman ‚La femme 100 têtes‘ (1929). In: Fischer, A.M. / Lohberg, Gabriele (Hrsg.): Max Ernst. Druckgraphische Werke und illustrierte Bücher. Köln: Wienand, S. 47–62.
- Wolf, Werner (2014): Intermedialität: Konzept, literaturwissenschaftliche Relevanz, Typologie, intermediale Formen. In Dörr, Volker C. / Kurwinkel, Tobias (Hrsg.): Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien. Würzburg: Könighausen und Neumann, S.11–45.
Beitrag 7
Der Garten der Hannah Höch als Teil eines künstlerischen und persönlichen Netzwerks Am Beispiel des Briefaquarells Selbst im Garten
1. Einleitung
Als revolutionäre DADA-Künstlerin gelangte Hannah Höch (1889–1978) vor allem durch ihre Collagen und Fotomontagen zu weltweiter Bekanntheit. Ihr Werk ist eng mit ihrer bewegten Biographie verflochten und tief geprägt von den politischen Umschwüngen im Europa der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Vor allem der Aufschwung des Nationalsozialismus, in dessen Zuge sie als ‚Kulturbolschewistin‘ diffamiert und damit maßgeblich an der Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeiten gehindert wurde, markierte einen tiefen Einschnitt in ihrer Biographie. Anders als viele ihrer Freund:innen und Kolleg:innen, die sich durch die nationalsozialistische Machtübernahme und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gezwungen sahen, Deutschland oder gar Europa zu verlassen, entschied sich Höch zur „inneren Emigration“ (Sturm / Bauersachs 2007: 5). Sie zog von ihrer Stadtwohnung in Berlin Friedenau nach Heiligensee auf ein Grundstück mit einem kleinen Haus und Garten. Dieser Garten, den sie bis zu ihrem Tode mit Hingabe pflegte, kann in enge Beziehung zu ihrem Leben und Werk gesetzt werden. Markant ist dabei die Verflechtung von Höchs gärtnerischer Tätigkeit mit persönlichen Erlebnissen, politischen Ereignissen und ihrem künstlerischen Wirken.
Im Folgenden soll zunächst ein historischer Überblick über Entstehung, Aufbau und Bedeutung des Gartens für das Gesamtwerk Hannah Höchs gegeben werden. Anschließend soll exemplarisch auf ein Briefaquarell Höchs an ihre Schwester eingegangen werden. Dieses legt nicht nur Zeugnis über die besondere Verbindung Höchs zu ihrem Garten ab, sondern ist auch eine erstaunliche Text-Bild-Synthese. Anhand einer Bildbeschreibung und einer auszugsweisen Besprechung der Beschriftung zeigt sich die Vielschichtigkeit der Funktionen, die der Garten für Höch erfüllte.
Die Ausführungen orientieren sich hauptsächlich an der Höch-Monographie Heinz Ohffs (1968) sowie der detaillierten Ausarbeitung zum Garten der Künstlerin von Gesine Sturm und Johannes Bauersachs (2007). Zudem dienten verschiedene Bände der archivarischen Edition Hannah Höch. Eine Lebenscollage als wichtige Quellen (Höch 1995; Höch 2001).
2. Der Garten der Hannah Höch
Nachdem ihr Werk (und ihre Person) vom nationalsozialistischen Regime als ‚entartet‘ eingestuft und sie zudem von ihren Anwohnern in Berlin Friedenau denunziert worden war, entschloss sich Höch 1939 zum Kauf des Grundstücks in Heiligensee, einem Ortsteil von Berlin Reinickendorf (vgl. Ohff 1968: 7). Auf 1172 m² schuf sich Höch zu Kriegsbeginn ihr eigenes Exil. Die Gartendenkmalpflegerin Gesine Sturm hat in der Struktur des Areals fünf konzentrische ‚Schutzhüllen‘ aus Bepflanzung, Laubengängen und Spalieren erkannt, welche sowohl symbolisch als auch faktisch als Abschirmung des Wohnhauses vom Außen funktionierten. Die Wohn- und Arbeitsstätte der Künstlerin hingegen öffnete sich dem umgebenden Garten durch einen lichten Wintergarten und viele Zimmerpflanzen (vgl. Sturm / Bauersachs 2007: 31). Die Bepflanzung des Gartens war üppig, trieb viele Blüten und folgte in ihrer Anordnung in den wenigsten Fällen taxonomischen Grundlagen. Von ihren Reisen brachte Höch regelmäßig Pflanzen mit. So schrieb sie nach einer Wanderung im deutschen Mittelgebirge im Sommer 1942 in ihren Terminkalender: „13.8. Heute im Garten das Alpinum gebaut mit all den mitgebrachten Pflanzen.“ (Höch 1995a: 670)
Doch der Garten fungierte nicht nur als Sammelsurium für allerhand Vegetation: Vor allem im Zuge des aufkommenden Nationalsozialismus brachte Höch auf dem Gelände nicht nur ihre eigenen Kunstwerke unter, um sie vor den Nazis zu verstecken, sondern bewahrte mit der Zeit auch viele ‚entartete‘ Werke von emigrierten Freunden wie beispielsweise Hans Arp, Kurt Schwitters oder Raoul Hausmann auf (vgl. Ohff 1968: 7f.). Neben Kunstwerken sicherte sie auf ihrem Grundstück auch tausende Bücher, Plakate, Manifeste, Kataloge, Tagebücher und Briefe. All diese Objekte nannte sie ihre „Schätze“ (Ohff 1968: 7). Aus Angst vor Plünderung durch die russischen Soldaten vergrub sie einige der Werke, die sie auf ihrem Grundstück verbarg, sogar im Garten (vgl. Sturm / Bauersachs 2007: 11). Das Grundstück in Heiligensee diente somit nicht nur der unter dem Hakenkreuz unerwünschten Künstlerin selbst als Exil, sondern auch den künstlerischen Erzeugnissen vieler anderer ‚Entarteter‘. Höch bewahrte damit die Werke und Schriften anderer Avantgardist:innen vor der Konfiszierung und / oder Zerstörung und schuf auf ihrem Gartengrundstück eine Art archivarischen Mikrokosmos. Ralf Burmeister, der Leiter der Künstler:innenarchive der Berlinischen Galerie, sieht in diesem Vorgang des Sammelns und Erhaltens in Bezug auf Höchs revolutionär und emanzipatorisch geprägte Biographie die Fähigkeit, „in der traumatischen Situation der äußeren Bedrohung einen Ort individueller Freiheit zu schaffen.“ (Burmeister 2001: 16)
Bei seiner Eröffnungsrede in der Kunsthalle Tübingen anlässlich der ersten Hannah Höch gewidmeten Ausstellung erkennt der Kunsthistoriker Eberhard Roters vier Grundprinzipien im Leben und Werk der Künstlerin: Distanz, Autarkie, Schnitt und Mischung. So sei der Schnitt mit der Schere das „hauptsächliche künstlerische Verfahrensprinzip Hannah Höchs“ (zit. nach Sturm / Bauersachs 2007: 25). Darüber hinaus sieht Ralf Burmeister die Collage nicht nur als dominante künstlerische Technik Höchs an, sondern auch als Lebensmaxime. Ihr Grundstück bezeichnet er als „autobiographische[] Materialcollage“, für die sie eigene Zugriffssysteme in Form von alphabetisch angeordneten „Findbücher[n]“ mit den Titeln „Was – Wo“ anlegte (Burmeister 2001: 31).
Nun eine Verbindung zu ziehen zwischen Hannah Höchs Verfahrensweisen bei der Herstellung von Bildwerken und ihrer gärtnerischen Tätigkeit, liegt nahe. Mitunter wird das Gelände in Heiligensee auch als ‚Gartencollage‘ bezeichnet. So beschreibt der Kunstkritiker Heinz Ohff Höchs Garten als „eine natürliche Collage, ein wachsendes, blühendes, im Jahreskreislauf reifendes Materialbild aus Chlorophyll und Blütenfarben, aus Blättern und Ranken.“ (Ohff 1968: 7) Gesine Sturm und Johannes Bauersachs sehen eine Parallele zwischen Höchs Papier- und ihrer Gartenschere: beides Instrumente, mit denen sie täglich das Material, sei es nun Papier oder organisch Gewachsenes, in die gewünschte Form bringt, aussortiert und „zu bändigen sucht“ (Sturm / Bauersachs 2007: 24). Geradezu ironisch erscheint es, dass die Künstlerin große Teile ihres Sehvermögens einbüßt, als sie sich bei der Gartenarbeit das rechte Auge an den Dornen einer Kletterrose verletzt (vgl. ebd.: 11). Zu bedenken bleibt, dass diese Symbiose von Künstlerin und Garten, von Frau und Natur nicht romantisiert werden sollte, entstand Höchs Gartenexil doch unter dem Zwang, sich vor den Blicken des nationalsozialistischen Regimes zu verbergen und sich selbst zu versorgen.
In einem Brief an Thomas Ring aus dem Jahr 1943 hebt Höch hervor, dass das Leben im Garten keineswegs Ausdruck einer poetischen Symbiose ihrer selbst mit der Natur sei, sondern harte Arbeit, die sie zur Selbstversorgung und als Ausgleich für ihre künstlerischen Tätigkeiten betreibe:
Ich lebe also sehr zurückgezogen in meinem Häuschen und mit dem Stück Erdboden, dass [sic] mit einem Zaun abgeschlossen ist. Dem ich viele Blumen und schöne Früchte entlocke. Das geschieht aber nicht – wie die Dichter meinen – mit herumwandeln [sic] und liebevollem Anschaun –, sondern da heisst es arbeiten. Feste arbeiten. Unzählige Kräuter, die der Mensch als Unkräuter bezeichnet [sic] müssen beseitigt werden, Dung muss präpariert, verteilt und beschafft werden. Jede Pflanze will befragt sein und versorgt. Und nun setzt ja auch schon der Ertrag ein. Erdbeeren sind da. Man erlebt mit einem Stück Boden das Jahr und damit das sich abwandelnde Stück Leben so ungeheuer intensiv.
Daneben als Ausgleich für die Gartenarbeit: malen. Tut der Rücken weh, gehts zur Staffelei. Tun die Augen weh, gehts’ [sic] wieder raus. Ich habe neben einigen ‚gedanklich belasteten‘ Bildern Blumenstücke oder Pflanzenstücke gemacht – […] mit dem Bewusstsein, dass nichts gerechtfertigter sein kann, als diesen anbetungswürdigsten Formen nachzuspüren und sie darstellerisch zu verewigen zu suchen. Schon ihr Duft gibt ihnen eine Sonderstellung. Ich möchte immer den Duft von Kraut und Unkraut, Baum und Blüte wiedergeben.
(Höch 1995b: 676)
Die Kunsthistorikerin Karoline Hille hat den in der Höch-Forschung dominanten Mythos einer Künstlerin, die eins ist mit ihrem Garten, als „Fiktion“ bezeichnet und in der „Garten-Mythologie“ ein „Netzwerk“ erkannt, das „die ganze Person Höch einspinnt wie ein armes Insekt und aus dem es kein Entrinnen gibt.“ (Hille 2001: 183) Bei der folgenden exemplarischen Betrachtung des Briefaquarells von 1953 soll auf Höchs besondere Verbindung mit ihrem Garten eingegangen werden. Es soll jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass das Gärtnerische in Höchs Werk nur einen Teil innerhalb eines komplexen Zusammenspiels aus individueller Biographie, politischen Zwängen, zwischenmenschlichen Kontakten und künstlerischem Ausdruck darstellt.
3. Blick auf das Briefaquarell von 1953
Bei Hannah Höchs Briefaquarell (Abb. 1) handelt es sich um eine in Aquarell und Tusche angefertigte Bild-Text-Synthese. Es misst 48,8 x 62,5 Zentimeter. Betitelt als Selbst im Garten schickte Höch es im Sommer 1953 an ihre Schwester Marianne Carlberg. Zentrales Element, unten in der Mitte, ist die Künstlerin selbst, sitzend zwischen zwei Staudenbeeten und umgeben von Pflanzendarstellungen und angedeuteten strukturellen Elementen des Gartens wie Rankgittern, Töpfen, Wegen und Bänken.
Signifikant für das Bild ist die skizzenhafte Ausführung des Dargestellten: Nur wenige, entschiedene Tuschestriche reichen aus, um die markanten Merkmale der Form jedes Pflanzenindividuums hervorzuheben und dieses als Teil einer Art bestimmbar zu machen. Auch die Farbigkeit bleibt in den meisten Fällen nur angedeutet, und nur einzelne Teile der Pflanzen sind komplett ausgemalt. Doch auch hier wird trotz des abstrahierenden Darstellungsverfahrens eine genaue Pflanzenkenntnis der Künstlerin evident: Das Zusammenspiel der formgebenden Tuschestriche und der partiellen Kolorierungen mit Aquarell verleiht den vegetabilen Elementen einerseits eine abstrakte Individualität, orientiert sich dabei jedoch maßgeblich an ihrem natürlichen Phänotypus und macht sie so als Vertreterinnen ihrer Art erkennbar. So beispielsweise die Lupinen mittig links über dem Kopf der Künstlerin. Die einfache Linienführung vermittelt einen Eindruck von dem für Lupinen so typischen ährigen Blütenstand. Die nur partiell aufgetragene rote Farbe lässt vermuten, dass Höch ebenjene Lupinen aus Samen gezogen hat, die ihr der Architekt Adolf Behne im Jahre 1943 zukommen lassen wollte. So heißt es in einer Postkarte Adolf Behnes vom 26. Juni 1943: „Bei den schönen Blumen hier denke ich oft an Dich, ich will versuchen, Dir etwas roten Lupinensamen zu verschaffen. – Hebst du uns ein paar Johannisbeeren auf?“ (Behne 1995: 672)
Neben der abstrahierenden und dennoch signifikanten Darstellungsweise ist es die Beschriftung, die das Bild sowohl historisch gesehen als auch visuell besonders macht. Über die Jahre hinweg führte Höch ein ‚Gartenbuch‘ mit zahlreichen Notizen zu den Eigenheiten, Pflegeansprüchen und der Saisonalität ihrer Pflanzen. Dies zeigt beispielsweise ein Eintrag in alphabetischer Reihenfolge der Anfangsbuchstaben der Pflanzenarten:
Alpenrosen nicht zu tief pflanzen; Bäume erst schneiden, wenn Laub gefallen; zur Bekämpfung der Blattlaus Spiritus mit Schellack verwenden; […] Clivia Eierschalen geben; Canna Knollen wie Dahlien überwintern; […] Rhododendren nie Kalk geben; Rochea heißt die Pflanze, die mir Heinz mal schenkte, Bild davon gemalt, hat Vivell gekauft; Tulpen für’s Zimmer; Wein im März schneiden; Walnuß nur im Dezember schneiden.
(Zit. nach Sturm / Bauersachs 2007: 28, Herv. J.K.)
Weiter oben war von den ‚Findbüchern‘ die Rede, die Höch für ihre Sammlungen an Kunst, Literatur, Material und anderen Objekten anlegte. Ein ähnliches Prinzip und Ordnungssystem schien sie auch hier zu verfolgen. Viele ihrer Einträge in das ‚Gartenbuch‘ weisen auch biographische Einschläge auf und verweisen auf ihre künstlerische Tätigkeit. Wie den in der Lebenscollage (Höch 1995) versammelten Dokumenten zu entnehmen ist, war, ähnlich wie der Austausch von Kunstwerken, der Austausch von und über Pflanzen beziehungsweise Samen integraler Bestandteil der Korrespondenz Höchs mit Freund:innen und Kolleg:innen.
So moniert beispielsweise der Architekt Jan Buijs in einem Brief von 1934, dass die ihm von Höch gesandten Samen nicht aufgekeimt seien und dass wahrscheinlich der trockene Sommer dafür verantwortlich sei: „Die Pflanzen brauchen dringend Regen!“ (Buijs 1995: 519) In einer Korrespondenz zwischen Höchs Lebensgefährtin Til Brugman und dem Ärzteehepaar Nel und Bert van der Lek aus Den Haag äußern die Letztgenannten ihre Freude darüber, dass „Hannas Saat […] sehr üppig aufgegangen“ sei und sie die entstandenen Pflanzen nun „täglich im Salat“ essen (Van der Lek 1995: 536). Auch Ideen und Skizzen zu größer angelegten Umgestaltungen des Geländes sind Teil von Höchs ‚Gartenbuch‘.
In ihrem ‚Gartenbuch‘ sammelte Höch also verschiedenste Fakten zu den Pflanzenarten, ihrem Erwerb oder ihrer Vermehrung und Düngung, notierte sich die Bestände und führte sich durch skizzenhafte Zeichnungen mit Beschriftung mögliche Änderungen am Areal vor Augen. Doch an keiner Stelle des ‚Gartenbuchs‘ beschreibt Höch den genauen Aufbau des Gartens sowie die Platzierung der einzelnen Pflanzen. Tatsächlich ist es das Briefaquarell, das als das Einzige aus Höchs Nachlass erhaltene Dokument gelten kann, welches als ‚Gartenbeschreibung‘ bezeichnet werden könnte. So abstrakt die Darstellung zunächst erscheinen mag, ermöglichen die dargestellten Beete und die Ecke des Wintergartens doch eine genaue Lokalisierung auf dem Gelände. Beim Erstellen des Bildes muss die Künstlerin mit Blick auf den Wintergarten vor dem kleinen Nebengebäude gesessen haben (vgl. Sturm / Bauersachs 2007: 14).
Selbst im Garten zeichnet sich jedoch nicht nur durch diese historische Relevanz, sondern auch durch seine mediale Gestaltung aus. Wie bereits erwähnt, diente das Blatt als Brief an Marianne Carlberg. Im Bild enthalten sind handschriftliche Bezeichnungen und kurze Ausführungen zu den dargestellten Pflanzen. So sind zum Beispiel die Pflanzen links neben der Figur der Künstlerin als Gewächse ausgezeichnet, welche einen besonderen Duft ausströmen: „Düfte: Lavendel, Thymian, Diptam, Salbei, Nelken, Pfingstrose, weiße Petunien, Wicken, Iris, Rosen, Wein.“ (Transkription in Sturm / Bauersachs 2007: 15)
Im oben erwähnten Brief an Thomas Ring von 1943 hebt Höch die „Sonderstellung“ (Höch 1995b: 676) von Pflanzen hervor, die sich stark auf den Geruchssinn auswirken. Zur bildlichen Darstellung dieses sinnlichen Phänomens boten sich Aquarellfarben an, da diese durch ihr Verlaufen auf dem Papier ebenjene olfaktorische Qualität unterstreichen. Mittig am oberen Bildrand neben dem Fenster zum Zimmer vermerkt Höch: „[…]im Zimmer wächst der Kampfer wie verrückt.“ (Transkription in Sturm / Bauersachs 2007: 15)
Durch das Bild und die entsprechende Beschriftung werden also auch die dynamische Verflechtung des Gartens mit dem Haus und damit die Einheit, die diese bilden, hervorgehoben. Die persönlichen Nachrichten an ihre Schwester hat sich Höch, entsprechend dem System, mit dem sie auch die Pflanzen beschriftet, auf den Rücken gesetzt: „Bin ziemlich krank gewesen. Schon seit März. […] Geht aber aufwärts. […] Garten ist ein Gedicht. […] Will aber verreisen. Ich verreise in meinen Garten. […] Wünsche Euch einen schönen Sommer und das allerbeste. Eure Hannah.“ (Transkription in Sturm / Bauersachs 2007: 15)
Auffällig ist dabei die stark mit den farbenfrohen, sie umgebenden Pflanzen kontrastierende gräuliche Farbgebung des Körpers der Künstlerin. Dies kann in Verbindung zur im Text des Briefs angesprochenen Krankheit gesehen werden. Ähnlich wie im ‚Gartenbuch‘ vermischen sich im Briefaquarell also Informationen zu Bestand und Aufbau des Gartens mit privaten Nachrichten. Wie weiter oben anhand von verschiedenen Korrespondenzen mit Freund:innen aufgezeigt wurde, scheint diese Verquickung von Persönlichem mit Gärtnerischem eine Konstante in Höchs Biographie zu sein, welche gut an den vorliegenden Text- und Bildformen ablesbar ist – und natürlich am Garten selbst. Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, in der Betrachtung von Höchs Leben und Werk alles nach 1939 auf die Verbindung zu ihrem Garten zu beziehen. Vielmehr ist dieser Teil eines Netzwerkes, welches sich Höch im Laufe ihres Lebens aufgebaut hat, um sich, selbst unter den schwierigsten politischen und persönlichen Umständen, noch die größtmögliche Autarkie zu verschaffen.
4. Fazit
Um sich der vielschichtigen Bedeutung des Gärtnerischen für Hannah Höchs Leben und Werk anzunähern, wurde zunächst auf Aufbau und Nutzung des Gartengrundstücks eingegangen. Dieses hatte Funktionen als Exil, Nahrungsquelle und Ort der Entspannung, aber auch Funktionen der Arbeit und Funktionen als Archiv. Die fast 40 Jahre, die Höch auf diesem Grundstück mit täglicher, stundenlanger Gartenarbeit verbrachte, machen das Gelände zu einem „einzigartigen Zeugnis“ (Sturm / Bauersachs 2007: 5) der Kunst- und Kulturgeschichte Berlins; ihre dortige Sammlung von Kunst und Zeitdokumenten machen das Gelände zugleich zum „größten DADA-Fundus überhaupt“ (Sturm / Bauersachs 2007: 6). Dieser Fundus beinhaltet sowohl Werke von Höch selbst als auch Erzeugnisse ihrer Freund:innen und Kolleg:innen sowie nicht zuletzt eine große Vielfalt an Pflanzen, denen neben ästhetischen und olfaktorischen Qualitäten auch eine intime Bedeutung zukam, da sie in vielen Fällen aus Höchs persönlichem Umfeld stammten oder sie von den Reisen der Künstlerin mitgebracht worden waren. Der Blick auf das Briefaquarell von 1953 verdeutlicht exemplarisch, dass der Garten eben nicht allein als ästhetischer Teil von Höchs Werk gelesen werden kann, sondern vielschichtige Funktionen erfüllt, welche weit über die häufig angenommene und durchaus geschlechtlich konnotierte Symbiose einer Frau und Künstlerin mit ihrem Naturparadies hinausgehen. Im Kontext des Bildes beziehungsweise des Briefes dient der Garten als Medium zur Übermittlung einer persönlichen Botschaft an ihre Schwester. Dabei ist sie nicht ‚eins‘ mit dem Garten, sondern er stellt als selbstgewähltes und zu großen Teilen selbst geschaffenes Exil die Umgebung für die momentane Verfassung der Künstlerin dar.
Zum Schluss seines Beitrages zu Hannah Höchs System der Erinnerung merkt Ralf Burmeister treffend an, dass es nicht möglich sei, Höchs „subjektive Lebenscollage zu rekonstruieren“ (Burmeister 2001: 32), sondern dass bei der Erschließung ihres Lebens und ihres Werkes jedes Detail zu beachten sei, damit sich neue Wege des Denkens über das Lebenswerk Höchs ergeben könnten. Obwohl es kaum möglich ist, Höchs subjektives Verhältnis zu ihrem Garten zu rekonstruieren, lohnt sich der Blick auf die Elemente ihres persönlichen Lebens (z.B. in Form von Archivakten) und ihres künstlerischen Gesamtwerks, die mit dem Garten verknüpft sind. Einerseits, um den Mythos einer romantisierenden Frau-Natur-Symbiose aufzubrechen, und andererseits, um ihr Werk in seiner Vollständigkeit und materiellen Diversität erfassen zu können.

Abbildung 1: Hannah Höch: Selbst im Garten (1953), Briefaquarell an die Schwester Marianne, 48,8 x 62,5 cm, Aquarell / Tusche.
- Abb. 1: Hannah Höch: Selbst im Garten (1953), Briefaquarell an die Schwester Marianne, 48,8 x 62,5 cm, Aquarell / Tusche; Quelle: © privat; Bildzitat nach dem Abdruck in: Sturm, Gesine / Bauersachs, Johannes: Ich verreise in meinen Garten. Der Garten der Hannah Höch. Berlin 2007, S. 15.
Primärliteratur
- Behne, Adolf (1995): Postkarte an Hannah Höch [Alpbach, 26.6.1943]. In: Höch, Hannah: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. II. 1921–1945. 2. Abt. Dokumente. Bearb. v. Ralf Burmeister und Eckhard Fürlus. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 1995, S. 672.
- Buijs, Jan (1995): Brief an Hannah Höch [Den Haag, 9.7.1934]. In: Höch, Hannah: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. II. 1921–1945. 2. Abt. Dokumente. Bearb. v. Ralf Burmeister und Eckhard Fürlus. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 1995, S. 518f.
- Höch, Hannah (1995): Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. II. 1921–1945. 2. Abt. Dokumente. Bearb. v. Ralf Burmeister und Eckhard Fürlus. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 1995.
- Höch, Hannah (1995a): Terminkalender [„Merkbuch 1942“]. In: Dies: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. II. 1921–1945. 2. Abt. Dokumente. Bearb. v. Ralf Burmeister und Eckhard Fürlus. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 1995, S. 669–671.
- Höch, Hannah (1995b): Brief an Thomas Ring [Berlin, Sommer 1943 / Nachtr.: 9.4.1944]. In: Dies: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. II. 1921–1945. 2. Abt. Dokumente. Bearb. v. Ralf Burmeister und Eckhard Fürlus. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 1995, S. 676f.
- Höch, Hannah (2001): Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. III. 1946–1978. 1. Abt. Mit Texten von Ralf Burmeister, Eckhard Fürlus, Karoline Hille, Maria Makela und Eva Zürchner. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 2001.
- Van der Lek, Nel und Bert (1995): Brief an Til Brugmann [o.O., 12.7.1934]. In: Höch, Hannah: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. II. 1921–1945. 2. Abt. Dokumente. Bearb. v. Ralf Burmeister und Eckhard Fürlus. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 1995, S. 536f.
Sekundärliteratur
- Burmeister, Ralf (2001): Hannah Höchs System der Erinnerung. In: Höch, Hannah: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. III. 1946–1978. 1. Abt. Mit Texten von Ralf Burmeister, Eckhard Fürlus, Karoline Hille, Maria Makela und Eva Zürchner. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 2001, S. 12–35.
- Hille, Karoline (2001): Ein Kaleidoskop der unbegrenzten Möglichkeiten. Zu Hannah Höchs Photomontagen nach 1945. In: Höch, Hannah: Eine Lebenscollage. Archiv-Edition. Bd. III. 1946–1978. 1. Abt. Mit Texten von Ralf Burmeister, Eckhard Fürlus, Karoline Hille, Maria Makela und Eva Zürchner. Hrsg. v. Künstlerarchiv der Berlinischen Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Berlin 2001, S. 154–199.
- Ohff, Heinz (1968): Hannah Höch. Berlin 1968.
- Sturm, Gesine / Bauersachs, Johannes (2007): Ich verreise in meinen Garten. Der Garten der Hannah Höch. Berlin 2007.
Beitrag 8
Textdynamiken in der Sprachwissenschaft Im Spannungsfeld von digitaler Kommunikation und Semiotik
Der Lehr- und Lernaustausch stellt einen wichtigen Bestandteil der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen Krakau und Leipzig dar. Im Bereich der Sprachwissenschaft wurden zwei regulär im Curriculum verankerte Seminare am jeweiligen Standort um gemeinsame Werkstätten ergänzt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Zofia Berdychowska, Dr. Robert Mroczynski und Prof. em. Dr. Frank Liedtke kamen im Mai 2021 Studierende und Lehrende aus Krakau und Leipzig in zwei digitalen Blocksitzungen online zusammen.
Im Fokus des sprachwissenschaftlichen Team-Teachings standen Textdynamiken von Kurztexten mit Schwerpunkt auf digitaler Onlinekommunikation sowie Sprache und Zeichen im öffentlichen Raum.
Die erste Werkstatt, geleitet von Prof. Dr. Zofia Berdychowska und Dr. Robert Mroczynski und Prof. em. Dr. Frank Liedtke, wurde am 7. Mai eröffnet.
Prof. Dr. Zofia Berdychowska stellte vielfältige Formen von Kurztexten im öffentlichen Raum vor und zeigte auf, wie sie sprachwissenschaftlich interpretiert werden können. Prof. Dr. Frank Liedtke widmete sich dem Begriff der Verschwörungstheorie und den analytischen Grenzen und Möglichkeiten. Dr. Robert Mroczynski stellte sowohl (diskurs-)pragmatische als auch gesprächslinguistische Methoden und Analysemöglichkeiten von gesprochener und digitaler Kommunikation vor mit Fokus auf dem aktuellen Thema „Covid-19 Pandemie“.
In der zweiten Werkstatt, geleitet von Prof. Dr. Zofia Berdychowska und Dr. Robert Mroczynski, haben am 25. Juni die Seminarteilnehmer die Gelegenheit bekommen ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Dabei konnten drei daraus hervorgegangene Beiträge im Rahmen des hier vorliegenden Journals veröffentlicht werden. Sie werden als nächstes in aller Kürze vorgestellt:
Der erste Beitrag von Karolina Wólczyńska (Krakau), Aileen Herbst (Leipzig), Gina Michelle Kanold (Leipzig) und Anika Scherf (Leipzig) beschäftigt sich mit semantischen Verschiebungen bestimmter Komposita im Zuge der SARS-CoV-2 Pandemie. Hier wurde die Textdynamik am Beispiel von Instagram-Beiträgen veranschaulicht.
Im zweiten Beitrag behandeln Klaudia Warzecha (Krakau), Bruno Trautzer (Leipzig), Cansu Gözütok (Leipzig) und Emma Luise Domin (Leipzig) textdynamische Veränderungen von Leserkommentaren zweier Onlinezeitungen zum Thema „Schutzmaßnahmen“ während der Covid-19 Pandemie. Im Fokus steht die Frage, wie die Emotionalität der Leser der Schlagzeilen zum Thema „Schutzmaßnahmen während der Covid-19 Pandemie“ in ihren Onlinebeiträgen sichtbar wird und wie sie sich im Laufe der Pandemie verändert.
Im dritten und letzten Beitrag haben Zuzanna Garczarek (Krakau), Lätizia Drescher (Leipzig), Gina Hendrischke (Leipzig) und Sarah Weinhold (Leipzig) den Wandel der Impfbereitschaft von Deutschen anhand von Foreneinträgen zu zwei Artikeln auf Zeit Online analysiert.
Beitrag 9
Semantische Verschiebungen ausgewählter Komposita im Zuge der SARS-CoV-2 Pandemie und Textdynamik Am Beispiel eines Instagram-Beitrages
1. Einleitung
Covid-19 hat unseren Alltag und unsere Gesellschaft stark verändert. Im Zuge der Pandemie werden jedoch auch sprachliche Veränderungen erkennbar: Es werden neue Wörter gebildet, aus anderen Sprachen entlehnt oder bekannte Wörter erhalten neue Bedeutungen (vgl. Menden 2020). Dies zeigt, dass Sprache uns Menschen zur Kommunikation und zum Informationsaustausch dient: Wandelt sich unsere Umwelt, muss der Wortschatz und -gebrauch angepasst werden, damit man sich darüber austauschen kann.
Besonders in den sozialen Medien spiegelt sich dieses Phänomen wider, da hier Menschen aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und mit individuellen Sprachgewohnheiten aufeinandertreffen. Dadurch entsteht eine breite Plattform, welche eine große Varietät an Meinungen und sprachlichen Mitteln, aber auch die Möglichkeit zur Anonymität bietet. Viele Menschen informieren sich und kommunizieren über Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter. Mit ihrer Allgegenwärtigkeit beeinflussen die sozialen Medien entscheidend u.a. die Prozesse der Wortbildung.
In dieser Arbeit möchten wir uns den semantischen Verschiebungen einiger ausgewählter Komposita in einem Instagram-Beitrag der „Tagesschau“ zum Thema Lockerungen für Geimpfte und Genesene vom 06.05.2021 [14][^ [14] Lockerungen für Geimpfte und Genesene. https://www.instagram.com/p/COh7mw2qN5O/ (Stand: 20.06.2021).] widmen. Wir haben uns für Instagram entschieden, da man dort die wichtigsten Nachrichten in einer prägnanten Form verfassen kann und fast jeder darauf Zugriff hat. Gerne werden nicht nur die dort erscheinenden Beiträge kommentiert, sondern es wird auch auf bereits vorhandene Kommentare reagiert. Dadurch ergibt sich ein von Alltagssprache geprägtes Sprachbild.
Zentral für diese Arbeit ist das Ziel, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, inwiefern bestimmte Komposita im Zuge gesellschaftlicher, durch die Covid-19-Pandemie verursachter Veränderungen neue Bedeutungen erlangen und welche neuen Assoziationen sich im Verlauf der Pandemie zeigen.
Als Erstes wird der Begriff Komposita und seine Bedeutung für die Sprache thematisiert. Daraufhin wird der Sprachwandel beschrieben, der theoretische Einblicke in das Phänomen der Bedeutungsänderungen gibt. Nachfolgend wird der Bedeutungswandel von vier Komposita – Ausgangssperre, Impfpflicht, Impfangebot und Zweiklassengesellschaft – analysiert, der sich durch die gesellschaftlichen Veränderungen infolge der Covid-19-Pandemie vollzogen hat. In welchem sprachlichen Kontext sie im betrachteten Beitrag stehen und was mit ihnen heutzutage assoziiert wird, schließt diesen Teil ab. Abschließend betrachten wir in den Kommentaren der Leser:innen zu dem Beitrag und in den Reaktionen darauf exemplarisch den Bedeutungswandel eines der Komposita und andere sprachliche und nicht sprachliche Ausdrucksmittel als Phänomene der Textdynamik.
2. Begriffsklärungen und zugrundeliegende Theorien
In diesem Kapitel werden die für unsere Arbeit relevanten Begriffe geklärt. Als erstes betrachten wir die Komposita und welche Bedeutung ihnen in der Sprache zukommt. Anschließend werden die Begriffe Bedeutung, Sprachwandel und Bedeutungswandel thematisiert, die samt den theoretischen Grundlagen Einblicke in die in unserer Arbeit zentralen semantischen Verschiebungen ausgewählter Komposita geben.
2.1 Komposita und ihre Bedeutung in der Sprache
Wenn sich unsere Gesellschaft verändert, entstehen neue Sachverhalte, Dinge usw. Um darüber kommunizieren zu können, bedarf es der Benennung dieser und dementsprechend der Bildung neuer Wörter. Mit diesen Prozessen, deren Regeln und deren Analysen, setzt sich die Wortbildung, neben der Flexion einer der Bereiche der Morphologie, auseinander (vgl. Elsen 2011: 7). Während sich die Flexion mit der grammatischen Anpassung von Wörtern in ihren Kontexten befasst, setzt sich die Wortbildung, wie oben bereits erwähnt, „mit der Bildung neuer Lemmata” (Lüdeling 2012: 79) auseinander. Es werden unter anderem die Wortbildungsarten Derivation, Konversion, Komposition und Kurzwort unterschieden (vgl. Hentschel 2020: 23–27).
Die Bausteine komplexer Wörter und den Gegenstand der Morphologie bilden Morpheme (vgl. Lüdeling 2012: 79–82), die als „kleinste bedeutungstragende Einheit” (ebd.: 82) definiert werden. Einerseits können Morpheme nach ihrer Funktion in lexikalische (Basismorphem) und grammatische Morpheme (Affix) eingeteilt werden (vgl. Hentschel 2020: 18–22). Basismorpheme bezeichnen etwas in der realen Welt, Affixe hingegen realisieren grammatische Regeln einer Sprache (vgl. ebd.). Andererseits können sie aber auch in ihrer Gebundenheit unterschieden werden, einige sind frei, sprich deren Morph / e kann / können allein stehen, was bei der anderen Art, den gebundenen Morphemen, nicht der Fall ist (vgl. Lüdeling 2012: 84).
Entsprechend dem Artikelthema befasst sich diese Arbeit zentral mit Komposita als Produkten der Komposition. Bei der Komposition werden zwei Basismorpheme zusammengefügt (vgl. Donalies 2014: 171). Diese Zusammensetzung der Morpheme unterliegt verschiedenen Prinzipien: Komposita besitzen in der Regel eine binäre Struktur, das heißt, sie setzen sich aus zwei Konstituenten zusammen (vgl. Wellmann 2017: 9). So kann das Wort Hauptbahnhof in die zwei Konstituenten haupt und bahnhof zerlegt werden, wobei das zweite wiederum eine binäre Struktur, gegliedert in bahn und hof, besitzt. Nach dem Letztgliedprinzip (vgl. Hentschel 2020: 28) bestimmt der am weitesten rechts stehende Bestandteil eines Kompositums, der morphologische Kopf, dessen grammatische Eigenschaften, wie Wortart und Genus (vgl. Lüdeling 2012: 86). In Komposita, die aus zwei Basismorphemen bestehen, wird die erste Komponente akzentuiert (vgl. Duden 2016: 50). Dies geschieht auf der Silbe, die betont wird, wenn das Morphem ungebunden / selbstständig vorkommt (vgl. ebd.). Kompositionen mit drei und mehr Konstituenten werden jedoch nach verschiedenen Prinzipien akzentuiert (vgl. ebd.). Betrachtet man beispielsweise das Kompositum Handtuch, übernimmt dieses von der rechts stehenden Konstituente tuch dessen Wortart Nomen und Genus Neutrum und die Betonung liegt auf dem ersten Glied hand. Eine weitere Besonderheit der Komposition, die Rekursivität, bezieht sich auf die Nominalkomposita (Morphem-Wortart Nomen) (vgl. Lüdeling 2012: 87). Diese besagt, dass theoretisch beliebig viele Basismorpheme zu einem Kompositum aneinandergereiht werden können. Diese Morpheme dürfen jedoch alle bloß nominal sein; wird ein zum Beispiel adjektivisches Basismorphem dem Kompositum zugefügt, bricht die Kette sozusagen ab bzw. das Kompositum kann nicht weiter verlängert werden (vgl. ebd.). Des Weiteren können Komposita Fugenelemente beinhalten, die als formale grammatische Einheit zwischen den lexikalischen Komponenten, die ein Kompositum bilden, gelten (vgl. Wellmann 2017: 56). Dabei markiert das Fugenelement die Grenze zwischen den zusammengesetzten Worten (vgl. ebd.: 51) und verstärkt darüber hinaus die Verschmelzung beider Konstituenten zu einem Wort (vgl. Coulmas 1988: 325). Jedoch enthalten die meisten Komposita kein Fugenelement (vgl. Lüdeling 2012: 87).
Komposita werden unter anderem nach der Art der zusammengesetzten Wortarten eingeteilt (vgl. Lüdeling 2012: 84f.). Sie können aber auch nach ihrer Bedeutungszusammensetzung bzw. -relation unterschieden werden in Determinativkomposita, Kopulativkomposita und Possessivkomposita (vgl. Hentschel 2020: 39–44).[^1 Auch andere Differenzierungen sind in wissenschaftlichen Quellen auffindbar. Vgl. auch die Diskussion in Hentschel (2020: 39–44).] Bei Determinativkomposita bestimmt das untergeordnete erste Glied („das Bestimmende“ – Determinans) das übergeordnete zweite („das Bestimmte“ – Determinatum / „das zu Bestimmende“, Determinandum) näher (vgl. ebd.: 39). Weitaus seltener sind im Deutschen sog. Kopulativkomposita, bei denen beide Komponenten des Kompositums gleichwertig sind und sich gegenseitig bestimmen (vgl. Hentschel 2020: 39–40). Die dritte, noch seltenere Art der Komposita, die Possessivkomposita, auch Bahuvrihi oder exozentrische Komposita genannt, deren Bedeutung außerhalb des Bereichs des Grundwortes liegt, bestehen zumeist aus einem Adjektiv oder Numerale und einem Nomen (vgl. ebd.: 44). Obwohl so ein exozentrisches Kompositum das gleiche Determinativverhältnis zwischen seinen Konstituenten wie ein Determinativkompositum aufweist (vgl. Olsen 2013), muss nach Hentschel (2020: 44) die Bedeutung der Possessivkomposita anders als bei endozentrischen, selbsterklärenden Komposita eigenständig von außerhalb hinzugedacht werden, da nur ein Teil genannt und damit dessen Ganzes beschrieben wird oder der Begriff mit dem benannten Objekt nur eine geringe semantische Überschneidung aufweist. Somit kann ein Possessivdeterminativ im Grunde als lexikalisierte Metonymie oder Metapher angesehen werden (vgl. ebd.).
2.2 Zum Begriff des Bedeutungswandels
Es ist schwierig, die Bedeutung des Wortes Bedeutung klar und eindeutig zu definieren (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 3). Die Definition hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. vom Kontext, Diskurs, Alltagssprachgebrauch. Besonderes Augenmerk wird bei der Definition eines Wortes auf einen weiteren sinnbestimmenden Aspekt gelegt, nämlich auf seinen Anwendungsbereich (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 3; Schaff 1961: 713; Roelcke 2018: 184). Dies kann an einem Beispiel verdeutlicht werden: Die Synonyme bekommen und erhalten haben nicht den gleichen Anwendungsbereich und die gleiche Kollokabilität. Beispielsweise wird ein Baby erhalten nicht verwendet, sondern ein Baby bekommen. Ein anderes Beispiel sind Ausdrücke in verschiedenen Sprachen, die auf den ersten Blick dieselbe Bedeutung haben, sich aber durch den situativen Anwendungsbereich unterscheiden, wie span. adios oder poln. cześć und tschüss. Während adios und cześć auch als Begrüßung ausgesprochen werden können, ist dies bei tschüss nicht der Fall (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 4; [17]).
Keller und Kirschbaum (2003: 4–6) unterscheiden zwei Bedeutungsauffassungen. Entweder und in der Praxis am gebräuchlichsten kann man sich darauf konzentrieren, was ein bestimmter Ausdruck repräsentiert, z. B. Dinge, eine Menge von Dingen, Vorstellungen, Begriffe, Konzepte (repräsentatorische Bedeutungsauffassung). Oder die Bedeutung eines Ausdrucks ist das, wie es verwendet wird – in welchen Situationen und zu welchem Zweck (instrumentalische Bedeutungsauffassung). Um festzustellen, ob die Ausdrücke gleichbedeutend sind, werden ihre Gebrauchsweisen verglichen. Demnach ist „die Bedeutung eines Wortes […] die Regel seines Gebrauchs in der Sprache” (Keller / Kirschbaum 2003: 7).
Alle verwendeten Sprachen der Welt ändern sich schneller oder langsamer im Laufe der Zeit (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 7, 126; Duda 2014: 14; Siehr / Berner 2009: 16). Der Wandel betrifft alle sprachlichen Aspekte (Semantik, Grammatik, Phonetik, Morphologie usw.), nicht aber biologisch bedingte Änderungen (z. B. in Bezug auf Genetik und Evolution) (vgl. ebd.; Keller 2004: 4; Siehr / Berner 2009: 17). Sprecher einer bestimmten Sprache können den Verlauf und das Tempo dieser Veränderungen willentlich nicht beeinflussen (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 8; Siehr / Berner 2009: 17). Sie beteiligen sich am Sprachwandel aber maßgeblich (vgl. ebd.; Efing 2021: 99; Kaehlbrandt 2018: 31), indem sie jeweils sprachliche Mittel wählen, u. U. auch fehlerhaft gebrauchen, mit welchen sie ihre alltäglichen kommunikativen Ziele möglichst optimal erreichen können (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 9, 13; Schneider 2005: 5). Gleichgerichtete Wahlen kumulieren sich und ergeben mit der Zeit den Sprachwandel. „Systematische Fehler von heute sind die neuen Regeln von morgen” (Keller / Kirschbaum 2003: 9). Allerdings ist nicht jede okkasionelle Regelverletzung ein Element des Sprachwandels, die Voraussetzung dafür ist eine weit verbreitete Nutzung durch die Gesellschaft (vgl. ebd.: 9–10).
Bedeutungswandel weist auf den dynamischen Charakter der Sprache hin (vgl. Wolff 1986: 28; Mazurkiewicz-Sokołowska 2017: 130). Er kann, wie der Sprachwandel, durch die Maxime der Energieersparnis (auch Sprachökonomie) erzeugt werden (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 11; Kaehlbrandt 2018: 25–26). Die Veränderungen beziehen sich auf historische, kulturelle oder gesellschaftliche Erscheinungen (vgl. Nübling 2006: 3; Kaehlbrandt 2018: 25). Lewandowski dehnt die Definition des Bedeutungswandels aus und betrachtet ihn als „die geordnete Vielfalt der ständig verlaufenden Prozesse der Umgestaltung, des Verlustes und der Neubildung sprachlicher Elemente” (Lewandowski 1985: 1027).
Es werden vier Prozesse des Bedeutungswandels unterschieden: Differenzierung, metaphorischer Wandel, metonymischer Wandel und Einzelphänomene (vgl. Keller / Kirschbaum 2003: 15–98). Zu den Folgen zählen folgende Phänomene: Polysemie, Homonymie und Wegfall einer Bedeutungsvariante (vgl. ebd.: 101–120).
3. Bedeutungswandel ausgewählter Komposita der Corona-Wirklichkeit
Im diesem Kapitel setzen wir uns mit einigen Komposita, ihren alten, vor Corona, und neuen Bedeutungen auseinander. Dabei wird besonders auf historische und gesellschaftliche Bezüge geachtet, die in der Sprachwandeltheorie die sprachlichen Veränderungen auslösen (vgl. Nübling 2006: 3; Kaehlbrandt 2018: 25). Zudem wird analysiert und werden Annahmen gemacht, um welche Art des Bedeutungswandels es sich jeweils handelt.
3.1 Ausgangssperre
Ausgangssperre bedeutet im Allgemeinen das „Verbot auszugehen, das Haus, die Wohnung [oder] die Kaserne zu verlassen” [2].[^ [2] Ausgangssperre https://www.duden.de/rechtschreibung/Ausgangssperre (Stand: 11.06.2021).] Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache bestimmt den Begriff etwas genauer als „von einer Verwaltungsbehörde, der Regierung oder dem Militär erlassenes Verbot für die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung, das Haus [...] zu verlassen” [3].[^ [3] Ausgangssperre https://www.dwds.de/themenglossar/Corona (Stand: 11.06.2021).] Ausgangssperre ist ein Determinativkompositum: Sperre wird hier durch Ausgang determiniert bzw. genauer bestimmt, also um was für eine Art Sperre es sich handelt.
Das Kompositum Ausgangssperre war schon vor der Covid-19-Pandemie bekannt. Die Generation, die in der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und in okkupierten Ländern lebte, erlebte solche Maßnahmen schon einmal, darunter besonders Menschen jüdischer Abstammung. So wurde nach Beginn des Krieges im Jahr 1939 eine nächtliche Ausgangssperre für jüdische Menschen eingeführt, welche ab 22 Uhr galt (vgl. McCourt / Schmieder 2021).
Ausgangssperren stellen ein effektives Mittel dar, die Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen. Deshalb sind Sperren dieser Art eher in autoritären Regimen und Diktaturen vertreten und werden in demokratischen Ländern meist nicht in Betracht gezogen (vgl. Boehme-Neßler 2021: 1).
So fern der Begriff vielen, nicht nur in Deutschland lebenden Menschen war, desto präsenter ist er nun zur Zeit der Corona-Pandemie geworden. Die Bedeutung des Wortes Ausgangssperre und der Kontext, in dem es auftritt, veränderten sich aber: Immer noch bezeichnet das Kompositum das Verbot, das Haus ab einer bestimmten Uhrzeit zu verlassen. Die Bevölkerung verbindet mit dem Wort die nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr. Nur wer einen triftigen Grund, wie die Versorgung von Tieren oder Notfälle, vorweisen kann oder beruflich von der Sperre befreit ist, kann sich zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens außerhalb des Wohnbereiches aufhalten. Das Kompositum Ausgangsbeschränkung ist mit dem der Ausgangssperre leicht zu verwechseln. Bei diesem ist es jedoch möglich, sich frei in der Öffentlichkeit zu bewegen, jedoch nur unter Beschränkungen, wie Maskenpflicht oder Personenanzahl [6].[^ [6] Corona-Notbremse und Ausgangssperre: Diese Regeln gelten jetzt https://www.adac.de/news/lockdown-ausgangssperre (Stand: 22.06.2021).]
Aus den Ausführungen ist zu schließen, dass es sich bei Ausgangssperre um die Bedeutungswandel-Art Differenzierung handelt: Die Bedeutung wird in Bezug auf die Covid-19-Pandemie differenziert bzw. verengt (im Sinne einer Hyponymie) und erhält im Gegenzug als zusätzliche Bedeutungszuschreibung, dass die Ausgangssperre während der Pandemie auf den Zeitraum zwischen 22 und 5 Uhr festgelegt ist und Ausnahmen durch Notfälle und den Beruf bestehen (vgl. Ausführungen Differenzierung Keller / Kirschmann 2003: 15–34).
3.2 Impfangebot
Die Bedeutung des Wortes Impfangebot ist schwierig zu definieren, weil wir den Begriff nicht in Wörterbüchern wie dem Duden finden. Jedoch kann man zu der Bedeutung gelangen, wenn wir die Morpheme betrachten, aus denen das Wort zusammengesetzt ist – nämlich impf und angebot. Das erste Morphem ist das Basismorphem des Verbs impfen, welches bedeutet „jemandem einen Impfstoff verabreichen, einspritzen oder in die Haut einritzen“ [11].[^ [11] Impfen https://www.duden.de/rechtschreibung/impfen (Stand: 21.06.2021).] Beim zweiten Bestandteil handelt es sich um das Substantiv Angebot, ein komplexes Wort entstanden im Zuge anderer Wortbildungsprozesse, das meint “etwas, was jemandem angeboten, vorgeschlagen wird“ [1].[^ [1] Angebot https://www.duden.de/rechtschreibung/Angebot (Stand: 21.06.2021).] Aufgrund dieser Analyse der Konstituenten des Kompositums und unter der Annahme, es handelt sich um ein Determinativkompositum, lässt sich vermuten, dass dieses nur die Möglichkeit, demnach keinen Zwang, sich impfen zu lassen, bedeutet.
Vor der Covid-19-Pandemie bezog sich das Wort auf die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Impfstoffe gegen verschiedene Erkrankungen, die sich Bürger:innen größtenteils frei verfügbar von medizinischem Personal verabreichen lassen können.[^2 In Deutschland werden Impfempfehlungen von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut ausgesprochen [9] Empfehlungen der Ständigen Impfkommission https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html (Stand: 21.06.2021).] Eine Impfung wird in Deutschland empfohlen, es besteht aber keine Impfpflicht [8].[^ [8] Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988 (Stand: 21.06.2021).] Daraus lässt sich schließen, dass ein umfangreiches Angebot an Impfungen gegen etliche verschiedene Krankheiten frei zur Verfügung steht und jede Person selbst entscheiden kann, ob sie sich impfen lassen möchte oder nicht.
Während der Pandemie erhielt dieses Wort jedoch eine andere Bedeutung. Heutzutage ist die Impfung nicht nur Schutzmittel gegen die Ansteckung mit SARS-CoV-2, sondern oft eine Erleichterung für Menschen, die von einem Land in ein anderes reisen möchten. Auch andere Erleichterungen / Privilegien sind zu erwarten. Die Verpflichtung zur Untersuchung und Quarantäne bei der Rückkehr aus Risikogebieten und Gebieten mit hoher Inzidenz gilt nicht für Personen, die genesen oder vollständig geimpft sind [5].[^ [5] Corona-Impfung: Diese Länder erleichtern Urlaubern die Einreise https://www.adac.de/news/corona-impfung-reise-urlaub/ (Stand: 23.06.2021).] Der Nachweis der Impfung oder des Überstehens der Infektion muss jedoch dem Einreiseportal der Bundesrepublik Deutschland gemeldet werden [5]. Für vollständig Geimpfte und genesene Personen entfällt auch die Pflicht, sich vor der Rückkehr mit dem Flugzeug aus dem Ausland auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Beim Check-in muss lediglich ein Impf- oder Rekonvaleszenznachweis vorgelegt werden [5]. Die Lockerung der Beschränkungen richtet sich eigentlich nur an die Genesenen und Geimpften. Ein Bundesland – Hamburg – nahm jedoch noch keine Lockerung vor und plant dies auch nicht im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie [10].[^ [10] Freiheiten für Geimpfte: Nur ein Bundesland lockert nicht. https://www.tagesschau.de/inland/lockerungen-geimpfte-107.html (Stand: 21.06.2021).] Obwohl sich viele Menschen impfen lassen wollen, ist es aufgrund der Reihenfolge, in der die Impfstoffe vergeben werden (Prioritätsgruppen), schwierig, den Impfstoff zu bekommen, so dass nicht jeder zu einem bestimmten Zeitpunkt geimpft werden kann [8]. Impfangebot ist demnach nicht mehr ein Begriff, der dafür steht, dass allen das Angebot der Impfung zu Verfügung steht und sie selbst entscheiden können, ob sie dieses annehmen, sondern dieses Angebot gilt zuerst nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Es kann damit als Privileg bestimmter Gruppen betrachtet werden.
Wie im Fall der Ausgangssperre liegt bei Impfangebot ein Bedeutungswandel in Form der Differenzierung vor, denn nun wird mit dem Begriff Impfangebot häufig automatisch das Angebot zur Impfung gegen Covid-19 assoziiert. Anstatt dass das Impfangebot sich auf mehrere Impfstoffe bezieht, ist es in Hinsicht auf diesen einen Impfstoff differenziert und spezifische Bedeutungen wie die begrenzte Verfügbarkeit und damit einhergehende Erleichterungen werden über den allgemeineren Begriff Impfangebot hinaus mitgedacht. (vgl. Ausführungen zu Differenzierung in Keller / Kirschmann 2003: 15–34). Zudem scheint darüber hinaus im Vergleich zur vorherigen dominierenden Assoziation, dass in Deutschland für alle Bürger:innen Impfangebote frei zur Verfügung stehen, dies aber nicht alle annehmen müssen und wollen, eine Art Bedeutungs-Antonymie zu bestehen: Während damals alle die Möglichkeit des Impfangebotes (für verschiedene Impfstoffe) hatten, dieses aber nicht alle annahmen, möchten heute viele ein Angebot (zur Corona-Impfung) bekommen, es erhalten aber nicht alle eines. Aus einem Angebot für alle wurde ein Angebot für wenige Ausgewählte.
3.3 Impfpflicht/-zwang
Zunächst kann festgestellt werden, dass die beiden Begriffe Impfpflicht und -zwang synonym verwendet werden können [12].[^ [12] Impfpflicht https://www.duden.de/rechtschreibung/Impfpflicht (Stand: 17.06.2021).] Im Duden wird die Impfpflicht als „Verpflichtung, sich, sein Kind oder ein Tier impfen zu lassen” [12] beschrieben. Demnach handelt es sich dabei um ein Determinativkompositum, da Impf- die Pflicht näher bestimmt, nämlich als eine Pflicht, sich oder andere impfen zu lassen. Im DWDS wird diese Erläuterung um den Aspekt erweitert, dass eine Nicht-Einhaltung dieser zu Sanktionen führen kann [13].[^ [13] Impfpflicht https://www.dwds.de/wb/Impfpflicht (Stand: 17.06.2021).] Bereits gegen andere Krankheiten wie Masern wurde in der Vergangenheit eine Impfpflicht gefordert (vgl. Osink 2020: 2). Eine gesetzliche Masernimpfpflicht besteht auch bereits für einzelne Gruppen, wie Personen von Gemeinschaftseinrichtungen, für Soldaten sogar eine Impfpflicht gegen mehrere ansteckende Krankheiten (vgl. Gauch 2021).
Auch wenn eine Impfpflicht gegen das Virus SARS-CoV-2 noch nicht der Realität entspricht, befürchten bereits viele Menschen ein solches Gesetz. Damit eng verbunden sind eine Verletzung demokratischer Werte und Einschränkungen von einigen Grundrechten (vgl. Gauch 2021). Während es bisher in der Regel freiwillig war, ob eine Person sich impfen lässt, steigt nun der soziale Druck, dies zu tun. Wie in der Überschrift des Instagram-Beitrages Lockerungen für Geimpfte und Genesene [14] zeigt sich, dass geimpfte Menschen Vorteile haben bzw. haben werden. Wer Freiheiten möchte, muss sich impfen lassen. Diese Bedingung wird inzwischen von vielen Menschen als indirekte Impfpflicht angesehen. Im Zuge der Covid-19-Pandemie etablierte sich zudem der neue Ausdruck Impfpflicht light, womit eine vorschriftsmäßige Impfung für spezielle Personengruppen, insbesondere gegen SARS-CoV-2, gemeint ist [15].[^ [15] Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp# (Stand: 17.06.2021).] Diese wurde geprägt aufgrund der derzeitigen Situation, dass nicht genügend Impfdosen, aber auch Impfbereitschaft vorhanden ist, um eine gesellschaftliche Immunität zu erzielen, und deshalb eine solche durch die Regierung eingeführte „Impfpflicht light” in den gesellschaftlichen Diskurs aufgenommen wurde [15].
Im Fall der Impfpflicht ist es von der Auslegung der neuen Bedeutung abhängig, um welche Art von Bedeutungswandel es sich handelt: Wird Impfpflicht in dem Sinn verstanden, dass es ein rechtskräftiges, zur Impfung gegen das SARS-Cov-2 Virus verpflichtendes Gesetz gibt und damit die Corona-Impfpflicht Realität wird, liegt eine Differenzierung bzw. Bedeutungsverengung vor. Denn die Impfpflicht wird in Hinsicht des zu impfenden Impfstoffes, in diesem Fall des gegen das Corona-Virus, differenziert (vgl. Ausführungen zu Differenzierung in Keller / Kirschmann 2003: 15–34). Wird jedoch die Tatsache, dass es Lockerungen für Geimpfte gibt und der soziale Druck, sich impfen zu lassen, als (indirekte) Impfpflicht verstanden, liegt (gleichzeitig) ein metonymischer Wandel der Bedeutung vor: Die Symptome werden in Kombination als die Folge / die „Schlussfolgerung“, eine Impfpflicht, bezeichnet, während die Symptome im eigentlichen Sinne keine Impfpflicht sind, sondern nur auf diese schließen lassen und / oder als diese interpretiert werden. Die Bedeutungsverschiebung findet damit innerhalb eines Bereiches statt. (vgl. Ausführungen metonymischer Wandel in Keller / Kirschmann 2003: 58–79).
3.4 Zweiklassengesellschaft
Wenn man grundlegend und allgemein von einer Zweiklassengesellschaft spricht, meint man im bisher geläufigen Sinn „eine Gesellschaftsform, die aus einer Klasse der wohlhabenden und einer Klasse der Mittellosen besteht, wobei eine starke Mittelschicht fehlt” [16].[^ [16] Zweiklassengesellschaft https://www.duden.de/rechtschreibung/Zweiklassengesellschaft (Stand: 16.06.2021).] Schon in den Vorstellungen und Schriften Karl Marx’ spielte dieses Kompositum eine tragende Rolle (vgl. Nohlen / Grotz 2015: 310). Hierbei handelt es sich im Sinne des sozio-kulturellen Wandels, um „jeweils zwei antagonistisch sich gegenüberstehende Klassen” (ebd.), welche ihre Differenzen bezüglich dieser gesellschaftlichen Veränderungen aktiv austragen. Später, und damit vor allem die heutige Zeit betreffend, sorgte der erstarkende Kapitalismus für eine gesellschaftliche Umstrukturierung in zwei Klassen: Bourgeoisie und Proletariat (vgl. ebd.). Damit entstand der bis heute andauernde zentrale Konflikt einer Gesellschaft, in welcher Ungleichheit und die damit verbundenen Probleme eine große Rolle spielen (vgl. ebd.). Trotzdem lässt sich das Kompositum Zweiklassengesellschaft nicht nur in Verbindung mit Wirtschaft und Politik nutzen, sondern ist auch in vielen anderen Bereichen der modernen Welt präsent. Häufig wird es als Metapher genutzt, um zwischen zwei gesellschaftlichen Thematiken einen Vergleich zu ziehen oder ein Problem zugänglicher und konkreter darzustellen.
Während der Covid-19-Pandemie erlangte dieses Wort einen anderen Kontext und somit auch eine neue Bedeutung. So zeichnet es immer noch eine zwiegespaltene Gesellschaft ab, jedoch weniger im Sinne des finanziellen Aspekts, wie bei Marx beschrieben (vgl. Nohlen / Grotz 2015: 310), sondern alleinig aufgrund einer erhaltenen Impfung. Hierbei entscheidend ist jedoch ebenfalls eine Mangelerscheinung in der Gesellschaft, welche unter 3.2 bereits genauer beschrieben wurde: Impfangebote. Diese spielen aktuell eine große Rolle, weshalb viele Bürger:innen versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Die Problematik dieses Aspektes besteht darin, dass nun neue Regelungen bereits geimpften Personen gesellschaftliche und persönliche Vorteile verschaffen [14]. Neben der Impfung an sich haben Geimpfte mehrere Freiheiten, wie sich nicht mehr testen lassen zu müssen, um ein Event zu besuchen oder zu verreisen, und damit Privilegien, die Ungeimpften nicht zukommen, vergleichbar mit dem Privilegien-Gefälle von Bourgeoisie und Proletariat.
Diese Übertragung des Begriffs der Zweiklassengesellschaft auf die Gruppen Geimpfte und Nicht-Geimpfte lässt bei der Art des Bedeutungswandels auf einen metaphorischen Wandel (vgl. Ausführungen zu metaphorischer Wandel in Keller / Kirschmann 2003: 34–58) schließen: Wie bereits erwähnt, wurde dieser Begriff schon mehrfach als Metapher verwendet, um z. B. auf ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft zwischen zwei Gruppen wie bei den Klassen Bourgeoisie und Proletariat aufmerksam zu machen. Im Verlauf der Covid-19-Pandemie wird diese Metapher auch für die Gruppen-Dichotomie Geimpfte / Nicht-Geimpfte verwendet. Dabei sind es nicht im wirklichen Sinne zwei Klassen, aber wie bei der ursprünglichen Zweiklassengesellschaft (wie bei Marx) besteht zwischen beiden Gruppen ein Unterschied in den Vorteilen / Freiheiten, eine gewisse soziale Ungerechtigkeit. Dieses tertium comparationis verbindet beide Bereiche, ermöglicht die Bedeutungsmetapher und damit die neue Covid-19-Bedeutung, die bereits von einigen verwendet wird und präsent in der Gesellschaft zu sein scheint.
4. Textdynamische Phänomene
Textdynamik folgt aus dem dialogischen, dynamischen Charakter der Sprache selbst. Da mit einem Ausdruck mentale Konzepte verknüpft sind, „über die ein Bezug zu Objekten und Ereignissen in der Realität hergestellt werden kann“ (Pittner 2016: 125), wird die Sprache sowohl durch die sich verändernde Wirklichkeit beeinflusst als auch sie selbst verändert die Wirklichkeit. Ferner ist Dynamik den sozialen Medien wie Instagram eigen. Durch Bezugnahme auf Inhalte und Subthemen des kommentierten Beitrags wie auch durch thematisch gebundene Interaktionen zwischen Kommentierenden kommt der Gesamttext in eine innere Bewegung. Die Kommentare sind konzeptionell mündlich und schon deshalb durch Interaktion und eine gewisse Dynamik gekennzeichnet. Die geäußerten Einstellungen der Kommentierenden und ihre Veränderungen entwickeln ebenfalls eine eigene Textdynamik. So werden Lockerungen für Geimpfte und Genesene einerseits aufgrund der Priorisierung als ungerecht (vgl. das Possessivkompositum Zweiklassengesellschaft), andererseits als indirekte Impfpflicht (vgl. 3.3) kritisiert. In den Kommentaren wird deutlich, dass die User:innen die Impfpflicht auf die derzeitige gesellschaftliche Situation beziehen und sich dadurch nun gezwungen fühlen, sich gegen Covid-19 immunisieren zu lassen. In Bezug auf die Überschrift des betrachteten Beitrags [14] weist dies darauf hin, dass die Lockerungen für Geimpfte und Genesene als eine solche indirekte Impfpflicht verstanden werden:
hmm keine impfpflicht?! aber seeeeeeehr schlau gemacht, dass man sich schon fast dazu verpflichtet fühlt!
Und so kommt die ImpfPflicht weil jeder der geimpft ist seine Freiheiten wieder bekommt und die die es nicht sind seine Freiheiten nie wieder bekommen
Noch kräftiger wirken diese Phrasen, wenn sie den gesamten Kommentar vertreten:
Indirekte Impfpflicht ✨🤡
Indirekter Impfzwang
Als ein wichtiges Mittel der Textdynamik zeigt sich der Bedeutungswandel, was am Kompositum Zweiklassengesellschaft exemplarisch dargestellt werden kann. Der Oberkommentar lautet:
Der Ansatz ist sicherlich richtig, aber so heißt es: Willkommen in der Zweiklassen-Gesellschaft
Der Kommentar bezieht sich auf die geplanten Lockerungen für geimpfte Personen. Der:Die Verfasser:in empfindet diese zwar als gerechtfertigt, spricht jedoch auch die Problematik der Zweiklassengesellschaft an, die mit dieser Regelung einhergehen könnte. Die durchaus positive Bewertung wird jedoch durch die Verwendung der gegensätzlichen Konjunktion aber eingeschränkt und die Entstehung einer konzeptuell neuen Zweiklassengesellschaft unterstrichen. Textdynamik kommt in diesem Fall durch die Neukonzeptualisierung der Zweiklassengesellschaft entsprechend der Priorisierung als Teilung der Gesellschaft in privilegierte Geimpfte und unterprivilegierte Ungeimpfte und damit durch die Einbettung in einen anderen Diskurs zustande (vgl. auch Ausgangssperre). Im späteren Kommentarverlauf, in dem die Chattenden darauf anspielen, dass die derzeitige Gesellschaft schon vor den neuen Regelungen für Geimpfte zwiegespalten war, kann eine noch andere Konzeptualisierung des Kompositums Zweiklassengesellschaft vorliegen. Allerdings fehlen hier Indizien dafür, ob in den Subkommentaren (6) bis (8) das ursprüngliche oder aber noch ein anderes Konzept der (Zwei)Klassengesellschaft bemüht wird:
@mika______13 als hätten wir nicht jetzt schon eine klassengesellschaft mein schatz 🤡
@mika______13 hast vorher wohl noch nicht? 😂😂😅
@mika______13 ...die gab es ja vorher auch schon ... 🤷🏼♂
Ebenfalls dynamisch wirkt hier die differente sprachliche Gestaltung übereinstimmender Einstellungen.
Allerdings plädieren auch einige dafür, dass lediglich Maßnahmen wie die Impfpflicht die Covid-19-Krise eindämmen können, doch bisher bevorzugen viele Politiker:innen Freiwilligkeit, statt Pflicht (vgl. Wein 2021: 114).[^3 Eine Impfpflicht würde laut Wein (vgl. 2021: 115) unter den gegebenen Umständen nicht gegen das Gesetz verstoßen.] Die Textdynamik entsteht also auch durch Äußerungen, die in einzelnen Kommentaren oder im Verlauf eines Kommentars gegensätzliche Einstellungen verbalisieren. Wie im Falle des Oberkommentars (5) ist auch in (9) eine persönliche Zwiegespaltenheit in der Meinungsbildung zu bemerken. Zum einen zeigt die verfassende Person Frust gegenüber der Thematik, was unter anderem an der Metapher „all you can eat Plauzen” zu erkennen ist. Durch diese Verbildlichung wird den Lesenden der Unmut und die Unzufriedenheit noch deutlicher. Auf der anderen Seite stimmt die Person mit der Exklamation zu Beginn mit der Aussage des / der Verfassers / in überein.
@mika______13 zumindest kurzzeitig definitiv! Somit drängt man die Leute auch zum Impfen, wobei das ja nichts schlechtes sein muss. Aber diese Undankbarkeit, man erwartet von den Jungen und Gesunden, dass sie die Kranken und Schwachen schützen, nur, dass jetzt ein paar Rentner auf der AIDA ihre all you can eat Plauzen vollstopfen können. Ich gönne es ihnen, aber ich würde vielleicht auch einfach mal gerne nach Mitternacht vor die eigene Tür
Nur wenige stimmen den Lockerungen beziehungsweise dem Oberkommentar (5) ernsthaft zu. Neben all diesen eher negativen Kommentaren, sind jedoch auch konstruktive und klar strukturierte Beiträge erkennbar.
@mika______13 ja aber doch nur bis diejenigen dann auch geimpft sind, danach werde die auch ihre Freiheiten genießen und der Aufschrei „Unfair“ wird ganz schnell vergessen sein…sicherlich nicht bei allen aber bei sehr vielen… dann wird es heißen „ich habe lange genug verzichtet, die Nicht-Geimpfte sind mir egal“ von daher ist das mit der 2-Klassengesellschaft nur solange aktuell, bis man selbst seine Vorteile daraus zieht 😉 … übrigens kenne ich viele die Jünger sind als ich und trotzdem schon geimpft wurden…denen sage ich nun „Trinkt bitte einen für mich mit und genießt euer Leben wieder!!!“
Der gesprächsartige Charakter der Kommentare zeigt sich u. a. im Gebrauch von Exklamationen und Imperativsätzen (vgl. 1, 11, 19), Interjektionen wie hmm, tja, ach ja (vgl. 1, 16, 17) als Hinweise auf die aktuelle Rezeption des vorangehenden Kommentars, mit welchen der Kontakt zum Beiträger bestätigt und der Gesprächsverlauf gestützt werden, manchmal durch gesprächsartige Gestaltung des Kommentars selbst wie in (11):
Es wird keine Impfpflicht geben!
Was? Du willst deine Freiheiten zurück? Ja tut mir leid, musst du dich leider impfen.
Lobbygesteuerte Drecksmafia von Politik! Fahrt zur Hölle
Die „zweite, ungeimpfte Klasse” fühlt sich benachteiligt und entwickelt oftmals negative Einstellungen und Emotionen. Die Kommentare zum Beitrag über Lockerungen für Geimpfte und Genesene implizieren Emotionen und Gefühle wie Missmut und Wut, aber auch Enttäuschung und Frust. Die Kommentierenden sind der Meinung, dass jeder zuerst das Impfangebot erhalten, und dann die Lockerungen eingeführt werden sollten. Die derzeitigen Regeln führten zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu vermeidbaren Konflikten.
Neben negativ konnotierten bildlichen Ausdrücken wie ausbaden (müssen) (12) oder vor den Kopf gestoßen (13) drücken Kommentierende ihre Verbitterung über die Priorisierung aus, mit der die Regierung die Bedeutung junger Menschen für die Zukunft widerlege. Als Zumutung wahrgenommene Priorisierung wird mit Applaus an die Regierung ironisch quittiert. Ebenfalls ironisch interpretierbar ist die Gegenüberstellung der gelebten Solidarität mit stärker durch das Virus Gefährdeten und der als Undank empfundenen „Erlaubnis“ weiterhin ohne soziale Kontakte zu leben:
Wirklich stark vom Staat. Junge Menschen haben über 1 Jahr lang ihr Leben zurück geschraubt um solidarisch den älteren und vorerkrankten gegenüber zu sein und als Dank dafür dürfen wir jetzt die nächsten Monate weiterhin ohne sozialen Kontakte leben und darauf hoffen irgendwann mal ein Impfangebot zu bekommen. Also irgendwas läuft hier gewaltig schief.
Vor allem in Anbetracht dessen, dass die jungen Menschen von heute die Zukunft von später sind. All die, die die wirtschaftlichen Schäden wieder ausbaden müssen. Aber über uns macht man sich ja keine Gedanken. Applaus an die Regierung, mehr fällt mir dazu nicht ein
Grundsätzlich eine gute Sache, jedoch fühlt sich jetzt wahrscheinlich jeder junge Mensch vor den Kopf gestoßen, der seit Wochen und Monaten auf sein Impfangebot wartet.
Lockerungen für Geimpfte und Genese werden als indirekte Impfpflicht / indirekter Impfzwang verstanden. Als alleinstehende Kommentare wirken die Phrasen umso kräftiger:
Indirekte Impfpflicht ✨🤡
Indirekter Impfzwang
In (16) wird dagegen die kommentierende Person, auf die Bezug genommen wird, durch die rhetorische Frage indirekt als inkompetent bezeichnet, da sie laut dem / der Verfasser / in im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst habe:
@claire_srmk Tja, das passiert wenn man blindlings alles befolgt was von oben gesagt wird! Nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst? Weiterhin viel Spaß mit eurer „Solidarität und Ausgangssperre“ hahaha ... 😂
Die rhetorische Frage in (17) wiederum impliziert, dass das „Volk”, also die Einwohner:innen Deutschlands, nicht denken würden und demnach nicht besonders schlau wären. Hier spiegelt sich erneut der Frust wider, den die geplanten Lockerungen hervorrufen. Außerdem erfolgt hier eine Hyperbel, welche das Treffen und Konsumieren von Alkohol in großen Gruppen übertrieben darstellt. Die Person, die den Kommentar verfasste, scheint demnach wütend auf diese Menschen zu sein und stellt ihre negativen Gefühle übertrieben dar. Es geht der Person vermutlich um Geduld und appelliert an diese, da von der Ausgangssperre in dem Kontext gesprochen wird, und dass diese durch die sinkende Inzidenz wohl bald aufgehoben werden wird.
Wann hat dieses Volk eigentlich lesen und denken verlernt? Da steht nichts von intergalaktischem Freibiersaufen mit 500.000 anderen. Bis auf die eine Ausnahme – Ausgangssperre- ist der einzige Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft der zu absolvierende Schnelltest. Und das Thema Ausgangssperre duerfte sich Inzidenznedingt in 10 bis 14 Tagen bundesweit erledigt haben, das braune Thüringen mal ausgenommen. Ach ja. Zweit Impfung 4.6., also noch lange hin bis ich in den Genuss käme.
Vereinzelt, wie in (16) das hahaha, finden sich in den Kommentaren auch Verschriftlichungen paraverbaler Sprachmittel. Dagegen sind grafische Ausdrucksformen von Emotionen – Emojis (3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 21), (mehrfache) Ausrufezeichen (1, 11, 22) – und verstärkende typographische Gestaltung wie Großschreibung (19, 20, spielerisch-dynamisch in 21) und Vervielfachung von Buchstaben (1, 19, 20) bei Kommentierenden offensichtlich beliebt:
Schön dass gelockert wird, obwohl nicht mal jeder ein Impfangebot bekommen hat oder schon einmal infiziert war 👏🏻
Sorry hab da garkein verständnis für. Konnten die nicht warten bis ALLLEN Deutschen ein Impfangebot gemacht wurde? Wie asozial das einfach nur noch ist. Von wegen solidarität
es ist nicht fair solange nicht für ALLE ein impfangebot besteht…
„eS wiRd kEiNE iMpFpFLiChT gEbeN“ 🤡🤡🤡
Unglaublich!!!
Anstatt damit zu warten bis alle ein Impfangebot haben!! Aber nein, die Gesellschaft wird gespalten und es hat absolut nichts mit Neid zutun sondern mit normalem Menschenverstand!! Man wird „bestraft“ dass man jung und gesund ist und kein Anrecht auf einen Impftermin hat!
5. Fazit
Die Analyse der Instagram-Kommentare ergibt, dass Textdynamik ein komplexes, durch mehrere Faktoren bewirktes und mit recht unterschiedlichen verbalen, paraverbalen und nonverbalen Mitteln realisierbares Phänomen ist. Neben dem Format des Sozialmediums, das interaktionale Sprachhandlungen voraussetzt, geht sie aus mündlicher Konzeptualisierung schriftlich realisierter Kommunikation in sozialen Medien hervor. Textdynamik spiegelt sich einerseits in wechselnder Bezugnahme auf den Beitrag und auf vorangehende Kommentare, andererseits im heterogenen Gebrauch von Standard- und Umgangssprache und im Nebeneinander von typischerweise im gesprochenen Deutsch gebrauchten verbalen und paraverbalen Mitteln und aufgrund der Schriftform in graphischen und typografischen Repräsentationen von Emotionen.
Als stark dynamisch erweist sich der Bedeutungswandel. Anders als viele andere Komposita, die täglich (spontan und neu) gebildet werden, fanden die hier untersuchten – Ausgangssperre, Impfangebot, Impfpflicht / -zwang und Zweiklassengesellschaft – jedoch Einzug in die Wörterbücher oder zumindest in das Alltags-Korpus. Neben ihren Wortbedeutungen entsprechen alle vier Komposita der semantischen Relation der Determinativkomposita. Alle untersuchten Komposita haben gemeinsam, dass sie im Zuge der Covid-19-Pandemie im Laufe von Sprachwandlungsprozessen aktuelle Konzeptualisierungen und Verwendungskontexte erhielten, die ihnen eine zusätzliche oder eine neue (vgl. Polysemie), derzeit dominierende Bedeutung verliehen. Die dominierende Corona-Bedeutung ist damit zu erklären, dass die Corona-Pandemie momentan das Thema ist, das alle Menschen beschäftigt, da die Pandemie alle lebensweltlichen und gesellschaftlichen Bereiche maßgeblich beeinflusst. Teils lange bestehende, historische Bedeutungen (vgl. Zweiklassengesellschaft) wurden von der Corona-Bedeutung verdrängt bzw. unterdrückt. Auch wenn sie vorher in unterschiedlichen Kontexten verwendet wurden, besitzen sie nun einen gemeinsamen: die Corona-Wirklichkeit. Dabei ist zu erwähnen, dass dieses Phänomen bei vielen weiteren Komposita auftritt. Weitere solcher Komposita sind beispielsweise in der Wörterliste rund um die Coronapandemie des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache einzusehen [15]. Damit beweist die SARS-CoV-2-Pandemie wieder einmal, wie wandelbar und dynamisch die Sprache ist.
Dennoch erweist es sich als schwierig und wenig aussagekräftig, anhand eines einzigen Instagram-Beitrages neue Zuschreibungen und Kontexte der Komposita zu ermitteln; werden durch die Kommentare doch nur vergleichbar wenig Meinungen von Personen eingeholt und wohl kaum konventionalisierte Bedeutungen ermittelbar. Ob diese Bedeutungen lexikalisiert sind, ist deshalb uneindeutig: Einerseits hielten bereits einige Wörtersammlungen die neuen Bedeutungen schriftlich / digital fest (siehe z. B. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache [15]) und die Komposita werden in diesem Sinn von einer großen Masse der Gesellschaft verwendet. Andererseits ist ihre neue Bedeutung noch nicht als Wortbedeutung jenseits des Corona-Kontextes (z. B. im Duden) niedergeschrieben und ihre Entstehungsspanne für einen Bedeutungswandel sehr gering, während die meisten Bedeutungsänderungen einen langen Prozess (vgl. Beispiele in Keller / Kirschmann 2003: 15–100) durchliefen. Deshalb ist es weiterhin zu verfolgen, ob die neuen Bedeutungen sich dauerhaft etablieren (in längerer Hinsicht konventionalisiert werden) oder mit dem Ende der Corona-Krise auch den neuen Bedeutungen ein Ende gesetzt wird. Problematisch ist dies zudem, da bisher nur wenig Studien und Literatur zu dem Thema der „Corona-Komposita“ vorliegen.
Mit Blick in die Zukunft lässt sich fragen, ob die Komposita diese neuen Bedeutungen beibehalten, bzw. die Sprecher:innen der deutschen Sprache sie weiterhin mit der Covid-19-Pandemie in Verbindung bringen werden oder eventuell gar die alten Bedeutungen nach der Krise wieder ihren Status als Hauptkonzeptualisierungen zurückerlangen. Covid-19 ist derzeit immer noch ein zentraler Teil unserer Gesellschaft, die Corona-Wirklichkeit beeinflusst und wandelt auch weiterhin die Sprache. Es ist zu vermuten, dass beides miteinander korreliert.
- Boehme-Neßler, Volker (2021): Ausgangssperren zur Pandemiebekämpfung? Verfassungsrechtliche Anmerkungen zur Verhältnismäßigkeit in Zeiten von Corona, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Extra 40 / 10b, 1–5.
- Chartier, Roger (2014): »Repräsentation« und ihre Bedeutung, in: Trivium 16, 1–13.
- Coulmas, Florian (1988): Wörter, Komposita und Anaphorische Inseln, in: Folia Linguistica 22 / 3–4, 315–336.
- Donalies, Elke (2014): Morphologie: Morpheme, Wörter, Wortbildungen, in: Ossner, Jakob / Zinsmeister, Heike (Hg.): Sprachwissenschaft für das Lehramt. Paderborn: Schöningh, S. 157–180.
- Duda, Barbara (2014): Bemerkungen zum Wandel des deutschen Wortschatzes, in: Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich 3, 13–21.
- Duden (2016): Die Grammatik. 4., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage (Band 4 – Der Duden in 12 Bänden). Berlin: Dudenverlag.
- Efing, Christian (2021): Grammatische Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache – ein Einblick, in: Lublin studies in modern languages and literature 45 (1), 99–112.
- Gauch, Andreas A. (2021): Corona-Impfpflicht – Ist das rechtlich überhaupt zulässig? https://www.anwalt.de/rechtstipps/corona-impfpflicht-ist-das-rechtlich-ueberhaupt-zulaessig_186345.html (Stand: 23.06.2021).
- Hentschel, Elke (2020): Basiswissen deutsche Wortbildung. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kaehlbrandt, Roland (2018): Manuskript – Schneller, kürzer, lässiger – unsere Sprache im Wandel, https://www.sptg.de/fileadmin/fileadmin/SPTG/Dokumente/RedenundBeitraege/vortrag_2018_02_20_PTG_Schneller_kuerzer_laessiger_rk.pdf (Stand: 30.08.2021).
- Keller, Rudi (2004): Sprachwandel. https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/uploads/media/Sprachwandel.pdf (Stand: 29.08.2021).
- Keller, Rudi / Kirschbaum, Ilja (2003): Bedeutungswandel. Eine Einführung, Berlin / New York: De Gruyter.
- Killy, Daniel (2021): Mit Corona-Frisur auf ein Abstandsbier: Was Covid-19 mit der deutschen Sprache macht https://www.rnd.de/wissen/mit-coronafrisur-auf-ein-abstandsbier-was-covid-19-mit-der-deutschen-sprache-macht-6K52K3CEFNBP5NC55FEZBG3D6I.html (Stand: 12.06.2021).
- Lewandowski, Theodor (1985): Linguistisches Wörterbuch, 3 Bde. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Lüdeling, Anke (2012): Grundkurs Sprachwissenschaft. Stuttgart: Klett.
- Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2017): Zu den Bestimmungsmöglichkeitsgrenzen der individuell-subjektiven Bedeutungsanteile, in: Bartoszewicz, Iwona / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur: Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I. Linguistische Treffen in Wrocław Vol. 13. Wrocław / Dresden: Neisse Verlag, 127–141.
- McCourt, Ryan / Schmieder, Christoph (2021): Auswanderung in der Zeit des Nationalsozialismus http://www.auswanderung-rlp.de/emigration-in-der-ns-zeit/zu-emigration-der-juden-aus-der-pfalz-im-dritten-reich.html (Stand: 20.06.2021).
- Menden, Alexander (2020): Wie Corona unsere Sprache beeinflusst https://www.sueddeutsche.de/leben/corona-coronavirus-sprache-merkel-1.4898287 (Stand: 15.06.2021).
- Nohlen, Dieter / Grotz Florian (Hg.) (2015): Kleines Lexikon der Politik. München: Verlag C.H.Beck oHG.
- Nübling, Damaris (2006): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr.
- Olsen, Susan (2013): Possessivkompositum, in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) online (Quelle: Olsen, Susan, Wortbildung. De Gruyter). https://www.degruyter.com/database/WSK/entry/wsk_id_wsk_artikel_artikel_18789/html (Stand: 10.12.2021).
- Osink, Alexandra (2020): Impfpflicht. Verfassungsrechtliche Überlegungen im Lichte ausgewählter Staatszielbestimmungen, der Kompetenzverteilung und einschlägiger Grundrechte. Diplomarbeit. Innsbruck: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
- Pittner, Karin (2016): Einführung in die germanistische Linguistik. Darmstadt: WBG.
- Roelcke, Thorsten (2018): 7. Die Konstitution terminologischer Systeme in Fachsprachen, in: Engelberg, Stefan / Kämper, Heidrun / Storjohann, Petra: Wortschatz: Theorie, Empirie, Dokumentation. Berlin / Boston: De Gruyter, 171–188.
- Schaff, Adam (1961): Die Bedeutung von Bedeutung, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 9 (6), 708–723.
- Schneider, Jan G. (2005): Was ist ein sprachlicher Fehler? Anmerkungen zu populärer Sprachkritik am Beispiel der Kolumnensammlung von Bastian Sick, in: Aptum: Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur 2, 154–177 http://www.uni-muenster.de/imperia/md/contentgermanistik/lehrende/schneider_j/sprachkritik.pdf (Stand: 30.08.2021).
- Siehr, Karl-Heinz / Berner, Elisabeth (2009): Sprachwandel und Entwicklungstendenzen als Themen im Deutschunterricht: fachliche Grundlagen – Unterrichtsanregungen – Unterrichtsmaterial. Potsdam: Universitätsverlag.
- Wein, Thomas (2021): Ist eine Impfpflicht gegen das Coronavirus nötig? Heidelberg: Springer.
- Wellmann, Hans (2017): Morphologie der Substantivkomposita, in: Ortner, Lorelies (Hg.): Deutsche Wortbildung Hauptteil 4 Substantivkomposita (Komposita und kompositionsähnliche Strukturen 1). Berlin / Boston: De Gruyter, 3–111.
- Wolff, Gerhart (1986): Deutsche Sprachgeschichte. Ein Studienbuch. Frankfurt am Main: UTB / Francke.
- [1] Angebot https://www.duden.de/rechtschreibung/Angebot (Stand: 21.06.2021).
- [2] Ausgangssperre https://www.duden.de/rechtschreibung/Ausgangssperre (Stand: 11.06.2021).
- [3] Ausgangssperre https://www.dwds.de/themenglossar/Corona (Stand: 11.06.2021).
- [4] Bedeutungswandel https://www.duden.de/rechtschreibung/Bedeutungswandel (Stand: 27.08.2021).
- [5] Corona-Impfung: Diese Länder erleichtern Urlaubern die Einreise https://www.adac.de/news/corona-impfung-reise-urlaub/ (Stand: 23.06.2021).
- [6] Corona-Notbremse und Ausgangssperre: Diese Regeln gelten jetzt https://www.adac.de/news/lockdown-ausgangssperre (Stand: 22.06.2021).
- [7] Cześć https://sjp.pwn.pl/slowniki/cze%C5%9B%C4%87.html (Stand: 13.10.2021).
- [8] Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988 (Stand: 21.06.2021).
- [9] Empfehlungen der Ständigen Impfkommission https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html (Stand: 21.06.2021).
- [10] Freiheiten für Geimpfte: Nur ein Bundesland lockert nicht. https://www.tagesschau.de/inland/lockerungen-geimpfte-107.html (Stand: 21.06.2021).
- [11] Impfen https://www.duden.de/rechtschreibung/impfen (Stand: 21.06.2021).
- [12] Impfpflicht https://www.duden.de/rechtschreibung/Impfpflicht (Stand: 17.06.2021).
- [13] Impfpflicht https://www.dwds.de/wb/Impfpflicht (Stand: 17.06.2021).
- [14] Lockerungen für Geimpfte und Genesene. https://www.instagram.com/p/COh7mw2qN5O/ (Stand: 20.06.2021).
- [15] Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp# (Stand: 17.06.2021).
- [16] Zweiklassengesellschaft https://www.duden.de/rechtschreibung/Zweiklassengesellschaft (Stand: 16.06.2021).
Beitrag 10
Dynamische Entwicklungen von Leserkommentaren zweier Onlinezeitungen zum Thema „Schutzmaßnahmen“ während der Covid-19 Pandemie Eine linguistische Analyse
1. Einleitung
Das Leben vieler Deutscher[^1 In dieser Arbeit wird nach dem generischen Maskulinum gegendert. Wenn möglich, werden zudem Neutralisierungsformen genutzt. Fortwährend sind somit sämtliche Geschlechter gemeint.] hat sich seit der Covid-19 Pandemie verstärkt in den digitalen Raum verlagert. Die Kommunikation erfolgt über Kurznachrichten auf Social-Media-Portalen wie Twitter, Facebook und Instagram, in Foren oder in den Kommentarspalten mannigfaltiger Websites. Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen und aufzuzeigen, wie die Leser die Schlagzeilen zum Thema „Schutzmaßnahmen während der Covid-19 Pandemie“ emotional durch ihre Beiträge verarbeiten, und wie sich ihre Reaktion im Laufe der Pandemie verändert. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob sich die Schlagzeilen selbst während der Covid-19 Pandemie verändert haben. Somit wird die hier vorgestellte Arbeit der Forderung gerecht, dynamische Aspekte im Sprachgebrauch aufzuzeigen.
Als Datengrundlage werden Schlagzeilen zweier Onlinepräsenzen deutscher Printmedien, einmal zu Beginn der Pandemie im April 2020 und einmal zur Pandemielage im März 2021, auf ihren sprachlichen Wandel hin untersucht und anschließend mit den Kommentaren unter den jeweiligen Artikeln sowohl inhaltlich, als auch sprachlich verglichen.
In der Arbeit werden Kommentar- und Diskussionsforen betrachtet, welche von den Onlinepräsenzen der Zeitungen zur Kommentierung einzelner Artikel eingerichtet wurden. Die Auswahl dieser orientiert sich dabei an der Definition von Fandrych und Thurmair:
Diskussionsforen sind Webseiten, auf denen Internetnutzer zu bestimmten Themen, z. T. auch als Reaktion auf bestimmte Nachrichten (z. B. in Online-Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften), Weblogs u. ä. eigene Diskussionsbeiträge einschicken können, die dann (oftmals gefiltert durch Moderatoren) – entweder sequenziell oder nach Subthemen (Threads) geordnet auf der jeweiligen Webseite veröffentlicht werden. (Fandrych / Thurmair 2011: 136)
Dabei unterscheidet sich die geschriebene Sprache in Kommentarforen von gesprochener Alltagssprache, welche Lanwer durch drei Aspekte – der Funktion als „zentrales Werkzeug der Objektivation bzw. der Typisierungen von Erfahrungsinhalten und somit als Mittel der intersubjektiven Konstitution von ‚Wirklichkeit‘“ (Lanwer 2015: 24), dem Aufbau als ein „im Rahmen sozialer Handlungen intersubjektiv konstituiertes (sozio-)semiotisches System“ (ebd.: 24) und der strukturellen Eigenschaften, welche „auf die spezifischen Anforderungen der sprachlichen Interaktion in der Face-to-face-Situation im Speziellen zugeschnitten [sind]“ (ebd.: 24) – definiert. Davon ist auszugehen, da Kommentare medial schriftlich, aber konzeptionell mündlich sind und einen asynchronen Sprecherwechsel aufweisen (vgl. Mroczynski 2014: 19).
2. Theoretische Vorüberlegungen
Um die oben genannten Phänomene zu analysieren, wurde in der Arbeit auf die diskurspragmatische Theorie nach Roth zurückgegriffen. Diese zielt darauf ab, „die konkreten interaktionalen Bedingungen zu erfassen, unter denen es zu […] Realisationen des Diskurses kommt […]“ (Roth 2018: 374). Die Besonderheit liegt darin, dass das Analysemodell nach Roth dialogisch-mündliche Gespräche als Daten für ihre Untersuchungen einbezieht. Durch die Sonderstellung der digitalen Kommunikation – die mündliche Konzeption, die schriftliche Realisation und die visuelle Rezeption zusammen mit der quasi Simultanität der Kommunikation, welche es eigentlich nur in medial mündlichen Texten gibt – scheint diese Theorie passend für die Untersuchung dieser Arbeit. Es wird davon ausgegangen, dass digitale Kommunikation, das heißt Foreneinträge, Kommentare, WhatsApp Nachrichten o.ä., aufgrund ihrer Eigenschaften ähnlich wie konzeptionell mündliche Texte analysiert werden können.
Elementar für den Analyseprozess dieser Arbeit ist dabei die im Rahmen der diskurspragmatischen Theorie nach Roth zentrale Sektorenanalyse. Diese „basiert auf der Annahme, dass sich jeder Diskurs aus thematischen Teilaspekten zusammensetzt, die von den Diskursteilnehmern in einer konkreten Interaktionssituation berührt werden können“ (Roth 2018: 376). Mittels einer Sektorenanalyse wird somit ein diskursives Wissen sichtbar, dass in einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zu einem bestimmten Thema gegeben ist. Die Auswahl der Teilaspekte erfolgt dabei jedoch nie zufällig und ist der jeweiligen situativen Bedingung geschuldet. Die Sektorenanalyse hilft dabei, den vorherrschenden Diskurs zu kartieren und die einzelnen Sektoren hinsichtlich dreier Parameter zu kontextualisieren. Es wird empirisch untersucht, wie häufig bestimmte Aspekte eines Sektors von Gesprächsteilnehmern angesprochen werden – dies beschreibt die Zentralität –, wie hoch der interaktive Aufwand ist, d.h. wie häufig findet ein Sprecherwechsel innerhalb des Sektors in Hinblick auf die Gesamtheit der Sprecherwechsel statt – dies beschreibt die Komplexität –, und letztlich, wie früh der Sektor innerhalb der Konversation angesprochen wird – dies beschreibt die Sequentielle Position (vgl. Roth 2018: 376f.).
3. BILD- und ZEIT-Artikel der COVID-19 Pandemie im Zeitraum 12.–22. April 2020
Der Beginn der COVID-19 Pandemie war für Menschen auf der ganzen Welt eine Zeit der Ungewissheit, der ständigen Fragen, der Angst um die Zukunft und vor allem der Angst um die eigene Gesundheit. Welche Emotionen haben Artikel und deren Schlagzeilen zum Ausbruch der COVID-19 Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im täglichen Leben bei der Bevölkerung ausgelöst? Dieser Teil der Arbeit wird sich auf Artikel konzentrieren, welche zu Beginn der Pandemie veröffentlicht wurden.
3.1 ZEIT-Artikel zum Thema „Mund-Nasen-Schutz“

Abb. 1: Artikel 1
Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, gra
22. April 2020, 16:45 Uhr
Deutschlandweite Maskenpflicht
Mund-Nasen-Schutz bald in allen Bundesländern Pflicht
Bislang wurde das Tragen einer Maske nur angeraten, jetzt kommt die Pflicht: Im Nahverkehr gilt sie nächste Woche in allen Bundesländern.
Der erste zu untersuchende Artikel (Abb. 1, Artikel 1) stammt aus einer Onlineausgabe der ZEIT vom 22. April 2020. Der Inhalt des Artikels mit der Schlagzeile „Mund-Nasen-Schutz bald in allen Bundesländern Pflicht“ [1][^ [1] https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/deutschlandweite-maskenpflicht-coronavirus-mundschutz-einzelhandel-oepnv (Stand: 08.06.2021)], kündigt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes in allen Bundesländern an, welche bis dato ausschließlich eine Empfehlung war. Das Substantiv Pflicht, also die von Normen bestimmte Forderung an das Verhalten und Handeln der Menschen, in der Schlagzeile weist auf die Notwendigkeit hin, etwas tun zu müssen. Das Substantiv kann beim Leser ein Gefühl der Bevormundung, des Zwangs, aber auch der Angst, insbesondere durch den Zusammenhang des Wortes Schutz und dem Kontext der Pandemie, hervorrufen. Die Betonung, dass diese Verpflichtung für alle Bundesländer gelten solle, hebt das Ausmaß der Gefahr im Sinne einer Großflächigkeit hervor, welche die Covid-19 Pandemie mit sich bringt. Das Kompositum Mund-Nasen-Schutz ist ein Neologismus, welcher seit Beginn der Pandemie gehäuft Anwendung in der Kommunikation findet. Das Kompositum tritt in der Schlagzeile zusammen mit dem Wort Pflicht auf und lässt so eine Kausalität zwischen Pandemiegeschehen und Maßnahmen zur Eindämmung entstehen. Die Kommentare unter dem Artikel sind überwiegend negativ, wie in folgendem Beispiel deutlich wird.

Abb. 2: Kommentar aus der Zeit-Online
Gelöschter Nutzer 11257
22. April 2020, 17:32 Uhr
Ich lehne das Tragen einer Maske kategorisch ab. Weder bekomme ich als Bafög-Student diesen Spaß bezahlt noch bezweifle dessen Wirkung. Unser Gesundheitsminister hat im Januar in Übereinstimmung aller Virologen erklärt, dass die Maske bei Gesunden nichts bringt. Im März wurde erklärt, dass es nicht einmal genügend Masken für die Krankenhäuser gäbe und nun sollen 83 Millionen Deutsche täglich mehrere Masken verwenden?
Der Kommentator „Gelöschter Nutzer 11257“ ist BAföG-Student. Der erste Teil des Kompositums BAföG-Student ist eine Abkürzung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes [2].[^ [2] https://studienwahl.de/finanzielles/finanzierungsmoeglichkeiten/bafoeg (Stand 08.06.2021)] Es bezeichnet umgangssprachlich eine Person, deren Studium vom Staat teilfinanziert wird. Er ist eindeutig gegen die Verpflichtung, zeigt sich empört und teilt seinen Unwillen mit, was durch Adjektive wie kategorisch unterstrichen wird. Unter Bezugnahme auf die Worte des Gesundheitsministers und der Virologen, dass Masken den Gesunden nicht helfen würden, hinterfragt er selbst deren Wirkung und Hilfe beim Schutz der Gesundheit vor Infektionen. Der Kommentator weist folgend auf die, seiner Meinung nach, nicht ausreichend durchdachte Bekämpfung des Coronavirus hin, da es sogar für Krankenhauspersonal an Masken mangle und trotzdem jeder Bürger verpflichtet sein solle, eine Maske zu tragen (vgl. [1]). Obwohl der Kommentar keine Emojis enthält, werden seine Zweifel und seine Kritik dennoch durch die rhetorische Frage am Ende des Kommentars deutlich. In dem Beitrag sind insbesondere zwei Gefühle hervorzuheben: Erstens der explizit geäußerte Zweifel über die Wirksamkeit der Masken und somit ihre Ablehnung. Darüber hinaus ein implizit mit dem letzten Satz zum Ausdruck gebrachtes Unverständnis gegenüber der Entscheidung der Regierung, dass alle Bürger eine Maske tragen sollen, obwohl in Krankenhäusern Masken knapp sind.
3.2 Sektorenanalyse des ZEIT-Artikels zum Thema „Mund-Nasen-Schutz“
Die Inhalte der einzelnen Sätze des Kommentars und deren Verlauf lassen sich in verschiedene Sektoren einteilen, welche im Folgenden mit Hilfe der Sektorenanalyse veranschaulicht und erklärt werden sollen. Eine Sektorenanalyse dient der Zusammenfassung und Verknüpfung von Kommentarinhalten und wird in der folgenden Arbeit angewandt. Sie zeigt auf, in welchem Zusammenhang die Inhalte von Schlagzeile und Kommentar stehen und inwieweit diese voneinander abweichen (vgl. Pappert, Roth 2016: 56).
Im 1. Sektor [Ablehnung der Maskenpflicht] lässt sich der Inhalt des ersten Kommentarsatzes zusammenfassen. Danach folgen die Inhalte des zweiten, dritten und vierten Satzes im 2. Sektor [persönliche Beweggründe]. Anschließend folgen inhaltlich der 3. [Meinung der Spezialisten] und 4. Sektor [Vergleich der aktuellen Situation mit dem Anfang der Pandemie], welche sich im 5. Sektor [Kritik an Maskenpflicht und seine Ablehnung] zusammenfassen lassen.

Abb. 3: Sektorenanalyse 1
Der 1. Sektor wird durch einen Indikativsatz eingeführt, wohingegen der 2. Sektor durch einen Satz mit einer mehrteiligen Konjunktion weder ... noch ... eingeführt wird. Die beiden Sektoren sind miteinander verbunden, da im zweiten der Grund für die Ablehnung der Maskenpflicht erläutert wird. Der 3. Sektor wird durch einen Hauptsatz im Perfekt und einen Nebensatz mit der Konjunktion dass eingeleitet. Sein Inhalt ist ein weiterer Ablehnungsgrund der Maskenpflicht, mit dem der Kommentator seine Entscheidung unterstützt, sodass der Sektor somit in engem Zusammenhang mit den Sektoren 1 und 2 steht. Der 4. Sektor wird durch einen Hauptsatz im Passiv, ebenfalls durch einen Nebensatz mit der Konjunktion dass und einen weiteren Hauptsatz, der als rhetorische Frage formuliert wurde, eingeleitet. Der gesamte Abschnitt ist ein Vergleich und bezieht sich eindeutig auf den Gegenstand der vorangegangenen Sektoren, wobei gleichzeitig Zweifel am Sinn der verhängten Pflicht geäußert werden. Der fünfte und letzte Sektor ist eine Zusammenfassung aller vier, die in ständiger thematischer Relation zueinander stehen und eine Kritik an der Maskenpflicht zum Ausdruck bringen. Da alle Sektoren in Korrelation zueinander stehen und sich aufeinander beziehen, lässt sich feststellen, dass sie in einer dynamischen Relation zueinander stehen, die durch ihre Verbindungen entsteht.
Nach der inhaltlichen Zusammenfassung lässt sich feststellen, dass die Schlagzeile des Artikels der ZEIT und der beschriebene Kommentar das gleiche Thema ansprechen, welches in diesem und in den meisten anderen Kommentaren kritisiert wurde: Die Maskenpflicht stößt auf Ablehnung und erregt Missfallen bei den Kommentatoren.
3.3 BILD-Artikel zum Thema „Schließung der Bildungseinrichtungen“

Abb. 4: Artikel 2
Von: Annett Conrad und Uwe Freitag
12.03.2020, 19:43 Uhr
Kitas, Schulen, Theater, Kinos
Corona-Krise: Halle macht dicht
Alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt
Der zweite zu untersuchende Artikel (Abb. 4, Artikel 2) stammt aus einer Onlineausgabe der BILD vom 12. März 2020, welcher auf Facebook gestellt wurde und dessen Inhalt die Schließung der Schulen, Kitas und Horte betrifft. In der Schlagzeile „Corona-Krise: Halle macht dicht. Alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt“ [3][^ [3] https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/coronavirus-halle-schliesst-alle-kitas-und-schulen-69351140.bild.html (https://www.facebook.com/bild/posts/10159263785825730) (Stand: 09.06.2021)] löst das Wort Krise beim Leser, durch die dem Wort innewohnende negative Konnotation, vor allem Angst und Beklemmung aus. Halle hat als erste Großstadt in Deutschland alle oben genannten Institutionen geschlossen. Halle wird in diesem Satz als Synekdoche verwendet, bei welcher die Stadt stellvertretend für die Stadtverwaltung genannt wird, welche die Maßnahmen beschlossen hat.

Abb. 5: Kommentar aus der BILD auf Facebook
Laura Ga
13. März 2020, 14:20 Uhr
Traurig das nicht daran gedacht wird wo die Kinder hin sollen wenn Eltern arbeiten müssen. Weil die Großeltern sollen ja auch nicht auf die Kinder aufpassen laut Medien. Das ist so Panikmache alles. 🤷🏽♀️ ohne Worte
Der Kommentar bringt zum Ausdruck, dass sich jemand zu Hause um die Kinder kümmern muss, während die Eltern auf Arbeit sind (vgl. [3]). Der Kommentator „Laura Ga“ weiß nicht, wie er mit dieser Situation umgehen soll, was von seiner Hilflosigkeit und dem Gefühl, im Stich gelassen zu werden, zeugt. Er beschreibt die gesamte Situation und alle Maßnahmen während der COVID-19 Pandemie als Panikmache, welches oft in alltagssprachlichen Kontexten verwendet wird und abwertend konnotiert ist. Seine Ratlosigkeit wird durch das Emoji am Ende der Aussage hervorgehoben [4]. Zum Schluss schreibt er ohne Worte, was als ein Ausdruck von Ratlosigkeit und Ablehnung interpretiert werden kann.
3.4 Sektorenanalyse des BILD-Artikels zum Thema „Schließung der Bildungseinrichtungen“
Der Inhalt des ersten Satzes lässt sich im 1. Sektor [Problem der Kinderbetreuung] zusammenfassen. Daraus folgt der Inhalt des zweiten Satzes im 2. Sektor [Bericht der Medien über die Empfehlung]. Dann folgt der Inhalt des 3. Sektors [Panikstimmung], welcher den 4. Sektor [Ausdruck der Hilflosigkeit] zur Folge hat. Die Satzellipse ist im 5. Sektor [Fehlendes Verständnis für die Situation der Eltern und Verzweiflung] zu verorten.

Abb. 6: Sektorenanalyse 2
Der 1. Sektor wird durch einen langen Satz eingeleitet, der mit dem Adjektiv traurig beginnt, und in dem fälschlicherweise keine Kommata vor den Fragewörtern wo und wenn verwendet werden. Das am Anfang des Satzes verwendete Adjektiv unterstreicht die Reaktion des Kommentierenden auf das vorliegende Problem. Der 2. Sektor, der die Medienempfehlung enthält, beginnt mit der Konjunktion weil, doch obwohl es sich um einen neuen Satz handelt, ist er durch diese Konjunktion inhaltlich eng mit dem ersten Sektor verbunden. Der 3. Sektor wird hingegen durch einen einfachen Satz eingeleitet, der in gewisser Weise eine Zusammenfassung der ersten beiden Sektoren darstellt, sodass sie in Relation zueinander bleiben. Der 4. Sektor wird mit einem Emoji, das eine Figur mit zuckenden Schultern darstellt, eingeführt und enthält eine Satzellipse. Er dient als Antwort auf den dritten Sektor, da der Kommentierende, der ohne Worte schreibt, sich auf Panikmache aus dem vorherigen Sektor bezieht. Der letzte Sektor fasst den Inhalt aller Sektoren zusammen und steht somit in enger Relation zu diesen. Was den Inhalt dieses Kommentars betrifft, entsteht eine dynamische Beziehung zwischen den Sektoren, da jeder aufeinanderfolgende Sektor in einer bestimmten Beziehung zu den vorhergehenden steht, indem er sich thematisch auf sie bezieht. Anhand der inhaltlichen Zusammenfassung lässt sich erkennen, dass die Kommentare mit der Schlagzeile korrelieren, weil die Kommentierenden sich auf die Entscheidung der Stadt Halle, sämtliche Einrichtungen und Veranstaltungen zu schließen, beziehen, indem sie die, ihrer Meinung nach, Sinnlosigkeit dieser Entscheidung zum Ausdruck bringen. Ferner wird auf die Konsequenzen eingegangen, die mit dem in der Schlagzeile genannten Entschluss einhergehen. Durch den Gebrauch von rhetorischen Fragen wollen auch andere Kommentierende zum Nachdenken über ihre Beiträge anregen.
4. BILD-Artikel zur Lage der COVID-19 Pandemie im Zeitraum März und Juni 2021
Die 2019 ausgebrochene COVID-19 Pandemie zählt auch 2021 noch zu den am häufigsten in den digitalen und analogen Medien diskutierten Themen in Deutschland und weltweit. Auf Social-Media-Plattformen oder in Zeitungen werden täglich Artikel zum Pandemiegeschehen und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen veröffentlicht. Im Folgenden soll auf einen Artikel (Abb. 7, Artikel 3) der BILD-Zeitung eingegangen werden, welcher im März 2021 über Schutzmaßnahmen in Form des Lockdowns in Deutschland berichtet. Die Reaktionen sowie eine eventuelle Beeinflussung der Leserschaft durch die provozierenden Schlagzeilen der BILD-Zeitung werden anhand der Kommentare auf der Social-Media-Plattform Facebook analysiert.

Abb. 7: Artikel 3
Von: Lydia Rosenfelder, Ralf Schuler und Peter Tiede
30.03.2021, 15:00 Uhr
Verschärfte Corona-Maßnahmen
Will Merkel jetzt die ganze Macht?
Mega-Lockdown notfalls durch neues Gesetz ++ Wer dagegen Lockerungen will
Die Kanzlerin will die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärfen, verlangt einen Mega-Lockdown!
Der Artikel macht mit roten Majuskeln und fett gedruckter Überschrift auf sich aufmerksam: „VERSCHÄRFTE CORONA-MASSNAHMEN – Will Merkel jetzt die ganze Macht? – Mega-Lockdown notfalls durch neues Gesetz ++ Wer dagegen Lockerungen will“ [5].[^ [5] https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/verschaerfte-corona-massnahmen-will-merkel-jetzt-die-ganze-macht-75903708.bild.html (https://www.facebook.com/bild/posts/10160531791765730) (Stand: 02.06.2021)] Ergänzt wird die Schlagzeile durch die Subline „Die Kanzlerin will die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärfen, verlangt einen Mega-Lockdown!“ [5]. Veröffentlicht wurde der Artikel am 29. März 2021 von den BILD-Journalisten Lydia Rosenfelder, Ralf Schuler und Peter Tiede („Chefreporter Politik BILD GmbH & Co. KG“ [6]),[^ [6] https://de.linkedin.com/in/peter-tiede-935b96b6 (Stand: 02.06.2021)] welche bereits zuvor Artikel zur COVID-19 Pandemie veröffentlichten. Auffällig ist vor allem die hohe Reichweite des Facebook-Beitrags, dieser wurde 2.663 Mal mit „gefällt mir“ markiert, 240 Mal geteilt und 1.989 Mal kommentiert (Stand 02.06.2021) (vgl. [5]).
4.1 BILD-Artikel zum Thema „Mega-Lockdown“
Die Schlagzeile des Artikels könnte gezielt zur Beeinflussung der Emotionen von BILD-Leser:innen konstruiert worden sein, da die BILD als Boulevardzeitung dafür bekannt ist und somit das Ziel verfolgt, Unterhaltung durch Provokation und Sensation zu generieren (vgl. [7]).[^ [7] https://www.sueddeutsche.de/thema/Bild-Zeitung (Stand 02.06.2021)] Das in roten Versalien hervorgehobene Wort verschärfte könnte bei der Leserschaft ein negatives Gefühl der Bedrohung und Beengung auslösen, da die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen der Bevölkerung offensichtlich noch einmal verstärkt werden sollen. Zudem wird mit der Frage, ob die Bundeskanzlerin Angela „[…] Merkel jetzt die ganze Macht […]“ [5] Deutschlands für sich gewinnen wolle, eine indirekte Frage provoziert. Lesende könnten sich dadurch von einem Szenario bedroht fühlen, welches sie sich vor dem Lesen dieses Artikels nicht vorgestellt hätten. Fortgesetzt wird die Strategie der bewussten Beeinflussung durch die Verwendung des Adjektivs mega in der Hyperbel Mega-Lockdown und der Eventualität eines neuen Gesetzes zur Verschärfung der Schutzmaßnahmen und die damit einhergehenden Einschränkungen für die Bevölkerung. Das Einflussvermögen dieser Schlagzeile lässt sich in den Kommentaren unter dem Facebook-Artikel gut erkennen. Im Anschluss soll ein solcher Kommentar genauer untersucht werden; auch soll auf die Verwendung von Alltagssprache eingegangen werden.

Abb. 8: Kommentar aus der BILD-Zeitung auf Facebook
Natalia Schneider
30.03.2021, 12:24 Uhr
Wo sollen die Kontakte noch verschärft werden??? Dass man sich mit gar keinem mehr treffen darf?? Und wohin sollte man nach 21 ausgehen wenn eh alles zu und verboten ist? 🙈 fällt den da sonst nix mehr ein ?
Der Kommentar des Lesers „Natalia Saul“ mit Facebook-Account fällt durch seine hohe Anzahl an Likes auf. 261 Nutzer der Social-Media-Plattform können sich offenbar mit ihrer Aussage identifizieren oder liken diese. Zudem wurde 22 Mal von anderen Nutzern auf den Kommentar geantwortet (vgl. [5]). Die Verzweiflung und Verärgerung des Lesers macht sich bereits im ersten Satz bemerkbar. „Wo sollen die Kontakte noch verschärft werden???“ (vgl. [5]) wird die Bundeskanzlerin, die Leserschaft oder die Allgemeinheit gefragt und die Frage mit drei Fragezeichen abgeschlossen, um deren Dringlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Mit dem Fragewort Wo erkundigt sich der Kommentator, in welchen Bereichen weitere Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Er setzt voraus, dass seine Aussage so verstanden wird. Im Idealfall hätte allerdings das Fragewort Wie gebraucht werden müssen. Mit der Verwechslung von Wo und Wie wird die Verwendung von Alltagssprache deutlich und es lässt sich vermuten, dass der Kommentar aus dem Affekt verfasst wurde.
Es folgen drei weitere Fragesätze, welche bevorstehende und erweiterte Schutzmaßnahmen thematisieren. Somit besteht der Kommentar ausschließlich aus Fragen, welche teilweise rhetorischer Natur sind und keine direkte Antwort benötigen. Der Kommentator kann stellvertretend für einen Teil der ratlosen und verwunderten Bevölkerung angesehen werden – dies bestätigen auch die vielen Likes zu dem Kommentar. Reagiert wird auf einen verschärften Lockdown und die damit verbundenen weiteren Einschränkungen für die Bevölkerung. Der Kommentator ist offenbar über die Kontaktbeschränkungen verärgert und fragt, wie diese noch weiter verschärft werden sollten, und ob „[…] man sich mit gar keinem mehr treffen darf??“ [5]. Auch diese Frage wird mit zwei Fragezeichen abgeschlossen und somit eine diesbezügliche Verwunderung betont. Auffällig ist der unvollständige Satzbau: „Dass man sich mit gar keinem mehr treffen darf […]“ [5] ist keine Frage, sondern ein Nebensatz, welcher hier nicht durch einen Hauptsatz ergänzt, sondern durch zwei Fragezeichen abgeschlossen wird. Zudem geht der Kommentator davon aus, dass die Lesenden des Kommentars wissen, dass mit „[…] gar keinem […]“ „[…] gar keine[] [Menschen, E.D.] […]“ gemeint sind. Die Verwendung von Alltagssprache wird auch in diesem Satz deutlich.
Im dritten Satz kritisiert der Nutzer „Natalia Saul“ zudem die Ausgangssperre nach 21 Uhr, während der „[…] eh alles zu und verboten ist […]“ [5]. Der Nutzer fragt, wohin man überhaupt gehen solle, da man sich ohnehin während der Sperrstunde mit niemandem treffen könne. Nach der Angabe der Zeit erfolgt kein „Uhr“; der Kommentator nennt ausschließlich die Zahl und geht davon aus, verstanden zu werden. Abgeschlossen wird der Fragesatz mit einem Emoji, welches einen Affen mit zugehaltenen Augen abbildet [vgl. 5]. Womöglich möchte der Kommentator mit diesem Symbol seine Verzweiflung zum Ausdruck bringen; das Emoji erinnert an die Gestik des entsetzten Hände-über-dem-Kopf-Zusammenschlagens. Beendet wird der Beitrag mit der Frage: „[F]ällt den da sonst nix mehr ein ?“ [5], mit welcher Wut und Abneigung gegenüber der Politik und den immer verschärfteren Lockdown ausgedrückt wird. Mit der Kurzform den für denen soll vermutlich die Regierung bzw. Angela Merkel im Speziellen gemeint sein. Durch die Verwendung der Kurzform nix für nichts wird erneut die alltagssprachliche und eventuell dialektal gefärbte Schreibweise des Kommentators deutlich. Zudem lässt sich vor dem letzten Fragezeichen ein überflüssiges Leerzeichen erkennen, was beispielsweise unbeabsichtigt durch zu schnelles Tippen entstehen kann.
4.2 Sektorenanalyse des BILD-Artikels zum Thema „Mega-Lockdown“
Zur inhaltlichen Zusammenfassung und Analyse der Satzzusammenhänge wird im Folgenden die bereits vorgestellte Sektorenanalyse durchgeführt: Der inhaltliche Kern des ersten Kommentarsatzes lässt sich im Sektor 1 [verschärfte Kontaktbeschränkungen] zusammenfassen. Daran schließen sich die gebündelten Inhalte des zweiten Satzes in Form des 2. Sektors an [komplettes Kontaktverbot]. Anschließend folgen die Inhalte des dritten Satzes, die im 3. Sektor zusammengefasst werden [Ausgangssperre]. Dieser hat den 4. Sektor [allgemeine Verbote] und den 5. Sektor [Freiheits- und Möglichkeitsentzug] zur Folge. Der letzte Satz des Kommentars lässt sich inhaltlich im 6. Sektor [Einschränkung / Bestrafung von „oben“] zusammenfassen.

Abb. 9: Sektorenanalyse 3
Die einzelnen Sektoren bauen aufeinander auf und stehen in einem linearen Zusammenhang. In den Sektoren 1 und 2 wird vom Spezifischen auf das Allgemeine geschlossen, wohingegen die Sektoren 3, 4 und 5 umgekehrt vom Allgemeinen auf das Spezifische zielen. So sorgt der Kommentator für einen dynamischen Text und drückt seine Verzweiflung sowohl im Hinblick auf die Zukunft, als auch rückblickend aus. Der letzte Satz bildet neben einem eigenen Sektor eine inhaltliche Zusammenfassung des gesamten Kommentars und bezieht sich auf jeden einzelnen Sektor. Alle Sätze und somit auch alle Sektoren hängen direkt oder indirekt zusammen, wodurch sich trotz anfänglichem Durcheinander eine klare inhaltliche Linie des Kommentars erschließen lässt.
Anhand der inhaltlichen Zusammenfassung lässt sich erkennen, dass die Schlagzeile des BILD-Artikels zu etwaigen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen viel Spielraum für Eigeninterpretationen seitens der Leserschaft offenlässt, diese jedoch überwiegend negativ beeinflusst wird und die Schlagzeile so für einen verstärkten Pessimismus sorgt.
5. ZEIT-Artikel zur Lage der COVID-19 Pandemie im Mai 2021
5.1 ZEIT-Artikel zum Thema „Impfprivilegien“
Zur Eindämmung Covid-19 wurden und werden weltweit zahlreiche gesundheitspolitische Gegenmaßnahmen getroffen, welche unter anderem die sozialen Kontakte stark einschränken. Die Ungewissheit, wann die Covid-19 Pandemie ein mögliches Ende nehmen wird und wann Lockerungen stattfinden werden, wird auch in der Zeitung DIE ZEIT thematisiert. Welche Emotionen die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen und die damit verbundenen neuen Regelungen im täglichen Leben der aktuellen Pandemiesituation bei den Menschen ausgelöst haben, soll im Folgenden untersucht werden.

Abb. 10: Artikel 4
Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, lh, kg
Aktualisiert am 9. Mai 2021, 11:57 Uhr
Corona-Lockerungen: Was Geimpfte und Genesene jetzt wieder dürfen – und beachten müssen
Wer vollständig geimpft oder von Corona genesen ist, darf nun wieder mehr Menschen treffen und muss Ausgangssperren nicht länger einhalten. Die Maskenpflicht aber bleibt.
Der zu untersuchende Artikel (Abb. 10, Artikel 4) stammt aus der Online-Zeitung Zeit-Online und wurde am 09. Mai 2021 veröffentlich. Der Inhalt des Artikels mit der Schlagzeile „Was Geimpfte und Genesene jetzt wieder dürfen- und beachten müssen“ [8],[^ [8] https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-05/corona-lockerungen-geimpfte-genese-ausgangssperre-grundrecht (Stand: 07.06.2021)] thematisiert neue Corona-Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland. Der Untertitel „Wer vollständig geimpft oder von Corona genesen ist, darf nun wieder mehr Menschen treffen und muss Ausgangssperren nicht länger einhalten. Die Maskenpflicht aber bleibt“ [8], verrät ein wenig mehr über den Inhalt und regt eine Vielzahl von Menschen zum Kommentieren des Artikels an. Auffällig in der Überschrift ist, dass der Verfasser des Artikels die Lesenden über neue politische Entscheidungen zum Corona-Virus und die damit verbundene bestehende Maskenpflicht aufklären möchte.

Abb. 11: Kommentar aus der Zeit-Online
mapawi
9. Mai 2021 um 13:31 Uhr
"Wer täuscht, fliegt schneller auf, als er denkt, und riskiert ein Strafverfahren."
Na, da sind wir ja mal gespannt, ob irgendwelche Billiglohn-Security-Bengel, Pizzabäcker oder Verlaufsberater im Möbelhaus erkennen können (und wollen), ob ein Impfausweis gefälscht ist.
Dass die Nutzer damit nicht am Flughafen auftauchen sollten, dürfte fast jedem klar sein. Aber für den normalen Alltag wird vielen auch ein Fakeausweis reichen, ist zu vermuten, denn mehr als ein schneller Blick auf dem Impfaufkleber dürfte bei der Masse an täglich zu kontrollierenden sowieso nicht geschehen.
Den Kommentaren unter dem Artikel lässt sich entnehmen, dass eine Diversität zwischen den Meinungen der Kommentierenden herrscht. Neben skeptischen bzw. Corona-Virus verleugnenden Kommentaren lassen sich auch Kommentare von Lesern erkennen, die mit Erleichterung auf die neuen Lockerungen der Schutzmaßnahmen reagieren. Der Kommentar des Verfassers mit dem geschlechtsneutralen Nutzernamen „mawapi“ soll nun genauer untersucht und im Hinblick auf die Alltagssprache analysiert werden.
Zunächst fällt auf, dass der Kommentar mit 10 Sternen bewertet wurde (vgl. [8]). Dies bedeutet, dass der Kommentar 10 weiteren Personen gefällt oder diese gegebenenfalls die gleiche Meinung teilen. Dem Kommentar ist zu entnehmen, dass der Verfasser einen Satz aus dem Artikel zitiert und darauf Bezug nimmt: „Wer täuscht, fliegt schneller auf, als er denkt, und riskiert ein Strafverfahren.“ [8]. Dies bezieht sich auf den Nachweis der Covid-19 Impfung im Impfpass. Jedoch erscheint diese Mitteilung für den Verfasser des Kommentars unglaubhaft. Ausgedrückt wird dies, indem er schreibt: „Na, da sind wir ja mal gespannt, ob irgendwelche Billiglohn-Security-Bengel, Pizzabäcker oder Verlaufsberater [sic!] im Möbelhaus erkennen können (und wollen), ob ein Impfausweis gefälscht ist.“ [8]. Weiterhin lässt sich sagen, dass sich die Skepsis des Verfassers dadurch bemerkbar macht, da dieser ironisch wird. Seiner Auffassung nach sind „Billiglohn-Security-Bengel“, Pizzabäcker oder Verkaufsberater im Möbelhaus nicht qualifiziert genug, um einen Nachweis der Covid-19 Impfung im Impfpass zu erkennen. Darüber hinaus zweifelt er an dem Interesse der Arbeitnehmer und -geber, einen Impfnachweis gezielt zu überprüfen. Auffällig wird in diesem Satz außerdem, dass der Verfasser Ordnungs- und Sicherheitsangestellte degradiert, indem er das Wort Billiglohn-Security-Bengel verwendet. Eine gewisse Kritik am gesetzlichen Mindestlohn wird erkennbar, da der Kommentierende mit dem Begriff Billiglohn auf die Vergütung der Arbeitnehmer im Ordnungs- und Sicherheitsdienst anspielt. Eine Bewertung dieser Arbeitnehmer wird vorgenommen, in dem sie als Bengel beschrieben werden; dies könnte von persönlichen negativen Erfahrungen herrühren. Besonders hervorzuheben ist ebenfalls, dass der Verfasser aus der Wir-Perspektive schreibt. Somit gewinnt er das Vertrauen der Leserschaft. Das Personalpronomen wir vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft und kann dahingehend interpretiert werden, dass der Verfasser überzeugt davon ist, nicht der einzige zu sein, der diese Meinung hat. Diese Annahme lässt sich untermauern, da der Beitrag, wie bereits erwähnt, von 10 weiteren Personen mit einem Stern markiert wurde.
Mit den nächsten Sätzen „Dass die Nutzer damit nicht am Flughafen auftauchen sollten, dürfte jedem klar sein. Aber für den normalen Alltag wird vielen auch ein Fakeausweis reichen, ist zu vermuten, denn mehr als ein schneller Blick auf dem Impfaufkleber dürfte bei der Masse an täglich zu kontrollierenden sowieso nicht geschehen.“ [8], wird die Skepsis an der ordnungsgemäßen Kontrollen der Covid-19-Impfungen erneut dargestellt. Der Kommentator ist sich sicher, dass die Fakeausweise mit den eingetragenen Nachweisen der Covid-19-Impfung nicht am Flughafen benutzt werden, sondern im alltäglichen Leben. Er möchte auf die Ernsthaftigkeit des Themas aufmerksam machen, indem er mit diesem Beispiel die Sachlage darstellt. Zudem schätzt der Kommentator seine Mitmenschen intelligent genug ein, um gefälschte Impfausweise nicht an Flughäfen zu nutzen. Hier verallgemeinert er und geht davon aus, dass Fluggäste nicht das Risiko eingehen werden, einen Dokumentenmissbrauch durchzuführen. Im darauffolgenden Satz wird erwähnt, dass die gewissenhafte, kritische Kontrolle der Impfpässe nicht gewährleistet werden kann. Der Verfasser bringt mit seinem Kommentar indirekt Kritik gegenüber der Corona-Politik zum Ausdruck. Aus seiner Perspektive ist die Kontrolle über erhaltene Covid-19-Impfungen nicht realisierbar, da weder Kontrolleure wie beispielsweise die „Billiglohn-Security-Bengel“ qualifiziert genug sind, die Kontrollen ordnungsgemäß durchzuführen, noch die Zeit im Alltag dafür reicht [vgl. 8]. Zur Schriftsprache lässt sich sagen, dass bis auf die Abwertung der Ordnungs- und Sicherheitsdienstarbeiter sehr sachlich geschrieben wurde. Satzzeichen und die aktuelle Rechtschreibung wurden größtenteils berücksichtigt. Es ist festzustellen, dass der Kommentar eine eindeutige Stellung zum Nachweis der Covid-19 Impfung liefert.
5.2 Sektorenanalyse des ZEIT-Artikels zum Thema „Impfprivilegien“
Die Inhalte der einzelnen Sätze des Kommentars und deren Verlauf lassen sich außerdem in verschiedene Sektoren einteilen. Der Inhalt des ersten Satzes lässt sich in Sektor 1 einordnen [Strafverfahren nach Täuschung], welcher zwar zuerst genannt wird, allerdings als inhaltliches Resultat des Kommentars gilt. Dem 2. Sektor lässt sich der nächste Satz zuordnen [(Nicht-)Erkennen von Täuschungen]. Darauf folgt inhaltlich im nächsten Satz Sektor 3 [Täuschungen nicht an Flughäfen]. Abschließend lässt sich zu Sektor 4 [Täuschungen im Alltag ] und Sektor 5 [Freiheits- und Möglichkeitsentzug] der letzte Satz zuordnen (vgl. Pappert, Roth 2016: 56). Anhand der einzelnen Sektoren lässt sich eine Steigerung erkennen. Der Verfasser zeigt mögliche Konsequenzen auf, welche im Falle eines erkannten Täuschungsversuchs mit gefälschtem Impfpass am Flughafen einträten. Die Besorgnis wird somit deutlich und die Problemlage verschärft sich.

Abb. 12: Sektorenanalyse 4
Abschließend lässt sich sagen, dass die Positionierung des Verfassers sehr deutlich wird. Die einfache Sprache ermöglicht der Leserschaft den Zugang zur Nachricht. Das Problem, welches der Verfasser anspricht, ist bedeutend, denn es betrifft das Wohlergehen der Bevölkerung. Durch seine extremen Beispiele und der ironischen Art wirkt der Verfasser sehr ernst und kritisierend. Mit dem Personalpronomen wir konnte er Nähe zur Leserschaft aufbauen. Es erzeugt eine Verbindung zur Leserschaft und konstituiert eine kritische Denkweise.
6. Fazit
Anhand der vorliegenden Analyse der verschiedenen Schlagzeilen und Kommentare der beiden Medien DIE ZEIT und BILD ergibt sich ein recht deutliches Bild bezüglich der journalistischen Qualität der Schlagzeilen sowie des Inhalts der Kommentare. Dabei fällt bei der Sektorenanalyse auf, dass die zeitlichen Unterschiede (April 2020 bzw. März und Juni 2021) nicht sehr gravierend sind. Es lässt sich von Beginn der Covid-19-Pandemie an bis zur aktuellen Pandemielage auf der Basis unserer Daten keine Zunahme an Kommentaren verordnen, welche kritisch zum dargebotenen Problem stehen. Auch wurde kein Anstieg an emotionalen Schlagzeilen vermerkt. Dafür änderte sich der Fokus ausgehend von der Pandemielage mit Infizierten- bzw. Todeszahlen hin zu Corona-Schutzmaßnahmen und Impffortschritten. Somit waren dynamische Veränderungen weniger auf der emotionalen Ebene als vielmehr auf der inhaltlichen Ebene erkennbar.
Große Unterschiede waren zwischen den jeweiligen Medien zu erkennen. So zeichneten sich die Schlagzeilen der ZEIT vor allem durch ihre nüchterne, fakten-basierte und sachliche Art aus, welche die Inhalte der Artikel stets gut zusammenfassten. Die Kommentare der Leserschaft waren sachlich, wenn auch teils kritisch formuliert. Sie bezogen sich direkt auf die Inhalte der Artikel und deren Schlagzeilen, sie wiesen eine gehobenere Sprache auf, bei der es sowohl zu weniger grammatikalischen und lexikalischen Fehlern kam. Auch wurde weniger emotional kommuniziert. Wurden Emotionen in den Kommentaren zum Ausdruck gebracht, geschah dies vermehrt durch sarkastische Formulierungen, häufig in Verbindung mit rhetorischen Fragen, wie zum Beispiel: „Im März wurde erklärt, dass es nicht einmal genügend Masken für die Krankenhäuser gäbe und nun sollen 83 Millionen Deutsche täglich mehrere Masken verwenden?“ [1]. Die am häufigsten ausgedrückten Emotionen waren dabei Unverständnis, Zweifel oder Ratlosigkeit. Auffallend im Kommentarforum der ZEIT war die, im Vergleich zu den Kommentarsektionen der BILD auf Facebook, geringere Interaktion der Lesenden in Form von Folgekommentaren oder Likes. Unklar ist hier, ob dies mit dem Konsumverhalten der Lesenden, dem Zugang zu den Kommentarbereichen oder der Nutzeranzahl der jeweiligen Onlinepräsenzen in Korrelation steht.
Im Vergleich dazu kam es in der Kommentarsektion der BILD zu einer höheren Interaktion der Lesenden. Dies könnte im Zusammenhang mit deren reißerischen, teils spekulativen und emotionalen Schlagzeilen stehen. Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass die Schlagzeilen der BILD weniger nüchtern und faktisch sind als die der ZEIT. Dies wird durch das Verwenden von Wörtern wie Krise oder Phrasen wie Halle macht dicht [3], welche Angst und ein Gefühl des Gefangen-seins vermitteln können, deutlich. Die Kommentare unter den Artikeln des Facebook-Beitrags der BILD waren im Vergleich zu denen der ZEIT losgelöster von den Schlagzeilen, was durch die Sektorenanalyse bestätigt werden konnte. Sie waren kürzer in ihrem Umfang und verstärkt emotional verfasst, was durch rhetorische Fragen, Polemik, aber vor allem durch das Verwenden von Emojis zum Ausdruck gebracht wurde. Neben der häufig auftretenden Unsicherheit zeigten sich viele der Kommentierenden wütend, niedergeschlagen oder verzweifelt. Dies wurde oftmals durch die thematische Verbindung der Corona-Schutzmaßnahmen mit Gewerbetreibenden oder Kindern und Jugendlichen ausgedrückt. Auch fanden sich in diesen Kommentaren vermehrt alltagssprachliche Formulierungen und dialektale Färbungen, wie zum Beispiel die Verwendung von nix statt nichts sowie grammatikalische und lexikalische Fehler.
Fortführend wäre eine ausgeweitete Untersuchung des Kommentarverhaltens der Lesenden, vor allem in Hinblick auf die quantitativen und qualitativen Unterschiede zwischen den beiden Zeitungen, interessant.
- Fandrych, Christian & Thurmair, Maria (2011): Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg.
- Lanwer, Jens Philipp (2015): Regionale Alltagssprache. Theorie, Methodologie und Empirie einer gebrauchsbasierten Areallinguistik. In: Imo, W. & Spieß, C. (Hrsg.). Empirische Linguistik / Empirical Linguistics. (Band 4) Berlin: De Gruyter.
- Mroczynski, Robert (2014): Gesprächslinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Pappert, Steffen / Roth, Kersten Sven (2016): Diskursrealisation in Online-Foren. In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik: De Gruyter Mouton.
- Roth, Kersten Sven (2018): Diskurs und Interaktion. In: Ingo H. Warnke (Hg.): Handbuch Diskurs (Handbuch Sprachwissen. 6). Berlin, New York, S. 363–387.
- Schwarz-Friese, Monika (2013): Sprache und Emotion (2. Auflage). Tübingen: A. Francke Verlag.
- [1] https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/deutschlandweite-maskenpflicht-coronavirus-mundschutz-einzelhandel-oepnv (Stand: 08.06.2021)
- [2] https://studienwahl.de/finanzielles/finanzierungsmoeglichkeiten/bafoeg (Stand 08.06.2021)
- [3] https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/coronavirus-halle-schliesst-alle-kitas-und-schulen-69351140.bild.html (https://www.facebook.com/bild/posts/10159263785825730) (Stand: 09.06.2021)
- [4] https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/coronavirus-halle-schliesst-alle-kitas-und-schulen-69351140.bild.html (https://www.facebook.com/bild/posts/10159263785825730) (Stand: 09.06.2021)
- [5] https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/verschaerfte-corona-massnahmen-will-merkel-jetzt-die-ganze-macht-75903708.bild.html (https://www.facebook.com/bild/posts/10160531791765730) (Stand: 02.06.2021)
- [6] https://de.linkedin.com/in/peter-tiede-935b96b6 (Stand: 02.06.2021)
- [7] https://www.sueddeutsche.de/thema/Bild-Zeitung (Stand 02.06.2021)
- [8] https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-05/corona-lockerungen-geimpfte-genese-ausgangssperre-grundrecht (Stand: 07.06.2021)
Beitrag 11
Wandel der Impfbereitschaft Deutschsprachiger anhand der Kommunikation in Onlineforen
1. Einleitung
Nach einem Jahr seit Aufkommen des Coronavirus scheint der Impfstoff ein Lichtblick am Ende des Tunnels zu sein. Der deutsche Gesundheitsminister beschreibt die Wichtigkeit dessen für die vorherrschende Corona-Pandemie mit folgenden Worten: „Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Es ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können.” [1]. Wie hoch ist tatsächlich die Impfbereitschaft der deutschen Bevölkerung? Diese Fragestellung soll durch Einbezug von diskurspragmatischen Analysepunkten sowie einer invektiven Kommunikationsanalyse beantwortet werden. Dabei werden Gesprächsbeiträge aus Online-Foren herangezogen. Um einen zeitlichen Vergleich transparent zu machen, betrachten wir die Foreneinträge zu zwei Artikeln auf Zeit Online, welche am 25.12.2020 und am 21.05.2021 veröffentlicht wurden. Vor dem Hintergrund der Textdynamik wird untersucht, inwiefern sich die Impfbereitschaft der Deutschen gewandelt hat.
Die Analyse soll anhand folgender diskurspragmatischer Schwerpunkte erfolgen: Sektorenanalyse, Aussagenanalyse und Handlungsanalyse. Hierbei bildet die Sektorenanalyse den Ausgangspunkt für die weiterführende Aussagen- sowie Handlungsanalyse. Außerdem werden die Emotionen der Deutschen mithilfe der Frameanalyse anhand der invektiven Kommunikation in den Online-Diskussionen dargestellt. Zunächst werden die einzelnen Analysepunkte theoretisch vorgestellt, um diese im Anschluss praktisch auf ausgewählte Online-Kommentare anzuwenden. Für die erste Analyse wird Literatur von Pappert / Roth (2016) und Roth (2019) verwendet. Für die darauffolgende Analyse von Emotionen wird Literatur zu Emotionen von Ellerbrock u.a. (2017), Fillmore (1982), Fries (1996), Tokarski (2006) und framesemantische Ressourcen: FrameNet, German FrameNet und German Frame-Semantic Online Lexicon herangezogen. Im abschließenden Fazit werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen. Außerdem wird ein weiterführender Ausblick gegeben.
2. Interaktional-pragmatische Analyse
2.1 Diskurspragmatische Theorie nach Pappert/Roth
2.1 Diskurspragmatische Theorie nach Pappert/Roth
Die nachfolgenden Gliederungspunkte beziehen sich auf die diskurspragmatische Analyse, welche als Teilbereich der Diskurssemantik zuzuordnen ist. Diese Form der Analyse untersucht gesellschaftliches Wissen anhand realisierter Aussagen in konkreten Texten. Dieses Wissen ergibt sich aus Diskursen. Darunter versteht man:
die Auseinandersetzung mit einem Thema durch größere gesellschaftliche Gruppen [...], die sich in Texten unterschiedlicher Art niederschlägt, dabei nicht nur die Einstellungen der am Diskurs Beteiligten spiegelt, sondern zugleich handlungsleitend für den zukünftigen Umgang mit dem thematisierten Gegenstand ist.
(Gardt 2007: 30)
Demnach werden komplexe Systeme von kollektivem Wissen rekonstruiert. Zur Untersuchung dessen wird realisierte Sprache analysiert, unter anderem durch die Betrachtung zentraler Metaphern, Lexeme sowie Textformen und Phraseologismen. Diskurslinguistische Ausführungen zeigen, dass Aspekte gesellschaftlichen Wissens zu einem bestimmten Thema und deren kennzeichnenden Versprachlichungen in ausführlichen Verfahren dargelegt werden. Dabei werden unumgänglich nahezu alle kommunikativ-pragmatischen Bedingungen, unter denen die untersuchten Aussagen des Diskurswissens verwirklicht wurden, verallgemeinert. Die diskurspragmatische Analyse nach Roth (2019) beschreibt konkrete pragmatische Bedingungen, unter Beachtung der sprachlichen Umsetzung einer Aussage im Diskurs, die sogenannte Diskursrealisation. Dabei erfolgen diskurspragmatische Interpretationen von Aussagen auf Grundlage dieser pragmatischen Bedingungen. Demnach wird in einem festgelegten Korpus folgende Frage untersucht: Warum wird eine bestimmte Aussage in ihrer sprachlichen Form unter genau denjenigen pragmatischen Bedingungen verwirklicht? Damit beinhalten Diskurse des kollektiven Wissens Sprachhandlungen von Sprecher:innen unter konkreten Bedingungen, welche unter einer gewissen Zielsetzung in bestimmten Kontexten realisiert werden. Weiterhin werden derartige Diskurse von interaktionalen Konstruktionen gekennzeichnet, da Sprachhandlungen nicht isoliert voneinander erfolgen, sondern mit anderen Äußerungen zusammenhängen, auch wenn dies nicht immer konkret sichtbar ist (vgl. Roth 2019: 40–41).
2.2 Sektorenanalyse
Sektoren sind subthematische Aspekte von unterschiedlicher Komplexität und Relevanz, die den Diskurs insgesamt thematisch konstituieren. Jeder Diskurs setzt sich aus thematischen Teilaspekten zusammen, welche in der Interaktion berührt werden können. Die relevante Frage ist: „Worüber wird im Korpus gesprochen?“ Laut Roth kann ein Sektor deduktiv, induktiv, in evaluativer, abstrahierender, isolierter Form, oder mit absoluter, interaktiv hergestellter Akzeptanz eingeführt werden (vgl. Roth 2019: 377). Bei einer deduktiven Einführung eines Sektors wird zunächst ein Schlagwort eingeführt, welches dann kooperativ semantisch gefüllt werden muss. Wird ein Sektor induktiv eingeführt, werden erst semantische Operationen vorgestellt und danach wird er bezeichnet. Bei der absoluten / interaktiv hergestellten Akzeptanz wird die Relevanz und der diskurspragmatische Gehalt des Sektors von anderen Interaktanten mit Signalen der Verstehensdokumentation akzeptiert oder nicht. In evaluativer Form wird der Sektor in Verbindung mit expliziten oder impliziten Mitteln der Wertung eingeführt. Bei einer Einführung in abstrahierender Form wird Bezug auf eigenes Erleben und subjektiv erworbenes Wissen genommen (personalisierte Form). Ein isoliert eingeführter Sektor hat keinen semantischen Bezug auf den vorausgehenden sequentiellen Verlauf. Dies geschieht meist nach Gesprächspausen oder Themenwechseln (vgl. Roth 2019: 377).
Außerdem können Sektoren auf unterschiedliche Weise verknüpft werden. Durch Extension, Reduktion, Kombination und Shift können Sektoren miteinander verbunden werden (vgl. Roth 2019: 378). Bei einem Wechsel von einem Sektor auf einen thematisch allgemeineren, liegt eine Extension vor. Ein Wechsel auf einen thematisch spezifischeren Sektor hingegen nennt sich Reduktion. Bei einer Kombination gibt es zwar semantische Bezüge zwischen den Sektoren, aber sie sind einander weder unter- noch übergeordnet. Durch eine Verschiebung (Shift) wird der bisherige semantische Status geändert. Die Analyse solcher Verknüpfungen kann Aufschlüsse über die Verhältnisse verschiedener Sektoren innerhalb der Strukturen des Diskurswissens einer gegebenen Diskursgemeinschaft zueinander verschaffen (vgl. Roth 2019: 374–379). Im Folgenden soll analysiert werden, welche subthematischen Sektoren in den Kommentaren der beiden Artikel sichtbar werden. Begonnen wird dabei mit dem Artikel Zwei Drittel der Deutschen wollen sich gegen Corona impfen lassen vom 25. Dezember 2020 [7].
Ausgangspunkt ist folgende Aussage des Users „Klaunwelt2020_06“, der mit der Aussage einen ersten großen Beitrag zur Impfbereitschaft leistet.

Klaunwelt2020_06
25. Dezember 2020 um 08:31 Uhr
Angst, Besorgnis, Bedenken, Zurückhaltung - unterschiedliche Eskalationsstufen. Manchmal, wenn ich in den Medien von "Angst" lese, würde ich gerne die Frage sehen. Haben so viele Leute wirklich Angst - Schweißausbrüche, schlaflose Nächte, Tränen - oder fasst diese eine Aussage alle zusammen, die nicht uneingeschränkt "ja und jetzt" gesagt haben?
Bedenken, weil es ein neues Medikament ist, Besorgnis, eine allergische Reaktion zu haben, Zurückhaltung, bis die erste Million sicher geimpft wurde - alles verständlich. Aber Angst, echte Angst? Da würde ich doch gerne mal auch Gründe hören.
Mit dem Beitrag wird ein Sektor zur Angst vor den Impfungen eröffnet. Es sollen Gründe genannt werden, warum so viele Leute Angst vor der Corona-Impfung haben.
Ist die Angst gerechtfertigt? Eine erste unmittelbare Replik hierauf leistet der bereits gelöschte User „GelöschterNutzer11481“:

Gelöschter Nutzer 11481
25. Dezember 2020 um 08:37 Uhr
Ich habe keine Angst vor den Nebenwirkungen, ich habe lediglich Angst davor zu spät dranzukommen und dann nicht auf die aufgeschobenen Konzerte gehen zu können, wenn der Veranstalter einen Impfnachweis vordert.
Der User antwortet im Verknüpfungsmodus der Extension, dass er keine Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung hat und eröffnet einen neuen subthematischen Sektor, indem es um Gründe für eine Impfung, im speziellen um die Angst vor einer zu späten Impfung geht.
Dadurch wird nicht weiter auf den Sektor Angst vor Nebenwirkungen der Impfung eingegangen. Die Hoffnung auf Normalität durch die Impfung wird deutlich. Eine verspätete Impfung bedeutet für ihn, dass er die Normalität nicht zurückerlangt und nicht auf Konzerte gehen kann. Darauf folgen geteilte Meinungen von Usern, welche sich impfen lassen, um mehr Freiheiten im alltäglichen Leben zurückzuerlangen und von Usern, welche sich impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Es folgt eine Diskussion über die Motive / Absichten sich impfen zu lassen.

Czernowitzfrank
25. Dezember 2020 um 10:07 Uhr
Äh... mein Beitrag ist ist in keiner Weise ironisch. Wie kommen Sie darauf.
Ich kann verstehen, wenn jemand schnell geimpft werden will, weil er Angst hat an Covid zu erkranken oder sein Umfeld anzustecken. Aber wie es eine Angst sein kann, in 2021 ein aufgeschobenes Konzert zu verpassen, weil man nicht geimpft ist, erschließt sich mir in keinster Weise.
„Czernowitzfrank“ zeigt mit seinem Beitrag, dass er den Gehalt des eingeführten Sektors von seinem Interaktanten nicht akzeptiert, oder versteht. „s062012“ zeigt wiederum in Form von interaktiv hergestellter Akzeptanz Verständnis gegenüber „GelöschterNutzer11481“.

s062012
25. Dezember 2020 um 10:12 Uhr
warum sollte man sich sonst imofen lassen?? Für die Allgemeinheit etwa??? Die Allgemeinheit, die sich ansonsten nichts um all diejenigen schert, die am Rand der Gesellschaft stehen? Ich lasse mich genau aus 2 Gründen impfen. Ich will nicht krank werden und ich will mich nicht länger eindchränken als unbedingt notwendig. Von der Allgemeinheit bekomme ich nämlich genau NULL dafür zurück, dass ich mich seit Monaten einschränke und verzichte. Und sollte ich einen Schaden durch die Impfung erleiden wird das von der werten Allgemeinheit auch nicht kompensiert.
Darauf folgt ein Kommentar von „MarkusK_HH“, welcher mit einer Kombination zu einem neuen Sektor wechselt.
Es gibt einen kurzen Bezug zur vorherigen Diskussion über die Motive des Impfens. Es wird eine evaluierende Form der Bezugnahme deutlich.
In diesem neuen Sektor werden die verschiedenen Impfstoffe und deren Kapazität aufgegriffen. Er nimmt außerdem in abstrahierender Form Bezug auf subjektiv erworbenes Wissen, dass es ohne weitere Impfstoffe keine Durchimpfungen geben wird.

MarkusK_HH
25. Dezember 2020 um 09:29 Uhr
Eine Diskussion, die am Kern der Sache vollständig vorbei geht. Wir haben eine Situation, in der es nicht darum geht, wer sich gerne impfen möchte.
Wir werden etwa 7 Mio. Menschen in den nächten drei Monaten impfen, keine 8% der Bevölkerung. Geschweige denn Menschen, die kritische Infrastrukturen aufrecht erhalten.
Wir sollten aufhören, an den Weihnachtsmann zu glauben, zumindest für die nächsten 6-9 Monate.
Die verfügbaren Kapazitäten von BionTec sind weltweit verkauft, ohne mind. zwei weitere Zulassungen von Impfstoffen, wird es keine relevanten Durchimpfungen geben.
In dieser Interaktion wird von dem Sektor „Angst vor den Impfungen“ zu den „unterschiedlichen Gründen einer Impfung der beteiligten Personen“ gewechselt. Der Sektor wird thematisch erweitert. Danach wird der subthematische Sektor „Kapazität von Impfstoffen“ eingeführt.

Nun sollen einzelne Kommentare zu dem Artikel Impfbereitschaft laut Robert Koch-Institut sehr hoch vom 21. Mai. 2021 [6] analysiert werden. Nachdem inzwischen 5 Monate vergangen sind, in denen gegen Corona geimpft wurde, soll geschaut werden, welche subthematischen Sektoren hier im Mittelpunkt stehen. Auch hier ist der fehlende Impfstoff noch Thema in den Kommentaren. Der Sektor wird in abstrahierender Form mit Bezug auf eigenes Erleben und subjektives Wissen eingeführt. Es geht um die fehlenden Impftermine. „Cosmicus“ erzählt dabei von der Impfsituation in seinem eigenen Umfeld.
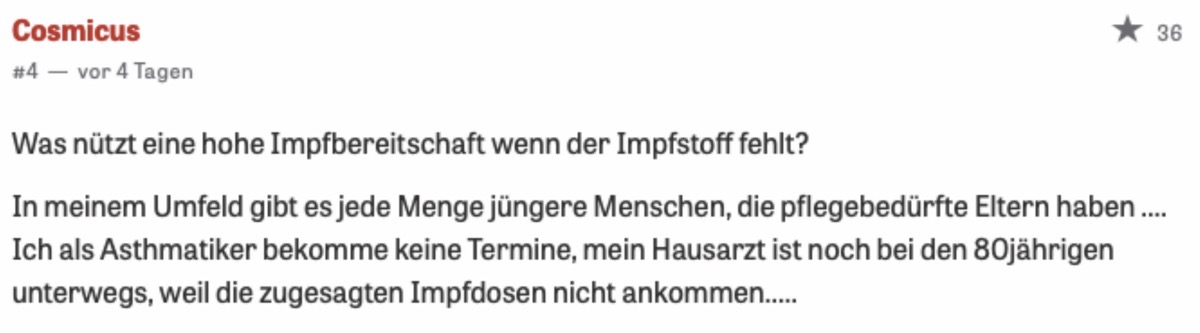
Cosmicus
21. Mai 2021 um 11:19 Uhr
Was nützt eine hohe Impfbereitschaft wenn der Impfstoff fehlt?
In meinem Umfeld gibt es jede Menge jüngere Menschen, die pflegebedürfte Eltern haben ....
Ich als Asthmatiker bekomme keine Termine, mein Hausarzt ist noch bei den 80jährigen unterwegs, weil die zugesagten Impfdosen nicht ankommen..... […]
Darauf leistet der User „Ronny Riddler“ unmittelbar Replik. Es wird damit ein nicht-thematischer Sektor bzw. ein metadiskursiver Sektor eingeführt. Auch Beiträge dieser Art tauchen in Kommentar-Foren auf und können von Wert für diskurspragmatische Erkenntnisinteressen sein. Dieser Beitrag könnte möglicherweise eine Rolle für die Konstruktion sozialer Identitäten spielen.
Darauf folgt ein Kommentar des Users „Charon“. Es wird sich auf die von „Ronny Riddler“ und „Cosmicus“ realisierten Aussagen bezogen. „Charon“ stimmt beiden zu und untermauert die Aussage mit dem Argument, dass 80-jährige Hilfe bei der Beschaffung eines Impftermins bräuchten. Durch Reduktion wird von diesem Sektor auf einen thematisch spezifischeren Bezug genommen. Denn sie führt ein weiteres Problem auf, das fehlende Absagen von Impfterminen.

Ronny Riddler
21. Mai 2021 um 14:18 Uhr
... mein Hausarzt ist noch bei den 80jährigen unterwegs, weil die zugesagten Impfdosen nicht ankommen.....
Hausarzt? 80 jährige? Also sorry das stinkt dermaßen...
Jeder 80 jährige hätte bereits seit Monaten ohne Probleme einen Termin haben können. Sie wollen hier wohl nur Dampf ablassen und mit falschen Angaben schlechte Laune verbreiten.
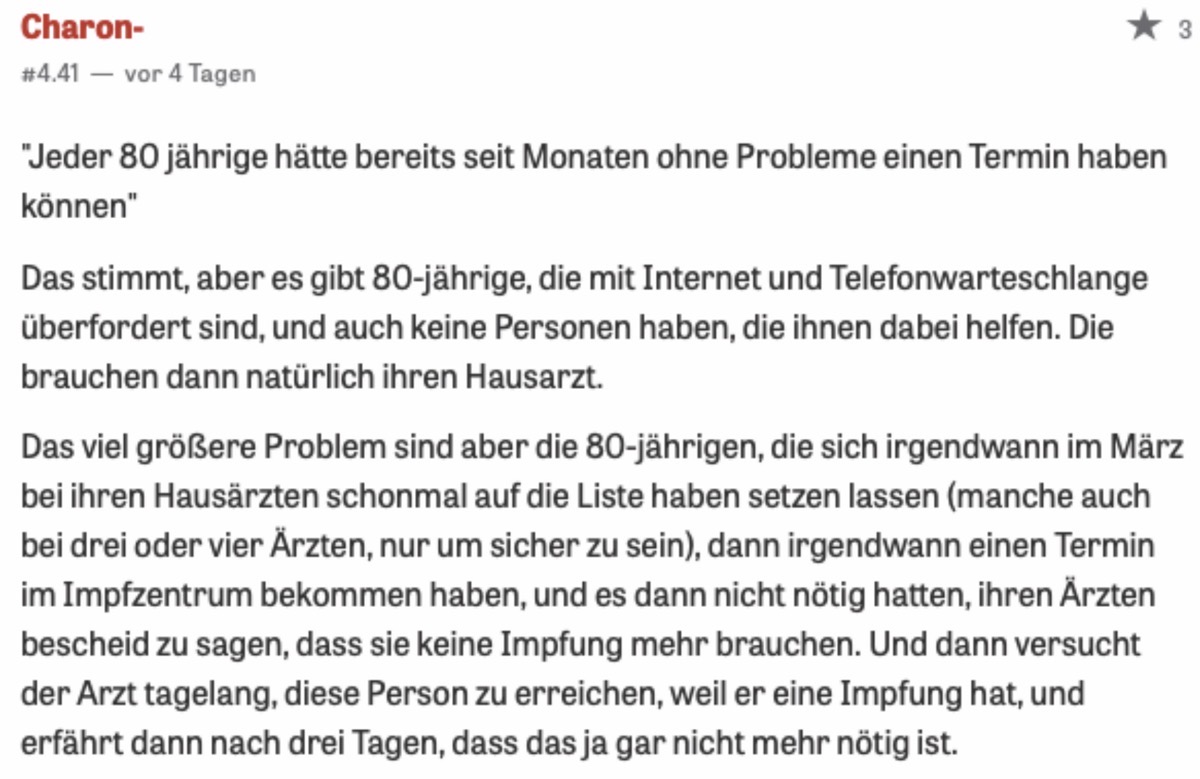
Charon-
21. Mai 2021 um 14:33 Uhr
"Jeder 80 jährige hätte bereits seit Monaten ohne Probleme einen Termin haben können"
Das stimmt, aber es gibt 80-jährige, die mit Internet und Telefonwarteschlange überfordert sind, und auch keine Personen haben, die ihnen dabei helfen. Die brauchen dann natürlich ihren Hausarzt.
Das viel größere Problem sind aber die 80-jährigen, die sich irgendwann im März bei ihren Hausärzten schonmal auf die Liste haben setzen lassen (manche auch bei drei oder vier Ärzten, nur um sicher zu sein), dann irgendwann einen Termin im Impfzentrum bekommen haben, und es dann nicht nötig hatten, ihren Ärzten bescheid zu sagen, dass sie keine Impfung mehr brauchen. Und dann versucht der Arzt tagelang, diese Person zu erreichen, weil er eine Impfung hat, und erfährt dann nach drei Tagen, dass das ja gar nicht mehr nötig ist. […]
Völlig isoliert und ohne semantischen Bezug auf den vorangegangenen Verlauf bringt der User „Alex72“ einen Kommentar ein. Durch einen Themenwechsel bringt er die Impfpriorisierung ein und bezieht sich dabei auf eigenes Erleben in seinem Bundesland. Es zeigt sich, dass bei ihm die Impfterminsuche einfacher und nur mit Geduld verbunden war. Damit wird im weiteren Verlauf das Thema Impfpriorisierung der einzelnen Bundesländer immer wieder aufgegriffen. Ein neuer thematischer Fokus entsteht.

Alex72
21. Mai 2021 um 11:32 Uhr
Tschüss, und noch viel Spaß im Forum, ich gehe jetzt zum Impfen.
Nachdem vor zwei Wochen die Prio 3 in BaWü freigegeben wurde, habe ich vorgestern den heutigen Termin zum Impfen bekommen.
Hat bloß viel Geduld gebraucht und nach gefühlten 1000 clicks auf der Homepage, hat es letztendlich geklappt.
Den zweiten Termin habe ich auch schon für Anfang Juli.
Achso, noch was, geimpft wird mit Moderna.
„Bogol“ leistet Replik darauf:

Bogol
21. Mai 2021 um 12:24 Uhr
Wem sagen Sie das. Ich bin Prio 3 ohne Chance auf Erstimpfungstermin. Und wenn in 2 Wochen die Priorisierung ganz aufgehoben wird, kann ich einen Termin erst recht vergessen.
Der User bezieht sich dabei auf eigenes Erleben im eigenen Bundesland. Er beschreibt seine Situation, womit er der Aussage von „Alex72“ eher widerspricht. Das Thema wird beibehalten, jedoch zeigt sich eine andere Meinung, denn er sieht keine Chance einen Impftermin zu bekommen. Er knüpft an den Sektor an. Die Interaktionssequenz bewegt sich von dort aus in Form der Erwiderung von „EinerderganzgroßenTourenklassiker“ zu einem neuen Beitrag. Dieser zieht aus den vorherigen Beiträgen und dem Artikel den Schluss, dass die Impfbereitschaft hoch ist. Der User stimmt seinen Vorgängern hinsichtlich des fehlenden Impfstoffes zu und spezifiziert dies mit der Begründung, dass die EU und Bundesregierung versagen. Dies geschieht durch einen Wechsel auf einen thematisch spezifischeren Sektor (Reduktion). Es wird versucht, die Aussage argumentativ zu stärken.

EinerderganzgroßenTourenklassiker
21. Mai 2021 um 12:31 Uhr
Impfbereitschaft ist hoch, das ist eine gute Nachricht.
Jetzt müsste nur die Bundesregierung aufhören bei der Beschaffung vom Impfstoffe eine so eine jämmerlich schlechte Performance hinzulegen und die EU aufhören dabei zu versagen.
Sonst ist bei vielen der Sommer vorbei ehe sie eine Chance haben geimpft zu werden.
In diesem Interaktionsverlauf ist der Sektor „fehlender Impfstoff und Impftermine“ Ausgangspunkt der folgenden Diskussion. Danach folgt der Sektor „Impfpriorisierung“ und „Versagen der Bundesregierung“. Vergleicht man die im Mittelpunkt stehenden Themen beider Artikel, so wird deutlich, dass viele Menschen auf einen Impftermin warten. Dies erweist sich 2020 und 2021 als schwierig. Während es zu Beginn des Impfens noch Priorisierungen gab, wurden diese im Mai 2021 in einigen Bundesländern aufgehoben. Der fehlende Impfstoff sorgt bei vielen weiterhin für Diskussionen, da sich die Kapazität des Impfstoffes nicht stark verbessert hat. Aus den Kommentaren wird ersichtlich, dass die Impfbereitschaft prinzipiell hoch ist und die Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen unabhängig von den Gründen. Die subthematischen Sektoren sind bei beiden Artikeln ähnlich, wobei sich die Impfbereitschaft / Situation ein wenig verbessert hat.

2.3 Aussagenanalyse
Mithilfe der Aussagenanalyse soll folgende Frage unserer Arbeit geklärt werden: Inwiefern gehen Sprecheraussagen mit Kohärenz einher und mit welcher Bereitschaft treten die Akteure einander gegenüber? Da die Diskussion in Online-Foren besonders von Asynchronität, Schriftlichkeit aber dennoch Dialogizität gekennzeichnet ist, wird eine gewisse Tiefgründigkeit vorausgesetzt, die sich als Abgrenzungsmerkmal zu den flüchtigen Face-to-Face Gesprächen anbringen lässt.
In Webforen ist aufgrund des Veröffentlichungscharakters von einer argumentativen Kohärenz auszugehen.
Sprecher:innen verfügen hier über eine gewisse Aussagenkontrolle, die eine kooperative und reflektierte Argumentation ermöglicht. Das Belegen solch einer argumentativen Kohärenz ist also Aufgabe der Aussagenanalyse (vgl. Roth 2019: 380). Außerdem soll untersucht werden, inwiefern die Interaktanten die Aussagen teilen oder diesen widersprechen – die sogenannte Zugänglichkeit von Aussagen. In Online-Diskussionen kann der interaktive Aufwand von Sprecheraussagen z. B. anhand von Begründungen oder Belegen festgemacht werden. Gleichzeitig wird transparent, auf wie viel Akzeptanz ein Teilnehmer mit dieser Strategie trifft.
Aussagen, die also einen größeren interaktiven Aufwand benötigen, sind nicht unbedingt kontrovers oder gar unzugänglich für andere Kommunikationspartner, sondern benötigen mehr Engagement und Aufwand, um auf Zustimmung zu stoßen (vgl. Roth 2019: 380–381).
Anhand der Aussagenanalyse soll nun genauer die Produkthaftigkeit von Kommentaren und die damit verbundene argumentative Kohärenz in den Blick genommen werden. Dazu werden Kommentare unter einem Artikel aus dem Jahr 2020 herangezogen.

Mordonice
25. Dezember 2020 um 09:46 Uhr
Für mich klingt das eher danach, dass sich ein Drittel tatsächlich impfen lassen will. Das Abwarten eventueller Nebenwirkungen kann beliebig lange dauern.
Da wir bis Ende März aber ohnehin nur 6 Mio. Menschen impfen können, dürfte es dafür erst mal genug Nachfrage geben.
peter42hb
25. Dezember 2020 um 09:52 UhrMit jeder Woche, in der keine gravierenden Nebenwirkungen bekannt werden, wird die Impfbereitschaft steigen. Es wäre doch - wie soll ich sagen - nicht besonders schlau, die realen Nebenwirkungen (bis hin zum Tod) einer Infektion zu riskieren, um die rein theoretischen Nebenwirkungen einer Impfung zu vermeiden.
Das Nadelöhr ist nicht die mangelnde Impfbereitschaft, sondern sind die Zulassungen und die Produktionskapazitäten.
Mordonice
25. Dezember 2020 um 9:57 Uhr
Sollte man denken, da gebe ich Ihnen Recht. So müssten sich aber auch fast alle jährlich gegen Grippe impfen lassen, die Impfung ist nicht gerade neu aber in der Realität lassen sich trotzdem viele Menschen nicht impfen.
Die Aussage von Mordonice fungiert in diesem Fall als Ausgangspunkt. Prinzipiell ist Mordonice der Auffassung, dass sich nur ein Drittel, statt der im Artikel angesprochenen zwei Drittel, tatsächlich impfen lassen wollen. Das Abwarten vor möglichen Nebenwirkungen sei für viele Menschen entscheidend. Der in der Artikelüberschrift angesprochene Diskursgegenstand wird somit unmittelbar aufgegriffen, sodass hier die intertextuelle Kohärenz von Aussagen belegt werden kann.
Der Gesprächsteilnehmer macht zudem einen neuen thematischen Block auf und hält fest, dass eine vermehrte Bereitschaft sowieso nicht umsetzbar wäre. Es ist auffällig, dass der Beitrag von peter42hb den gleichen argumentativen Aufbau verfolgt, wie der des Vorredners.
Zunächst werden die realen Nebenwirkungen einer Corona-Erkrankung den theoretisch möglichen Nebenwirkungen einer Impfung gegenüberstellt. Peter42hb meint, dass die Impfbereitschaft aufgrund fortschreitender Forschung zunehmen werde. Anschließend geht der Interaktant, ähnlich wie Mordonice, auf das Verhältnis von Impfbereitschaft und Impfkapazitäten ein. Durch den übernommenen inhaltlichen und argumentativen Aufbau, wird hier die Produkthaftigkeit von Aussagen kenntlich. Stabile Strukturen und logische Aufbaumuster als Merkmale von Online-Kommunikation können durch die Aussagenanalyse bestätigt werden. Der zweite Punkt der Aussagenanalyse, die Zugänglichkeit, soll ebenso kurz beleuchtet werden. Mordonice hinterfragt die Antwort von peter42hb.
Um die Akzeptanz von peter42hb zu gewinnen, startet der Gesprächsbeitrag mit einer direkten Ansprache: „[…] da gebe ich Ihnen Recht“. Das Eingehen auf den Vorredner kann somit als Argumentationsstrategie gesehen werden. Der im Theorieteil angesprochene interaktive Aufwand kann an diesem Beispiel demonstriert werden: Wenn Teilnehmer nicht direkt auf Zustimmung stoßen, werden Aussagen argumentativ komplexer eingeleitet, um den Gegenredner zu überzeugen (vgl. Roth 2019: 381).
Welche Bedeutung dem interaktiven Aufwand beigemessen werden kann, soll durch folgende Kommentare verdeutlicht werden:

Trevor Rabin
25. Dezember 2020 um 10:05 Uhr
So so 2/3 wollen sich impfen lassen ?
Komisch das ich niemanden kenne der sich impfen lassen möchte.
Komisch das ein Großteil der Ärzte und des Pflegepersonals sich nicht impfen lassen will.

Boesor
25. Dezember 2020 um 10:34 Uhr
Gibt´s für letzteres ne Quelle?
Aufreizend vitaler Gorilla
25. Dezember 2020 um 10:39 Uhr
» Gibt's für letzteres ne Quelle?«
Vermutlich ein Telegramm-Chat oder ähnlich seriöses
Trevor Rabin bezweifelt die Erkenntnis des Online-Artikels und begründet dies mit Erfahrungen aus dem Umfeld.
Außerdem stellt der Interaktant die These auf, dass sich die Mehrzahl der Ärzte und des Pflegepersonals nicht impfen lassen würde. Boesor reagiert daraufhin ausschließlich mit der Frage „Gibt´s für letzteres ne Quelle?“. Auch der nächste Gesprächsteilnehmer (Aufreizend vitaler Gorilla) reagiert mit einer belustigenden Antwort. Trevor Rabin habe seine These anhand eines privaten Chats aufgestellt. Es ist also eindeutig, dass der ursprüngliche Kommentar von Trevor Rabin auf weniger Zustimmung stößt. Kontroversität innerhalb der Aussage gibt es nicht, aber der interaktive Aufwand ist sehr gering, da hier keine Argumentationsstrategie oder wissenschaftliche Belege genutzt werden. Die Zugänglichkeit von Aussagen ist also vom Engagement abhängig, welches für eine kooperative und überzeugende Kommunikation aufgebracht wird. In Bezug auf die Impfbereitschaft kann festgehalten werden, dass diesem Thema kritisch begegnet wird.
Diese Kommentare sollen in Bezug auf die aktuelle Impfbereitschaft (2021) aussagenanalytisch untersucht werden.

bemüht
21. Mai 2021 um 11:25 Uhr
Wer sich als gesunder Erwachsener nicht impfen lassen will, muss sich diesen Vorwurf aussetzen.
Für manche Menschen ist die Impfung aber mit einem hohen Gesundheitsrisiko verbunden, während es für andere (Kinder und Jugendliche) noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Diese Menschen müssen momentan durch die Impfung der anderen mit geschützt werden.
Filosov
21. Mai 2021 um 11:32 Uhr
Für die Menschen ist eine Corona-Infektion mit einem noch viel höherem Gesundheitsrisiko verbunden.
tassentee
21. Mai 2021 um 11:32 Uhr
Ohje, welche Menschen haben ein hohes Gesundheitsrisiko bei der Impfung? Ist das wegen Allergien? Aber müsste dann nicht wenigstens einer der zugelassenen Impfstoffe funktionieren? Also wenn mRNA zu gefährlich wäre z.B. der Impfstoff von AstraZeneca oder umgekehrt? Habe dazu noch nichts gehört. Hoffentlich überschneiden sich die Risikofaktoren nicht mit denen von Covid.
Der Beitrag von bemüht, in welchem das kritische Zusammenwirken von Vorerkrankungen mit der Corona-Impfung angesprochen wird, gilt in diesem Fall als Ausgangspunkt. Der nächste Gesprächsteilnehmer (Filosov) widerspricht dieser Aussage und meint, dass die eigentliche Corona-Infektion für gesundheitsgefährdete Menschen deutlich schädlicher sei als die Impfung.
Der Beitrag von tassentee kann als eine Art Synthese der vorigen Kommentare gesehen werden. Sowohl bemüht als auch Filosov nutzen keine wissenschaftlichen Belege, sodass bei tassentee Fragen aufkommen.
An dieser Stelle kann zum einen die Kohärenz der drei Kommentare verdeutlicht werden. Alle drei Kommentare bilden eine thematische Einheit und bauen aufeinander auf. Es lässt sich die für Online-Diskussionen typische argumentative Kohärenz beweisen. Auch die Zugänglichkeit von Aussagen kann anhand dieses Beispiels untersucht werden. Durch die beiden ersten Gesprächsbeiträge werden Unsicherheiten bei tassentee ausgelöst. Die ersten Aussagen können als ungesichertes Wissen aufgefasst werden, da sie nicht auf unmittelbare Zustimmung stoßen. Unter Einbezug von Quellen wären weniger Unklarheiten bei tassentee aufgekommen, sodass dieser Gesprächsteilnehmer sich womöglich einem der beiden Vorredner angeschlossen hätte. Es zeigt sich der Zusammenhang von interaktivem Aufwand und der Zugänglichkeit. Bezogen auf die Impfbereitschaft sind hier geteilte Meinungen herauszulesen. Einerseits besteht Unsicherheit, besonders in Bezug auf Vorerkrankungen, andererseits wird die Impfung als Chance für mildere Krankheitsverläufe gesehen.
2.4 Handlungsanalyse
Die letzte Analyseform der interaktional-pragmatischen Analyse bezieht sich auf die Analyse der Handlungen. Hierbei sind Handlungen als zentrales Kriterium der pragmatisch-interaktionalen Diskurssemantik zu verstehen (vgl. Roth 2019: 382). Prinzipiell erfasst eine Handlungsanalyse, unter welchen Bedingungen bestimmte Redebeiträge mittels konkreter sprachlicher Handlungen von den Gesprächsteilnehmern einer Diskursgemeinschaft verwirklicht wurden und welchen Status eine Aussage in diskursiven Wissensstrukturen unter Einbezug der Bedingungskonstellation innehat (vgl. Roth 2019: 383). Angesichts der Analyse von Handlungen kann das konversationsanalytische Modell als Orientierung genutzt werden, da es kollektive Kooperationsaufgaben der Gesprächsteilnehmer auf sechs Ebenen darstellt. Zu diesen Ebenen gehören Gesprächsorganisation, Handlungskonstitution, Sachverhaltsdarstellung, Soziale Identitäten und Beziehungen, Interaktionsmodalität und Reziprozitätsherstellung. Dabei bezieht sich die Gesprächsorganisation auf formale Abwicklungen und die Handlungskonstitution auf gemeinsame Handlungsziele und -zwecke der Gesprächsteilnehmer. Ferner werden Inhalte und Gesprächsthemen mithilfe der Sachverhaltsdarstellung beschrieben. Soziale Identitäten und Beziehungen verweisen auf das gegenseitige Verständnis und bestimmen interaktive Rollen der teilnehmenden Akteure.
Weiterhin kennzeichnet die Art der Beteiligung die Interaktionsmodalität. Reziprozitätsherstellung legt sich mittels Formen der Kooperation dar. Letztlich werden all diese Ebenen in der Gesprächsinteraktion gleichzeitig abgehandelt. Daraus ergibt sich eine komplexe Gleichzeitigkeit von Ansprüchen. Zudem sind alle Ebenen der Interaktionskonstitution bedeutend und sollten für eine entsprechende diskurspragmatische Interpretation herangezogen werden (vgl. Roth 2019: 382).
Im Folgenden soll an ausgewählten Beispielen mithilfe von Kommentaren einer Diskursgemeinschaft die Handlungsanalyse beschrieben werden. Zunächst wird ein Artikel mit beispielhaften Kommentaren aus dem Jahr 2020 herangezogen. Bei diesem Kommentarverlauf zeigt sich, dass der Nutzer Pony und Kleid eine Aussage tätigt, welche von dem Gesprächsteilnehmer Bembelsche kommentiert wird. Demnach ist die Gesprächsorganisation von einem Sprecherwechsel gekennzeichnet. Ergänzend beinhaltet der Beitrag von Pony und Kleid mehrere Sätze, in Form eines kleinen Textes mit zwei Abschnitten. Demgegenüber beschränkt sich die Antwort von Bembelsche auf einen Satz. Die Sachverhaltsdarstellung bezieht sich auf die Impfbereitschaft jüngerer Menschen im Vergleich zu älteren Menschen.
Hierbei wird zunächst den jüngeren Menschen eine höhere Impfbereitschaft zugeschrieben und ein Misstrauen von älteren Personen gegenüber der Impfung thematisiert. Die Handlungskonstitution besteht darin herauszufinden, ob die Impfbereitschaft bei jüngeren Menschen tatsächlich höher ist als bei Älteren. Die Beziehung der beiden Gesprächspartner ist distanziert und als kühl zu bewerten. Der Gesprächsteilnehmer Bembelsche reagiert vorwurfsvoll auf den vorangegangen Redebeitrag, da nicht alle älteren Menschen miteinander gleichzusetzen wären. Dabei greift er den Nutzer Pony und Kleid persönlich an, indem er die Worte „[...] Ihre 90jährige Tante [...]“ [7] gebraucht und damit auf Pony und Kleids Beitrag verweist. Hierbei wird illustriert, dass die Haltung einer älteren Person nicht auf die Gesamtheit aller Älteren zu übertragen sei. Allerdings wird sachlich diskutiert, unter Einhaltung von angemessener Sprache und Ausdruck. Demzufolge ist kein gegenseitiges Verständnis erkennbar, weil Bembelsche dem vorausgegangenen Kommentar widerspricht und somit anderer Meinung ist. Die Interaktionsmodalität ist von Ernsthaftigkeit gekennzeichnet. Es sind keine Anzeichen von ironischen oder gar spaßigen Aussagen festzustellen. Hinsichtlich der Reziprozitätsherstellung kooperiert der Nutzer Bembelsche insofern mit dem Nutzer Pony und Kleid, dass er auf den Gesprächsbeitrag eingeht und seine Meinung zu der getätigten Aussage kundtut. Zudem versteht er die vorangegangene Aussage und reagiert entsprechend darauf, indem er sie negiert.

Pony und Kleid
25. Dezember 2020 um 15:03 Uhr
Ich mache die Erfahrung, dass die Zustimmung zur Impfung gerade bei denen sehr hoch ist, die noch lange warten müssen, nämlich der jungen Generation, sprich unseren eigenen Kindern und deren Freunden. Je älter, um so skeptischer, so jedenfalls mein Eindruck. Gerade heute morgen noch musste einer über 90jährige Tante zugeredet werden, sich doch bitteschön im allgemeinen Interesse impfen zu lassen.
Bembelsche
25. Dezember 2020 um 15:05 Uhr
Nun muss Ihre 90jährige Tante nicht repräsentativ für alle 90jährigen Menschen sein.
Anschließend wird auf ein zweites Beispiel des aktuellen Jahres Bezug genommen. Hierbei handelt es sich um den Gesprächsteilnehmer Cejazar, welcher den Gesprächsbeitrag des Nutzers useros kommentiert. Demzufolge findet erneut ein Sprecherwechsel mit jeweils einem Kommentar pro Gesprächsteilnehmer statt. Beide Gesprächsbeiträge verfügen über mindestens zwei Sätze und sind von jeweils einem Absatz gekennzeichnet. Die Darstellung des Sachverhaltes bezieht sich auf die vorhandene Impfbereitschaft sowie das Fehlen der erforderlichen Impfstoffmenge.
Angesichts der Handlungskonstitution lässt sich feststellen, dass beide Gesprächsteilnehmer ihr Unverständnis und ihre Frustration gegenüber der zu geringen Menge an Impfstoff ausdrücken. Anhand Cejazars persönlicher Situation beschreibt er seine Unzufriedenheit über die geringe Impfstoffmenge. Diese Gefühlslage wird mittels des ironischen sprachlichen Mittels ausgedrückt. Die Ironie bezieht sich auf die Aussage des Artikels, dass es sich „nur“ um Wochen und nicht um Monate handle. Obwohl sich die beiden Foreneinträge ergänzen und in ihrer Meinung übereinstimmen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich useros und Cejazar persönlich kennen. Die sozialen Identitäten der Nutzer stellen einen sachlichen und respektvollen Umgang dar. Deren Beziehung ist von Fremdheit gekennzeichnet. Allerdings bestehen Ähnlichkeiten in ihren Beiträgen, wodurch sich ein gegenseitiges Verständnis aufbaut. Diese gemeinsame Verständnisgrundlage zeigt sich, indem der Nutzer Cejazar, den vorausgegangen Kommentar mithilfe eines eigenen Erfahrungsbeispiels unterstützt. Beide Forenteilnehmer stimmen in ihrer Unzufriedenheit über das Fehlen von Impfstoff überein und tauschen sich darüber aus. Ergänzend verweisen beide Beteiligungen auf eine ernsthafte Interaktionsmodalität. Zu Beginn des Kommentars von Cejazar wird eine Aussage bezüglich des Artikels zitiert, welche als Aufhänger für den darauffolgenden Kommentar dient.
Ferner endet Cejazars Kommentar mit einem weiteren sprachlichen Mittel der Ironie, da er die Danksagung nicht ernst meint, sondern eher sein Unverständnis mit Nachdruck bekräftigt, indem er mit den Worten „Also vielen Dank für nichts“ endet.
Wie bereits angedeutet kooperieren beide Gesprächsbeiträge, da sie dieselbe Grundeinstellung verbindet und sie auf gegenseitige Anerkennung treffen. Beide Foreneinträge bemängeln die Knappheit des Impfstoffes, obwohl die zugrundeliegende Impfbereitschaft vorhanden sei.

useros
21. Mai 2021 um 13:58 Uhr
Schön, das die Impfbereitschaft sehr hoch ist.
Die erforderliche Impfstoffmenge für die vielen Impfwilligen scheint aber nicht so hoch zu sein!?
Cejazar
21. Mai 2021 um 14:08 Uhr
„Es geht um Wochen, nicht um Monate“.
Blöd nur, dass ich als Angehöriger der Gruppe drei schon seit Wochen auf einen Termin warte - und aufgrund der zu erfolgenden Zweitimpfungen in den nächsten Wochen nicht mit einem Termin zu rechnen ist. Also Vielen Dank für nichts.
Anhand der vorausgegangenen Analyse lässt sich feststellen, dass sich die Foreneinträge hinsichtlich ihrer äußeren Form ähneln. Zudem weisen sie in ihrer Interaktion Gemeinsamkeiten auf, indem jeweils ein Forennutzer den Beitrag kommentiert. Weiterführend handelt es sich bei beiden Beispielen, um anonyme Teilnehmer, welche sich gegenseitig nicht kennen. Ergänzend sind beide Foreneinträge ernsthaft zu werten, bei denen sachlich argumentiert und diskutiert wird.
Ferner beziehen sich beide Auszüge auf die Impfthematik zur Bekämpfung des Coronavirus. Ein Unterschied ergibt sich bezüglich der übereinstimmenden Verständnisgrundlage, welche ausschließlich bei dem zweiten Beispiel gegeben ist. Hierbei wurde ersichtlich, dass sich die Gesprächsteilnehmer des zweiten Forenbeispiels ergänzten, wohingegen beim ersten Kommentarausschnitt Uneinigkeit herrschte. Bezüglich des Themas besteht ein Zusammenhang, da im ersten Forenbeispiel die Impfbereitschaft thematisiert wird, welche im zweiten Beispiel durch den Mangel an Impfstoff fortgesetzt wird. Abschließend zeigen beide Foreneinträge sowohl ähnliche als auch sich unterscheidende sprachliche Handlungen, die in einer Diskursgemeinschaft in Zusammenhang mit dem Coronavirus getätigt wurden.
3. Analyse der Invektiven Kommunikation
Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Invektive Kommunikation und Frameanalyse mit ihrer Charakteristik erklärt und beschrieben. Zudem wird versucht, Unterschiede zwischen Emotionen und Gefühlen hervorzuheben. Dann wird die Invektive Kommunikation in Foreneinträgen zu den herangezogenen Artikeln [7] und [6] untersucht.
3.1 Invektive Kommunikation und Frameanalyse
Sprachliche Zeichen sind Träger nicht nur von Inhalten, sondern auch von Bewertungen, Emotionen und Gefühlen.
Laut Norbert Fries (1996: 4) sind Gefühle „dem Menschen zugängliche Gestimmtheiten, die in ihrer Qualität introspektiv wahrnehmbar sind“. Ihre Intensität kann beispielsweise mithilfe des Hirnstrombildes oder der Hauttemperatur untersucht werden. Die Gefühle beziehen sich auf die komplexen Reaktionsmuster, die als ein Zusammenspiel von drei subjektiv-psychologischen, motorisch-verhaltensmäßigen und physiologisch-humoralen Ebenen gelten (vgl. ebd.: 4).
Die Emotionen hingegen seien „theoretische Beschreibungsgrößen der Linguistik“ (ebd. : 5). Die Emotionen werden anhand der verschiedenen Aspekte der Äußerungsbedeutung in Sprechakten beschrieben (vgl. ebd.: 5). Mees unterscheidet ereignisfundierte Emotionen, Attributionsemotionen, Beziehungsemotionen und Verbindungsemotionen (vgl. Mees 1991: 55). Die erste Gruppe wird durch die Präsenz der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit bewertet. Sie gliedert sich in drei Gruppen: Empathie (Mitleid oder Neid), Erwartungsemotionen (Hoffnung oder Furcht) und Wohlergehensemotionen (Freude oder Leid). Die Attributionsemotionen erkennt man durch Billigung oder Missbilligung. Sie sind entweder mit internaler Attribution (Scham oder Stolz) oder externaler Attribution (Billigung oder Zorn) verbunden. Die vorletzte Gruppe enthält zwei Typen der Bewertungselemente – Wertschätzung oder Mögen / Nicht-Mögen. Das Wertschätzen bildet eine Gruppe von Wertschätzungsemotionen (Bewunderung oder Verachtung), hingegen bilden das Mögen oder Nicht-Mögen die Attraktivitätsemotionen (Liebe oder Hass). Die letzte Gruppe – die Verbindungsemotionen – fasst zwei Kategorien, nämlich Zufriedenheit und Billigung (Selbstzufriedenheit, Dankbarkeit) oder Unzufriedenheit und Missbilligung (Selbstunzufriedenheit, Ärger) (vgl. ebd.: 55).
Der Unterschied zwischen den Gefühlen und Emotionen beruht darauf, dass man mit Emotionen die spezifischen Bedeutungen verbindet, die sich durch die Sprache systematisch ausdrücken lassen (vgl. Fries 1996: 5–6). Bei Gefühlen geht es um psychische oder peripher körperliche Phänomene (vgl. ebd.: 4). Sowohl die Emotionen als auch Gefühle können entweder positiv oder negativ sein.
Das führt zum Begriff der invektiven Kommunikation, die ein Teil der sogenannten Hassrede ist und häufig mit negativen Gefühlen assoziiert wird. Die invektive Kommunikation bedeutet, dass eine Person die Normen des zwischenmenschlichen Umgangs missbraucht. Dazu gehören solche Phänomene, die „[…] von herabsetzender Unhöflichkeit über Schmähungen, Lästerungen und Beleidigungen bis hin zur Hassrede und verbaler bzw. symbolischer Gewalt, von intentionalen und persönlich adressierenden Varianten der Herabwürdigung bis zu gesellschaftlichen Dispositiven und Konstellationen […]“ (Ellerbrock u.a. 2017: 6) reichen. Ihr Ziel ist es, mithilfe der verbalen oder nonverbalen Kommunikationsakte negative Bewertungen von anderen Personen abzugeben und sie zu verletzten, d.h. ihre soziale Position zu senken oder diese Personen zu diskriminieren. In manchen Fällen geht es auch um die Diskreditierung der anderen. Aus diesem Grund erzeugt die Invektive in der Regel sowohl eigene normative und emotionale Ansprüche als auch andere Vorstellungen der Normalität (vgl. ebd.: 5–6). Die Folge der Verwendung von Invektiven beruht auf der sozialen In- und Exklusion oder der Entstehung von sozialen Hierarchien und Ordnungen. Zur invektiven Kommunikation werden Schimpf- und Fluchphrasen, Generalisierungen, Hyperbeln, pejorative Ausdrücke, Verabsolutierungen, Vorwurfsintonationen oder oft übertriebene Superlative verwendet (vgl. ebd.: 5–7). Das Invektive ergibt sich sowohl aus der bestimmten Situation (Kontext) und dem Kotext als auch aus dem Weltwissen.
Für die Untersuchung der invektiven Kommunikation kann die Frameanalyse angewendet werden. Die Frameanalyse baut darauf auf, dass das Verständnis eines Ausdrucks mit dem Aufrufen des Rahmens verbunden ist (vgl. Tokarski 2006: 36). Die Frameanalyse beruht auf dem Finden der Ausdrücke, die zu einem konkreten Rahmen gehören. Die Ausdrücke rufen einen bestimmten Rahmen auf (vgl. Fillmore 1982: 116–117). Ein Rahmen kann sowohl durch eine Aussage als auch durch einen als Element des lexikalischen Systems geltenden Ausdruck ins Bewusstsein gebracht werden (vgl. Tokarski 2006: 36).
Charles Fillmore unterscheidet drei wichtige Voraussetzungen für eine Frameanalyse, nämlich den Enzyklopädismus der Semantik, die Schematisierung des Wissens und die Prototypen sowie die Perspektivierung als Kriterien zur Wahl einer Einheit aus dem Rahmen. Der Enzyklopädismus sagt, dass das Verständnis der Ausdrücke sich nicht nur aus dem Erkennen der unterschiedlichen Eigenschaften, sondern auch aus dem Weltwissen, den Normen, der Praxis oder den geltenden Bräuchen ergibt. Die Schematisierung des Wissens sagt, dass die Prototypen zwar ein ideales Modell bilden, aber in der Realität kann man zahlreiche Abweichungen von dem Modell beobachten. Hingegen hebt die letztere Voraussetzung die Rolle des Interpreten hervor, der bestimmte Rahmen und Szenen mithilfe seiner Erfahrung, Kultur, interiorisierten Regeln und seines Weltwissens konstruiert (vgl. Tokarski 2006: 38–41).
3.2 Analyse der emotiven Kommunikation anhand der Kommentare
Die Analyse beginnt mit der Untersuchung der Kommentare, die sich unter dem Artikel Zwei Drittel der Deutschen wollen sich gegen Corona impfen lassen vom Dezember 2020 [7] befinden, nämlich mit dem früher in der Sektorenanalyse erwähnten Kommentar von „s062012“. Hier kann man beobachten, dass mit dem Ausdruck „Allgemeinheit“ eine diskriminierende Wirkung beabsichtigt wird:

s062012
25. Dezember 2020 um 10:12 Uhr
warum sollte man sich sonst imofen lassen?? Für die Allgemeinheit etwa??? Die Allgemeinheit, die sich ansonsten nichts um all diejenigen schert, die am Rand der Gesellschaft stehen? Ich lasse mich genau aus 2 Gründen impfen. Ich will nicht krank werden und ich will mich nicht länger eindchränken als unbedingt notwendig. Von der Allgemeinheit bekomme ich nämlich genau NULL dafür zurück, dass ich mich seit Monaten einschränke und verzichte. Und sollte ich einen Schaden durch die Impfung erleiden wird das von der werten Allgemeinheit auch nicht kompensiert.
Der Autor hebt hervor, dass diese „Allgemeinheit“ sich weder um andere kümmert noch hilft. In dem Satz „Von der Allgemeinheit bekomme ich nämlich genau NULL dafür zurück, dass ich mich seit Monaten einschränke und verzichte“ („s062012“ [7]) ruft das Verb „bekommen“ den Rahmen des Bekommens (receiving) auf. Dieser Rahmen beruht darauf, dass der Rezipient (recipient) zuerst nicht über ein bestimmtes Objekt (theme) verfügt. Später kommt er in den Besitz des Objekts, weil er es von dem / der Spender:In (donor) als Quelle (source) erhält. Die Voraussetzung ist wie im getting-Rahmen, dass die Quelle zuerst das Objekt besitzt und infolge des Transfers es nicht mehr sein Eigen nennen kann, da der Rezipient es hat. Die „Allgemeinheit“ gilt hier als die Quelle, die dem Rezipienten etwas (eine Gegenleistung für die geleisteten Einschränkungen und Verzichte) übergibt. In diesem Fall ist er jedoch der Besitzer von nichts; die Gegenleistung gleiche „s062012“ Null, also auch im Falle eines durch die Impfung verursachten Schadens ist seiner Meinung nach von der „Allgemeinheit“ nichts zu erwarten. Dies ruft bei „s062021“ nicht nur Ärger (Verbindungsemotion) hervor, sondern ist zugleich ein Argument, sich nicht wegen der Allgemeinheit, sondern aus zwei anderen, persönlichen Gründen impfen zu lassen. Die Verärgerung wird zusätzlich durch die Großschreibung des Wortes Null verdeutlicht. Darüber hinaus drückt „s062021“ seine Verachtung (Beziehungsemotion) der Allgemeinheit gegenüber durch die sarkastische Attribuierung mit dem Adjektiv werte (werte Allgemeinheit) aus.
Eine andere Art der invektiven Kommunikation liegt im Kommentar von „Bembelsche“ vor, die als eine Reaktion auf den Beitrag von „Pony und Kleid“ gilt:

Pony und Kleid
25. Dezember 2020 um 15:03 Uhr
Ich mache die Erfahrung, dass die Zustimmung zur Impfung gerade bei denen sehr hoch ist, die noch lange warten müssen, nämlich der jungen Generation, sprich unseren eigenen Kindern und deren Freunden. Je älter, um so skeptischer, so jedenfalls mein Eindruck. Gerade heute morgen noch musste einer über 90jährige Tante zugeredet werden, sich doch bitteschön im allgemeinen Interesse impfen zu lassen.

Bembelsche
25. Dezember 2020 um 15:05 Uhr
Nun muss Ihre 90jährige Tante nicht repräsentativ für alle 90jährigen Menschen sein.
Hier wird der Rahmen des Denkens: Bewusstheit (thinking: awareness) aufgerufen, in dem es u.a. ein erkennendes Subjekt (cognizer) und Inhalt (content) gibt. Das erkennende Subjekt verfügt über einen konkreten Grad der Bewusstheit des Inhalts. Es kann sich dem konkreten Grad der Bewusstheit durch direkte Perzeption bewusst werden, aber in der Regel entsteht die Bewusstheit durch die Deduktion, die von dem erkennenden Subjekt durchgeführt wird [4]. Der Autor meint, dass die besagte Tante kein stellvertretendes Beispiel für alle alten Menschen wäre. Die generelle Interpretation der Nominalphrase „90-jährige Tante“ im Sinne von „alte Menschen“ würde im Endeffekt zur Senkung der Position einer ganzen Altersgruppe führen.
Aus emotionaler Sicht betrachtet, hat „Bembelsche“ auf den ersten Blick eine weder positive noch negative Einstellung zum Kommentar von „Pony und Kleid“. Jedoch, wenn man dieser Aussage genauer nachgeht, kann man feststellen, dass „Bembelsche“ sich ein bisschen spöttisch über die Meinung von „Pony und Kleid“ äußert. Er schreibt „Ihre 90jährige Tante“, als ob sie die Tante von „Pony und Kleid“ wäre. Da das Possessivpronomen nicht nur Besitzverhältnisse bzw. allgemein eine Zugehörigkeitsrelation ausdrückt, kann es ebenso gut nicht als Verwandtschaftsbezeichnung, sondern als Angliederung (die besagte Tante) interpretiert werden. In beiden Fällen jedoch wird die Tante als eine negative Ausnahme verächtlich herabgesetzt.
Im Artikel unter dem Titel Impfbereitschaft laut Robert Koch-Institut „sehr hoch“ vom Mai 2021 [6] wurden viele Aussagen wegen Verstößen gegen die Regeln dieser Plattform gelöscht. Außerdem sind die Kommentare sehr emotional, was mit der Textdynamik verbunden ist. Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat unsere Wahrnehmung konkreter Phänomene, Regeln oder Aussagen verändert. Die Menschen sind heute wütender als früher, weil sie stetig im Lockdown leben oder keine Familie oder Freunde sehen dürfen.
„User789“ bezeichnet mit dem Wort „Ungeimpfte“ diejenige Gruppe der Menschen, die in der heutigen Realität weniger Rechte und einen niedrigeren Status durch Verordnungen des Staates haben könnten:

User789
21. Mai 2021 um 12:15 Uhr
Nein. Der Staat verbietet den Zugang und grenzt Ungeimpfte aus.
Der Ausdruck „Ungeimpfte“ in Zusammenstellung mit dem Verb „ausgrenzen“ kommt hier als Invektive vor. Das Verb „ausgrenzen“ ruft den semantischen Rahmen auf, dessen Element (exclude_member) lexikalisch durch „Ungeimpfte“ besetzt ist. Das macht „Ungeimpfte“ in diesem Ko- und Kontext zu einem pejorativ konnotierten Ausdruck. Im Endeffekt wird das Mitglied (member) infolge der Handlung der Autorität (authority) innerhalb einer Gruppe (group) aus ihr entlassen [3]. Das bedeutet, dass die Rechte der Ungeimpften beschränkt werden können, weil sie sich nicht impfen lassen.
Aus emotionaler Sicht weist das Verb „ausgrenzen“ auch auf ereignisfundierte Emotionen, nämlich auf Furcht vor den neuen Regeln und Einschränkungen hin. „User789“ missbilligt (externale Attribution) die unverschuldete, durch die Priorisierung verursachte Ausgrenzung von Ungeimpften.
Hingegen äußert sich der Benutzer „Filosov“ zum Thema COVID-19 und verwendet die saloppe, abwertende Invektive „Teufelszeug“ zweimal – um die Impfung und die Krankheit (COVID-19) zu bezeichnen:

Filosov
21. Mai 2021 um 11:55 Uhr
Stichwort Masernparty: Wenn ungeimpfte Kinder zusammenkommen (Das Zusammenkommen ist für die Kinder sehr wichtig), dann verteilen sie das Virus munter weiter, und Sie klingen so, als wäre das kein Problem, die alten sind ja geimpft. Das ist dieselbe Haltung wie bei Masernparties.
Sie müssen ja auch nicht die Verantwortung tragen für die restlichen der "allermeisten" Kinder, die wirklich krank werden - und was Spätfolgen angeht wissen wir sowieso noch nichts, während sie so tun, als sei die Impfung das Teufelszeug (die armen Kinder können erstmal verschont werden).
Weiß ja nicht ob sie das mitbekommen haben, aber Covid19 ist das Teufelszeug.
Die Aussage „Covid19 ist das Teufelszeug“ [7] verbindet sich mit dem Rahmen der Meinung (thinking: opinion). Hier gibt es ein erkennendes Subjekt (cognizer), eine Meinung (opinion) und ein Thema (topic). Das erkennende Subjekt vertritt eine konkrete Meinung, die als Beschreibung eines bestimmten Themas gilt [4]. Der Autor des Kommentares fungiert als erkennendes Subjekt und drückt seine Meinung – etwas ist Teufelszeug – aus. Das Thema dieser Aussage ist COVID-19, d.h. eine Krankheit, die durch das Virus SARS-CoV-2 verursacht wird. „Filosov“ beschreibt COVID-19 als etwas Schlechtes und Gefährliches für Menschen. Er vergleicht es auch mit dem Teufel, also mit der Kreatur aus der Hölle. Zuvor schreibt „Filosov“, dass die Impfung auch als Teufelszeug betrachtet werde und ruft damit ebenfalls den Rahmen der Meinung (thinking: opinion) auf. Das Thema (topic) ist nun aber die Impfung und das erkennende Subjekt (cognizer) nicht mehr der Kommentierende, was man an der Verwendung des Konjunktivs erkennt. Damit wird unmittelbar die Denkweise des anderen als falsch ausgestellt. Am Ende sagt er, was wirklich das Teufelszeug ist – COVID-19. Daraus wird ersichtlich, dass man in einem Rahmen mit Hilfe verschiedener lexikalischer Besetzung des Topics andere Meinungen äußern kann. „Filosov“ ironisiert, indem er das Wissen von der Gefährlichkeit der Krankheit derjenigen, die die Impfung für Teufelszeug halten, in Frage stellt und sich über das Mitleid mit den armen Kindern‚ die von der Impfung verschont werden können, lustig macht. Damit missbilligt er das Argument gegen das Impfen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die invektive Kommunikation nicht nur darauf beruht, dass sie beleidigende Ausdrücke enthält. Sie kann auch in diesen Aussagen gefunden werden, die expressive Ausdrücke mit negativen Emotionen enthalten. Invektive Kommunikation kann sowohl durch Verbalinjurie als auch implizit zustande kommen. Sie ist auch mit der Textdynamik verbunden, denn sie führt zu einer anderen Wahrnehmung oder einer neuen Perspektivierung einer Situation.
4. Ergebnisse zur Textdynamik
Der DUDEN definiert Dynamik als eine auf Veränderung und Entwicklung ausgerichtete Kraft [2]. Dynamik lässt sich also nicht ausschließlich im physikalischen Bereich finden, auch in Texten sind gewisse Dynamiken zu erkennen. Im Folgenden geht es weniger um Texte im eigentlichen Sinne, sondern um den dialogischen Aspekt von diskurspragmatischen Aussagen in Online-Foren. Texte bzw. die Online-Kommentare werden unter Berücksichtigung aktueller Umstände verfasst und dienen somit zum Austausch und zur persönlichen Wissensorganisation (vgl. Fritz 2017: 15). Mithilfe der interaktional-pragmatischen bzw. der emotiven Frameanalyse, zeigte sich die Dynamik in verschiedenen Bereichen.
Zum einen zeichnet sich eine thematische Veränderung ab. Während man sich im Dezember 2020 vorrangig mit Skepsis gegenüber der Impfstoffwirksamkeit auseinandersetzte, geht es im Frühjahr 2021 besonders um Impfpriorisierung und steigende Impfbereitschaft. Aber auch in Hinblick auf die Emotionen kann man festhalten, dass sich diese mit dem Fortschreiten der Pandemie wandeln. Im Frühjahr 2021 kam es zu vermehrten Sperrungen von Usern oder dem Löschen von Kommentaren aufgrund unangebrachter Formulierungen, denn zahlreiche Menschen erlebten einen Winter mit Einschränkungen und Krankheitsfällen im Familien- und Bekanntenkreis. Diese Frustration zeigt sich in aggressiveren Aussagen. Zudem lässt sich sagen, dass hier die Textdynamik als Folge sozialer Dynamik gesehen werden kann. Menschen als kommunikationsbedürftige Wesen bekommen in Zeiten der Pandemie wenig Raum für öffentlichen Austausch.
Kontroverse Meinungen, vor allem bezüglich der Corona-Impfung, welche einerseits als Chance, andererseits als Risiko empfunden wird, werden nun in digitalen Interaktionen diskutiert. Ursprünglich private Kommunikation wird öffentlich (vgl. Masur / Teutsch / Dienlin 2019: 337–339). Die Texte bilden somit ein Spiegelbild gesellschaftlicher Grundstimmungen ab, sodass sich dieses in der Textdynamik niederschlägt.
5. Fazit
Aus den in der Arbeit analysierten Kommentaren wird ersichtlich, dass die Impfbereitschaft unter den Deutschen grundsätzlich hoch ist. Außerdem versinnbildlichen die Kommentare verschiedene Gefühle und Emotionen. Dies lässt sich durch die länger anhaltenden Pandemiezustände erklären. Laut Spahns Zitat [5] wurde mit Zulassung des Impfstoffes ein Weg in die Normalität eingeleitet, welcher von vielen Deutschen angenommen wird. Aber ob die Pandemie tatsächlich beendet werden kann, wird sich in naher Zukunft zeigen. Trotz der zunehmenden Impfbereitschaft erfolgt die Verabreichung der Impfdosen nur schrittweise, da die eingeschränkte Impfstoffmenge und die zuvor geltende Impfpriorisierung den Prozess verlangsamten. Sowohl dieser Aspekt als auch die Angst vor möglichen Nebenwirkungen hinterlassen Zweifel. Trotz anfänglicher Besorgnisse lassen sich immer mehr Menschen impfen, als zuvor erwartet. Aus aktuellen Statistiken geht hervor, dass sich bereits 49,9 Prozent der Deutschen für eine Covid-19-Impfung entschieden haben [5].
Die vorangegangenen Analysepunkte haben gezeigt, mit welcher Vielseitigkeit Kommunikation in Online-Foren untersucht werden kann. Mithilfe der Sektorenanalyse konnten wir zeigen, welche Themen Schwerpunkte der Diskussion sind, wobei besonders in dem aktuellen Artikel der fehlende Impfstoff thematisiert wurde. Durch die Aussagenanalyse wurde ersichtlich, dass Online-Kommunikation mit einer hohen Kohärenz im Vergleich zu Face-to-Face-Gesprächen einhergeht. In der Handlungsanalyse wird erkennbar, wie sich die einzelnen Gesprächsbeiträge und Gesprächsteilnehmer aufeinander beziehen. Schwierig während der Analyse war die Begrenzung auf einzelne Kommentare, da eine Vielzahl an thematisch verschiedenen Gesprächen und Diskussionen vorhanden ist. Außerdem ist es zuweilen schwierig, die Emotionen der Teilnehmer im schriftlichen Text zu interpretieren. Um die Dynamik noch besser analysieren zu können, wären weitere Beiträge der Teilnehmer interessant.
- Ellerbrock, Dagmar / Koch, Lars / Müller-Mall, Sabine / Muenkler, Marina / Scharloth, Joachim / Schrage, Dominik / Schwerhoff, Gerd (2017): Invektivität – Perspektiven eines neuen Forschungsprogramms in den Kultur- und Sozialwissenschaften, in: Kulturwissenschaftliche Zeitschrift 2, 2–24.
- Fillmore, Charles J. (1982): Frame Semantics, in: Linguistics in the Morning Calm, 111–137.
- Fries, Norbert (1996): Grammatik und Emotionen, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 26, 37–69.
- Fritz, Gerd (2017): Dynamische Texttheorie, 2. Aufl., Gießen: Universitätsbibliothek.
- Gardt, Andreas (2007): Diskursanalyse. Aktueller theoretischer Ort und methodische Möglichkeiten, in: Warnke, Ingo H. (Hrsg.): Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstand. Berlin, New York: De Gruyter, 27–52.
- Masur, Philipp K. / Teutsch, Doris / Dienlin, Tobias (2019): Privatheit in der Online-Kommunikation, in Schweiger, Wolfang / Beck, Klaus (Hrsg.). Handbuch Online-Kommunikation, 2. Aufl., 337–339.
- Mees, Urlich (1991): Die Struktur der Emotionen, Göttingen: Hogrefe.
- Pappert, Steffen / Roth, Kersten Sven (2016): Diskursrealisationen in Online-Foren, in: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 65, 37–66.
- Roth, Kersten Sven (2019): Diskurs und Interaktion, in: Handbuch Diskurs, 363–386.
- Tokarski, Ryszard (2006): Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne – dwa spojrzenia na język, in: LingVaria nr 1, 35–46.
- [1] „Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel“. kma-online.de https://www.kma-online.de/aktuelles/medizin/detail/dieser-impfstoff-ist-der-entscheidende-schluessel-a-44647 (Stand: 21.06.2021).
- [2] Dynamik. Duden online https://www.duden.de/rechtschreibung/Dynamik (Stand: 08.09.2021).
- [3] FrameNet https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ (Stand: 21.06.2021).
- [4] German Frame-Semantic Online Lexicon https://www.coerll.utexas.edu/frames/taxonomy/term/99 (Stand: 21.06.2021).
- [5] Hörz M. / Meyer R. / Zajonz M. (2021): Wie viele bisher gegen Corona geimpft wurden. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html (Stand: 21.06.2021).
- [6] Impfbereitschaft laut Robert Koch-Institut „sehr hoch“. ZEIT ONLINE https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/corona-rki-jens-spahn-lothar-wieler-pressekonferenz-impfbereitschaft-herdenimmunitaet (Stand: 21.06.2021).
- [7] Zwei Drittel der Deutschen wollen sich gegen Corona impfen lassen. ZEIT ONLINE https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-12/yougov-umfrage-impfung-corona-zwei-drittel (Stand: 21.06.2021).
Online-Journal #2
Online-Journal #2 Download
Inhalt
Vorbemerkung
Textdynamiken und mittelalterliche Literatur –
Eine Einführung
Minnesang im Spannungsfeld der Kulturen.
Das dynamische Bild der Entstehung einer Gattung
‚Nibelungenlied‘ und ‚Nibelungenklage‘
Hartmann von Aue: Dynamiken des Anfangs.
Zum Texteingang des ‚Iwein‘
Wolfram von Eschenbach ‚Willehalm‘ — Gyburg,
die Protagonistin, eine Frau mit vielen Facetten
‚Aristoteles und Phyllis‘ — Dynamiken des Begehrens
die frau der hönerei do lachet / das ers so
hübschlich hett gemachet.
Zu den Fassungen von
Hans Rosenplüts Märe ‚Der fahrende Schüler‘
Vorbemerkung
Die Beiträge des zweiten Online-Journals gehen aus einer Vorlesungsreihe hervor, die am Institut für Germanistik der Universität Leipzig konzipiert und im Wintersemester 2021/22 online durchgeführt wurde.[^1 Das Plakat der Vorlesungsreihe hier zum Download ] Die Vorlesungsreihe stand unter dem Titel „Textdynamiken in der mittelalterlichen Literatur“ und sie ist ein Baustein der Germanistischen Institutspartnerschaft (GIP) zwischen Leipzig und Krakau, die unter dem übergreifenden Thema „Textdynamiken“ durch den DAAD für insgesamt sechs Jahre gefördert wird (2021 – 2026). Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Prozesse der Dynamiken von Texten thematisiert und in Lehr- und Forschungszusammenhängen überprüft, wobei sowohl Sprach- als auch Literaturwissenschaft daran beteiligt sind, zudem Perspektiven der synchronen wie auch der diachronen Betrachtung gemeint sind. Die Vorlesung war ein erster Versuch unsererseits, diese Dynamiken in der mittelalterlichen Literatur zu beobachten und in einzelne Lektüren zu überführen. Diese Lektüren richteten sich primär an Studierende der Krakauer Germanistik, die keine intensiven mediävistischen Vorkenntnisse besaßen, da das Lehrangebot in der Krakauer Germanistik das Mittelalter nicht oder nur am Rande vorsieht. Die Herausforderung bestand für uns also darin, den Gegenstand gut zu portionieren, klar und deutlich zu formulieren und das Grundsätzliche zu fokussieren. Und dabei natürlich nicht zu langweilen!
Die Vorlesung wurde von verschiedenen Personen durchgeführt, die als Mitarbeiter:innen am Institut für Germanistik der Universität Leipzig im Fachbereich der Germanistischen Mediävistik tätig sind oder dem Institut angehören. Dadurch sollte die Dynamik auch in der Umsetzung als Prinzip bewahrt werden: Unterschiedliche Herangehensweisen ermöglichen ein Spektrum an Antworten, verschiedene Methoden und Texte wurden ausgewählt und vorgestellt und in Close Readings überführt. Dabei sollten Eigenheiten der mittelalterlichen Literatur aber auch das Rahmenthema des Projekts im Zentrum stehen.
Das Thema der GIP benennt ein Phänomen, das die Literaturwissenschaft und die Sprachwissenschaft gleichermaßen betrifft, das wir mit dem Label der „Textdynamiken“ benannt haben. Es betrifft Veränderungen von Texten, Bewegungen und Beweglichkeit von Texten, es betrifft einen mehrfachen und regelmäßig mitzudenkenden Medienwechsel und grundsätzlich den mittelalterlichen Textbegriff. Wir werden erkennen, dass es nicht nur um Texte gehen wird, sondern dass wir uns auch mit medialer Übertragung auseinandersetzen und notgedrungen auseinandersetzen müssen, wenn wir über mittelalterliche Literatur nachdenken. Weiterhin werden textinterne Bewegungen und Bezugnahmen mit der Vokabel der Textdynamik gemeint.
An der Vorlesungsreihe waren folgende Kolleg:innen der Universität Leipzig beteiligt: Helmut Beifuss, Sarah Bender, Frank Buschmann, Markus Greulich, Michael Rupp und ich selbst.[^2 Die Vorlesung von Sarah Bender über die „Dynamik der Lesart. Der Protagonist als frommer Sünder, Ritter und Papst in Hartmanns von Aue ‚Gregorius‘“ musste aus Krankheitsgründen entfallen und konnte leider auch nicht in einen Beitrag überführt werden.] Bei der Auswahl der Texte waren wir bemüht, klassische und ‚typische‘ Texte und Phänomene zu berücksichtigen, eindrückliche Geschichten und unerwartete Gedankenspiele vorzustellen. So wählten wir das ‚Schneekind‘, Lieder des Minnesangs, ‚Nibelungenlied‘ und ‚Nibelungenklage‘, Hartmanns von Aue ‚Iwein‘ und Hartmanns ‚Gregorius‘, Wolframs von Eschenbach ‚Willehalm‘ sowie aus der Märenliteratur den anonym überlieferten Text ‚Aristoteles und Phyllis‘ sowie Hans Rosenplüts ‚Fahrenden Schüler‘aus. Natürlich wären hier noch viele weitere Texte und Themen nötig (gewesen), um ‚das Mittelalter‘ vorzustellen, aber die Vorlesung war ein erster Versuch unsererseits, Perspektiven für die Krakauer Studierenden zu entfalten. Die lebhaften Diskussionen nach den Vorträgen zeigten uns, dass es gelungen ist.
Beide Aspekte, der Einführungscharakter und das Close Reading, wurden bei der Umsetzung in die Publikation bewusst bewahrt. Wir möchten dadurch Texte vorstellen, übersetzen und durch diese Lektüren auf Phänomene der mittelalterlichen Literatur aufmerksam machen, die zeigen, wie dynamisch, aber auch wie grundsätzlich die Literatur des Mittelalters ‚denkt‘, formuliert und erzählt. Einiges davon war für die Studierenden der Krakauer Germanistik überraschend und ist für uns beim Wiederlesen noch immer bedenkenswert. Wir hoffen, dass wir mit diesen Einführungen einige Leser und Leserinnen für die mittelalterliche Literatur gewinnen können. Für ihre sorgfältige Durchsicht der Beiträge möchte ich Anna Luise Klemm sehr herzlich danken.
Die einzelnen Beiträge thematisieren folgende Bereiche und Phänomene der Literatur des Mittelalters:
Sabine Griese eröffnet die Vorlesungsreihe mit einigen einführenden Überlegungen: Die deutsche Literatur des Mittelalters aus der Zeit zwischen 800 und 1500 ist erstaunlich vielfältig, nicht nur hinsichtlich ihres Themenspektrums, sondern auch hinsichtlich ihrer Textbewegungen und Textveränderungen. Mit dem Titel „Textdynamiken“ soll dies benannt und die Variabilität und Varianz gefasst werden. Ein Werk ist nicht nur in einer fest gefügten Fassung erhalten, sondern die ‚Überlieferung‘ mittelalterlicher Literatur arbeitet weiter an einem (Autor-)Text. In der ersten Vorlesung wird diese Frage des Textes und seiner medialen Bewegung erläutert und an zwei Beispielen dargelegt, es geht dabei um Schneekinder und um den Tristan.
Michael Rupp thematisiert einen Klassiker des Mittelalters, den Minnesang: Im 12. Jahrhundert kommt an deutschen Höfen eine neue Form gesungener Liebeslyrik auf, die ihre wichtigsten Impulse von provenzalischen und französischen Vorbildern erhält. Sie entwickelt bald eine eigene, sehr breite Tradition und wird zu einer der wichtigsten Repräsentationsformen der höfischen Kultur, was man auch an den prunkvollen Handschriften ablesen kann, in denen Minnesang bis heute überliefert wird. Gerade an ihnen kann man beobachten, welche Dynamik die Texte in ihrer Überlieferung entwickeln. Der Beitrag führt an ausgewählten Beispielen die wichtigsten Formen und Entwicklungsstufen des Minnesangs exemplarisch vor.
Es folgt der Textverbund von ‚Nibelungenlied‘ und ‚Klage‘, den Sabine Griese aufgreift: Das ‚Nibelungenlied‘ (um 1200 verschriftlicht) ist einer der wuchtigsten und eindringlichsten Texte des Mittelalters, dessen Untergangserzählung verstört und auch fasziniert, da sie so unausweichlich erscheint und bereits am Beginn der Erzählung präsent ist. Kriemhild wird von einer anmutigen und selbstbewussten höfischen Königstochter zu einer der Rache verfallenen, grausamen Mörderin (gemacht). Die Literatur des Mittelalters selbst zeigt eine Irritation darüber und das Nachdenken über das Epos in der Überlieferung des Textes auf, in den meisten Handschriften folgt dem strophischen ‚Nibelungenlied‘ der Verstext der ‚Nibelungenklage‘ nach, der das Geschehen reflektiert, kommentiert und auf das Leben nach dem Untergang, auf das Bewältigen des Geschehens, die Zukunft der Überlebenden und das Fortleben der Geschichte in der Erinnerung setzt. In punktuellen Ausschnitten und Lektüren wird dieser Textverbund interpretiert.
Markus Greulich führt den Artusroman als Themenfeld in die Vorlesungsreihe ein. Hartmanns von Aue zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstandener Roman ist nach dem ‚Erec‘ sein zweiter Artusroman in deutscher Sprache. Er berichtet vom jungen Ritter Iwein, der an einer wunderbaren Quelle den Herrscher des Quellenreichs tötet. Er flieht in seine Burg und heiratet schließlich dessen Witwe. Doch Frau und Herrschaft wird er kurz darauf verlieren und nackt und sinnenlos in einem Wald herumirren, bevor er über mehrere Abenteuer gemeinsam mit einem ihn begleitenden Löwen seine Gattin und sein Ansehen zurückerobern kann. Hartmanns ‚Iwein‘ setzt auf dem nur wenige Jahrzehnte zuvor entstandenen ‚Yvain‘ Chrétiens de Troyes auf. Damit ist er Teil des französisch-deutschen Kulturtransfers im Hochmittelalter. Hartmann übertrug jedoch nicht nur Chrétiens Text, sondern amplifizierte und variierte ihn wiederholt an neuralgischen Stellen. Der Beitrag bietet zuerst eine kurze Einführung zu Hartmann von Aue und seinem ‚Iwein‘ (inklusive ausgewählter bildlicher Darstellungen). Danach widmet er sich insbesondere dem Beginn von Hartmanns Artusroman. Denn hier ist nichts so eindeutig wie es auf den ersten Blick scheinen mag: Wer spricht wann und weshalb zu wem? Welche Effekte ergeben sich aus der Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen und Sprecher? Warum entschwindet der (primäre) Erzähler für eine lange Passage aus dem Erzählprozess?
Helmut Beifuss zieht einen weiteren Klassiker des Mittelalters heran: Wolfram von Eschenbach gehört zu den drei profiliertesten Epikern um 1200, die gerne als die Vertreter der ‚höfischen Klassik‘ bezeichnet werden. Mit dem ‚Willehalm‘ vollzieht Wolfram die Abkehr von höfischen Stoffen und wendet sich einer Materie zu, die, aus damaliger Sicht jedenfalls, als historisch einzustufen ist. Offensichtlich traf er damit den Nerv der Zeit, denn sein Werk würde heute in Bestsellerlisten ganz oben stehen. Das Werk ist überaus vielschichtig. Aus einer Auseinandersetzung, deren Ursachen privater Natur waren, wurde ein Glaubenskrieg, bei dem es schließlich auch um den Anspruch der Weltherrschaft ging. Willehalm floh mit Arabel, der Ehefrau des heidnischen Königs Tybalt. Sie lässt sich taufen und heißt fortan Gyburg. Inmitten von kriegerischem Geschehen agiert Gyburg als Protagonistin. Gyburg tritt – als getaufte Heidin – für ihren neuen, den christlichen Glauben ein, sie verteidigt ihn gegen die verbalen Angriffe ihres heidnischen Vaters und argumentiert dabei durchaus auf der Höhe der theologischen Diskussion der Zeit. Eine andere Haltung scheint Gyburg später einzunehmen. Während der Ratsversammlung der christlichen Fürsten ergreift Gyburg das Wort, nun bittet sie die christlichen Kämpfer um die Schonung der heidnischen Feinde. Was kann Schonung der Feinde inmitten kriegerischer Auseinandersetzungen bedeuten? Geht es um Toleranz gegenüber den Andersgläubigen?
Markus Greulich thematisiert in seinem zweiten Beitrag die Märenliteratur: Der von einer schönen jungen Frau überlistete Weise ist ein weitverbreitetes Erzählmotiv. Es wurde im europäischen Mittelalter auf einen der wichtigsten Gelehrten der Antike (und des westlichen Denkens überhaupt) appliziert: Aristoteles. Der Beitrag setzt sich mit einer Ausformung dieser Geschichte, mit der vollständig-überlieferten Fassung der mittelhochdeutschen Versnovelle ‚Aristoteles und Phyllis‘, auseinander. Sie berichtet davon, wie Aristoteles Lehrer am Königshof wird. Er unterrichtet dort den jungen (und natürlich begabten) Königssohn Alexander – der später Alexander der Große genannt werden wird. Doch die Liebe funkt dazwischen. Anstatt dem Unterricht zu folgen, sitzt der Schüler brummend wie ein Bär im Unterricht. Er hat sich in eine junge Frau verliebt. Aristoteles gelingt es, die Beziehung zu unterbinden. Doch die schöne Frau weiß sich zu rächen und wird Aristoteles dazu bringen, sich wie ein Pferd satteln und sich durch den Palastgarten reiten zu lassen.
Die Versnovelle ‚Aristoteles und Phyllis‘ zeichnet sich durch eine Reihe von Besonderheiten aus: So besitzt die Verführerin nur in der deutschsprachigen Tradition auch einen Namen: Phyllis. Dieser ist dem literarisch-gebildeten Publikum vertraut. Doch hier begegnet ihm eine durchaus ungewöhnliche Figur. Darüber hinaus werden an mehreren Textstellen Verse aus Gottfrieds von Straßburg ‚Tristan‘ zitiert. Weshalb? Welche Effekte kann dies haben? Und überhaupt: Wenn Aristoteles am Ende enttäuscht auf eine Insel flieht und dort ein Buch schreibt. Was ist das für ein Ende? Was fangen wir mit einem solchen Textschluss an?
Am Ende steht Hans Rosenplüts (*um 1400, †1460) Märe ‚Der fahrende Schüler‘, das Frank Buschmann analysiert. Das Märe ist in zwei Fassungen überliefert; zu je drei handschriftlichen Textzeugen gesellen sich bei einer Fassung noch ein Druck Konrad Kachelofens (Leipzig, um 1495) und einer Matthäus Elchingers (Augsburg, nach 1520). Im Märe entdeckt ein gewitzter reisender Scholar den Ehebruch einer Bäuerin mit einem Pfarrer. Als der betrogene Ehemann unerwartet zurückkehrt, nutzt der Scholar die Situation geschickt, um die ihm von der Ehefrau zunächst versagte Unterkunft für die Nacht doch noch zu erhalten. Dazu führt er sowohl den leichtgläubigen Bauern als auch den um sein Leben bangenden Pfarrer vor, während die Bäuerin als lachende Dritte ungeschoren davonkommt.
In dem Beitrag geht es einerseits darum, inwiefern Eingriffe in und Änderungen am Text als dynamische Prozesse zu begreifen sind, die Rückschlüsse auf die Text- und Tradierungsgeschichte zulassen. Dazu wird ein Überblick zur Überlieferung geboten sowie anhand exemplarischer Stellen vorgeführt, wie sich Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Textzeugen ermitteln und deuten lassen. Andererseits soll das – durchaus unterhaltsame – Märe selbst in den Blick geraten, wobei Fassungsunterschiede in die Analyse und Interpretation einzubeziehen sind.
Beitrag 1
Textdynamiken und mittelalterliche Literatur – Eine Einführung
Was lesen wir, wenn wir einen mittelalterlichen Text lesen? Mit dieser Frage möchte ich diesen Beitrag eröffnen und das Thema der Textdynamiken daran erläutern. Die Frage zielt darauf ab, sich den Status und den Zustand eines Textes, den man liest, vor Augen zu führen. In einem ersten Schritt werde ich einen kurzen Verstext vorstellen, den wir das ‚Schneekind‘ nennen. Dafür wähle ich die Fassung A, das ‚Schneekind A‘, aus.[^1 Das ‚Schneekind‘ wird zitiert nach den Fassungen A und B, die in folgender Anthologie synoptisch abgedruckt und ins Neuhochdeutsche übersetzt sind: Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Hg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller, Frankfurt a. M. 1996 (Bibliothek des Mittelalters 23 / Bibliothek deutscher Klassiker 138), S. 82–93, ein Kommentar dazu findet sich auf S. 1055–1063. Das ‚Schneekind A‘ ist auch abgedruckt in: Deutsche Versnovellistik des 13. bis 15. Jahrhunderts (DVN). Band 1/1: Nr. 1–38. Hg. von Klaus Ridder und Hans-Joachim Ziegeler, Berlin 2020, S. 49–54 (Nr. 13), das ‚Schneekind B‘ in: Deutsche Versnovellistik des 13. bis 15. Jahrhunderts (DVN), Band 4: Nr. 125–175. Hg. von Klaus Ridder und Hans-Joachim Ziegeler, Berlin 2020, S. 291–294 (Nr. 154).] Nach der Lektüre und Vorstellung stelle ich noch einmal die Frage: „Was lesen wir, wenn wir einen mittelalterlichen Text lesen?“, die wir danach beantworten, indem wir weitere Fragen stellen.
Schauen wir ohne weitere Einleitung auf den Text, und zwar Abschnitt für Abschnitt:[^2 Der Textabdruck folgt dem Text bei Grubmüller, Novellistik; der mittelhochdeutsche Text wird im Anschluss von mir ins Neuhochdeutsche übersetzt, die Übersetzung bei Grubmüller wird an einigen Stellen angepasst und verändert.]
Ez het ein koufman ein wip,
diu was im liep als der lip.
er wær ir liep, des jah ouch sie,
iedoch gewan ir herze nie
5 die warheit darinne:
daz waren valsche minne.
‚Ein Kaufmann hatte eine Frau, die er wie sein eigenes Leben liebte. Sie liebe ihn auch, sagte sie. Doch das war keine Herzenswahrheit. Das war trügerische Liebe.‘
ez geschach bi einen ziten,
niht langer wold er biten,
von sinem hus fuor er
10 mit koufe durch gewinnes ger.
er huop sich uf dez meres fluot,
als noch manic koufman tuot.
do kom er in ein fremedez lant,
da er guoten kouf inne vant.
15 er beleip durh gewinne
driu jar darinne,
daz er nie wider heime quam,
unz daz vierde jar ende nam.
‚Eines Tages geschah es, dass er, der Kaufmann, nicht länger bleiben wollte, er brach mit seinen Waren von zu Hause auf, um Gewinn zu machen. Er begab sich auf das Meer, wie es noch heute viele Kaufleute tun. Da kam er in ein fremdes Land, in dem er gute Geschäfte machte. Er blieb dort wegen des Gewinns drei Jahre und fuhr nicht nach Hause, bis das vierte Jahr zu Ende gegangen war.‘
sin wip in minneclichen enphienc,
20 ein kindelin mit samt ir gienc.
do vragt er der mære,
wes daz kint wære.
si sprach: „mich geluste din
do gie ich in min gertelin.
25 des snewes warf ich in den munt,
do wurden mir din minne kunt,
do gewan ich ditze kindelin.
ze minen triuwen, ez ist din.“
‚Seine Frau empfing ihn freundlich, ein kleines Kind ging an ihrer Hand. Da fragte er, wem das Kind gehöre. Sie sagte: Mich verlangte nach dir, da ging ich in meinen Garten und warf mir ein wenig Schnee in den Mund. So erfuhr ich deine Liebe und ich empfing dieses Kind. Ehrenwort, es ist deins.‘
„ja maht du vil wol war han,
30 wir suln ez ziehen“, sprach der man.
er braht si des niht inne,
daz er valscher minne
an ir was worden gewar
unz dar nah wol über zehen jar.
‚Ja, du hast bestimmt Recht. Wir werden es aufziehen, sprach der Mann. Er ließ sie über zehn Jahre nicht merken, dass er die trügerische Liebe an ihr sehr wohl erkannt hatte.‘
35 er lert daz kint under stunden
mit hæbechen unt mit hunden,
mit schachzabel unt mit vederspil
maniger hant freude vil,
mit zuhte sprechen unt swigen,
40 herpfen, rotten unt gigen
unt allerhande saitenspil
unt ander kurzewile vil.
‚Er unterrichtete das Kind in der Jagd mit Habicht und Hunden, lehrte es das Schachspiel und den Umgang mit dem Falken, weiterhin viele Vergnügungen, auch, wie es mit Anstand sprechen und auch schweigen sollte, er lehrte es, Harfe, Rotte und Geige zu spielen und allerhand Seitenspiel und weitere Unterhaltungen.‘
nu hiez er aber die knehte
diu schef bereiten rehte
45 mit spise nah dem alten site.
des snewes sun fuort er mite.
er huop sich uf daz wilde mer,
die unde sluogen in entwer.
si sluogen in in ein schœne lant,
50 da er einen richen koufman vant.
‚Nun ließ er die Knechte abermals die Schiffe rüsten, mit Speise ausstatten, wie es Sitte war. Den Sohn des Schnees nahm er mit. Er begab sich auf das wilde Meer, die Wellen warfen ihn (und das Schiff) hin und her; sie brachten ihn in ein schönes Land, wo er einen reichen Kaufmann traf.‘
der vragt in sa der mære,
wa sin koufschatz wære.
des snewes sun wart dafür gestalt,
mit drinhundert marken er in galt:
55 daz was ein grozer rihtuom.
ouch het er des vil grozen ruom,
da er daran niht was betrogen,
daz er daz gouchelin het gezogen.
der schatz braht im in sinen gwalt,
60 daz im zwir als vil galt.
‚Der reiche Kaufmann fragte ihn sofort, wo seine Waren wären. Der Sohn des Schnees wurde als die Ware ausgegeben, für dreihundert Mark erwarb dieser (reiche Kaufmann) ihn. Das war viel Geld und ein großer Gewinn. Auch hatte er (der Ehemann) dadurch großes Ansehen erworben, dass er das Kuckuckskind erzogen und sich nicht hatte betrügen lassen. Der Preis brachte ihm so viel ein, dass er zweifach entschädigt wurde.‘
nu beleip er niht langer da,
mit fröuden fuor er heim sa.
sin husvrowe gegen im gienc,
minneclichen si in enphienc.
65 si vragt in: „wa ist daz kint?“
er sprach: „mich sluoc der wint
beidiu hin unt her
uf dem wilden mer entwer.
do wart daz kint naz al da
70 unt wart ze wazzer iesa,
wan ich het von dir vernomen,
daz er von snewe wær bekomen.
‚Nun blieb er nicht länger dort und fuhr mit Freuden umgehend nach Hause. Seine Ehefrau kam ihm entgegen, freundlich nahm sie ihn in Empfang. Sie fragte ihn: Wo ist das Kind? Er sagte: Mich trieb und warf der Wind auf dem wilden Meer hin und her, dabei wurde das Kind nass und wurde sofort zu Wasser. Denn ich hatte ja von dir gehört, dass es aus Schnee entstanden sei.‘
ist aber daz war, daz ich hœre sagen,
sone darft du in nimmer geklagen.
75 dehein wazzer vlieze so sere,
ez habe die widerkere
innerthalbe jares frist
ze dem urspringe dannan ez komen ist.
so solt ouch du gelouben mir,
80 ez fliuzet schiere wider zu dir.“
‚Ist aber wahr, was ich sagen höre, dann brauchst du dies nicht zu beklagen: Kein Wasser fließt so stark, dass es nicht innerhalb der Jahresfrist zurückkehrt zu dem Ursprung, von dem es gekommen ist. So musst du mir glauben, es fließt sicher bald wieder zu dir zurück.‘
sus het er widernullet,
daz er was betrullet.
swelh man sich des bedenket,
ob in sin wip bekrenket,
85 daz er den schranc wider stürzet
unt mit listen liste lürzet:
daz ist ein michel wisheit,
wan diu wip habent mit karcheit
vil manigen man überkomen,
90 als ir e dicke habt vernomen.
‚So hatte er gerächt, dass er betrogen worden war. Wenn ein Mann Verdacht schöpft, dass seine Frau ihn verletzen würde, dann ist es eine große Klugheit, dass er den Betrug zurückgibt und die List mit List beantwortet. Denn Frauen haben mit ihrer Hinterlist schon viele Männer hintergangen, wie ihr oft gehört habt.‘
Soweit der Textdurchgang durch das ‚Schneekind A‘, neunzig Verse umfasst diese kurze Geschichte, die von schauriger Pragmatik und Logik ist.
Texte des Mittelalters sind anders als die Gegenwartsliteratur (der eigenen Nationalsprache) erst einmal sprachlich fremd und fern, das Mittelhochdeutsche (oder die ältere Sprachstufe einer anderen Nationalsprache) muss übertragen werden in eine Gegenwarts-Sprache. Deswegen haben wir uns diesen langsamen Textdurchgang mit anschließender Übersetzung erlaubt, um den Inhalt des Textes klar vor Augen zu haben. Inhaltlich und thematisch müssen wir uns ebenfalls ein wenig eindenken, der Kaufmann beispielsweise ist ein Berufsstand, den wir heute noch immer kennen, als Geschäftsmann, der in der Welt herumreist, heutzutage eher mit dem Flugzeug als mit dem Schiff, auch wenn uns Containerschiffe, die Waren über die Meere bringen, noch recht vertraut sind. Während der Mann geschäftlich unterwegs ist, betrügt ihn seine Ehefrau. Auch das ist eine Möglichkeit, mit der heute noch zu rechnen ist.
Wie agiert und reagiert der Mann in dieser Geschichte? Einleitend wird er als derjenige genannt, der seine Frau inniglich liebe, während ihre Liebe nicht aufrichtig war, sie wurde als valsche minne markiert (V. 6). Der Ehemann nimmt den Betrug wortlos hin, erzieht den Sohn, der angeblich aus Schnee geboren wurde, verantwortungsvoll und aufwendig und nimmt ihn dann beizeiten mit auf Geschäftsreise. Dort verkauft er ihn und macht doppelten Gewinn mit dem Kind, indem er Geld verdient und sich zugleich an seiner Frau rächt. Diese konfrontiert er nach seiner Rückkehr mit ihrer Lüge der Schnee-Empfängnis und sagt, der Junge sei durch den Sturm auf dem Meer von Wasser getroffen und dadurch zu Wasser geworden, er würde aber binnen Jahresfrist sicherlich wieder zu ihr zurückfließen. Mit dieser Aussage knüpft er an ein biblisches Sprichwort an. Kohelet 1,7 sagt: ‚Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen.‘[^3 Der Text der Bibel wird zitiert nach: Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung. Kommentierung von Eleonore Beck, Stuttgart 1980, hier S. 809.] Es ist die Vorstellung eines Kreislaufes der Natur, die der Kaufmann hier formuliert und die List (und den Betrug der Frau) mit einer zweiten List (seiner eigenen) lürzet (V. 86), wie der Erzähler lobt. Schließlich haben schon viele Frauen ihre Männer betrogen. Hier rächt sich nun ein Ehemann für den Vertrauensverlust und Ehebruch, den sie während seiner Abwesenheit betrieben hat. Die Frau, die den Mann betrogen und ihr Kind verloren hat, kommt nicht mehr zu Wort, ihre Reaktion auf die Rache des Ehemannes ist nicht Teil der Geschichte, auch der Fortgang der Ehe wird nicht erzählt.
Nun müssen wir einige Fragen stellen, die uns zu dem Thema der Textdynamiken zurückbringen:
Was hat das ‚Schneekind‘ mit Textdynamik zu tun?
Von wem stammt der Text? Wer ist der Autor?
Von wann stammt der Text? Was wissen wir hierzu?
Hier beginnen einige Schwierigkeiten. Einen Autor dieses Textes kennen wir nicht. Auch die Datierung des Textes ist nicht eindeutig zu benennen.[^4 Grubmüller datiert die Fassung A „vor 1280“ (Grubmüller, Novellistik, S. 1056).] Liegt uns also ein Text ohne Autor und ohne zeitliche Verankerung vor? Steckt diese Unbestimmtheit hinter meiner Frage danach, was wir überhaupt lesen, wenn wir einen mittelalterlichen Text lesen?
Mittelalterliche Literatur ist vielfach anonym überliefert, wir kennen in den Fällen keinen Autor mit Namen, der wie im vorliegenden Fall mit einem Text vom Schneekind zu verbinden wäre.
Die Geschichte vom Schneekind ist eine weit verbreitete Geschichte, sie liegt nicht nur in dieser Version A vor, die wir uns gerade angesehen haben; das deutete ja bereits meine Einschränkung an. Wenn wir eine Fassung A lesen, dann gibt es mindestens noch eine Fassung B dieses Textes. Aber nicht nur diese zwei deutschsprachigen Vers-Fassungen der Geschichte sind existent, sondern eine ganze Reihe von Texten, gut bezeugt im französischen und deutschen Sprachraum, deren „lateinische und volkssprachige schriftliterarisch überlieferte Fassungen nur Reste eines vor allem im Medium der Mündlichkeit lebenden Narrativs sind.“[^5 Nikolaus Henkel: Reduktion als poetologisches Prinzip. Verdichtung von Erzählungen im lateinischen und deutschen Hochmittelalter, in: Die Kunst der brevitas. Kleine literarische Formen des deutschsprachigen Mittelalters. Rostocker Kolloquium 2014. In Verbindung mit Ricarda Bauschke-Hartung und Susanne Köbele hg. von Franz-Josef Holznagel und Jan Cölln (Wolfram-Studien XXIV), Berlin 2017, S. 27–55, hier S. 38.] Von einem Schneekind hat man in vielen europäischen Sprachen erzählt, es scheint sich um einen europaweit bekannten Schwank zu handeln.[^6 Dazu vgl. Grubmüller, Novellistik, S. 1057–1059; Volker Schupp: ‚Das Schneekind‘, in: 2 VL 8, 1992, Sp. 774–777 und Henkel, Reduktion.] Das ‚Schneekind‘ bewegt sich im Mittelalter also in verschiedenen Sprachen und geographischen Räumen Europas.
Anhand der Geschichte vom Schneekind hat man jedoch auch im Schulzusammenhang pointiertes Erzählen eingeübt. Galfried von Vinsauf († 1210), der Lehrer des späteren Richard Löwenherz (Richard I., König von England von 1189–1199), hat sie in sein rhetorisch-poetologisches Handbuch aufgenommen (die ‚Poetria nova‘), und zwar im Abschnitt zur Abbreviatio, also im Abschnitt zur Frage, wie man eine Geschichte möglichst knapp unter Beibehaltung aller wichtigen Aspekte erzählen könne. Die Geschichte vom ‚Schneekind‘ kann man rhetorisch versiert in nur zwei Verse bringen, wie die folgende lateinische Kurzfassung zeigt:
De nive conceptum quem mater adultera fingit
Sponsus eum vendens liquefactum sole refingit.
‚Den (Knaben), von dem die ehebrecherische Mutter vortäuscht (fingit), er sei vom Schnee empfangen, verkauft der Gatte, und sagt, im Gegenzuge täuschend (refingit), die Sonne habe ihn schmelzen gemacht.‘[^7 Lateinischer Text und Übersetzung sind zitiert nach Henkel, Reduktion, S. 40.]
In diesen zwei lateinischen Versen steckt die ganze Geschichte; hier wird nicht ausführlich erzählerisch entfaltet, keine Erziehung des Kindes, keine Ausrüstung, keine Reise sind erwähnt, allein die Pointe und die List-Gegenlist-Logik ist hier umgesetzt; das Stichwort Schnee fällt im zweiten Wort (nive), und sofort eröffnet sich der bekannte Kontext der Geschichte. Kurzfassungen setzen offenbar ein Wissen von der Geschichte voraus oder zumindest einen Wissenden, der das andere Publikum informieren kann.
In dieser lateinischen Kurz-Version wird auch eine Änderung in der Erzählung erkennbar: das Schneekind wird hier von der Sonne geschmolzen, das ist im lateinischen Vers die Pointe, es ist nicht durch Wasser zu Wasser geworden. Und das erinnert wiederum an die mittelhochdeutsche Fassung B des ‚Schneekinds‘. Denn dort fährt der Kaufmann mit dem Sohn nach Ägypten und in der Sonne der Wüste schmilzt das Kind, so lautet die Antwort der Ehefrau gegenüber:
do er kam in egipte lant,
da zerflosz er in dem sant
von der sunnen hitz (‚Schneekind B‘, V. 69–71).[^8 Vgl. Grubmüller, Novellistik, S. 90.]
Das sind inhaltliche Veränderungen einer Geschichte (Wasser – Sonne), sprachliche Veränderungen und Sprachwechsel (lateinisch – deutsch), Gattungswechsel, ein Zweizeiler auf Latein, ein Verstext im Deutschen, die wir als Textbewegungen fassen können. Eine Geschichte bewegt sich in verschiedenen Zusammenhängen des Erzählens, ein Text gerät in Bewegung. Am Text, an der Geschichte wird erkennbar gearbeitet, vom Schneekind wird auf unterschiedliche Weise erzählt, es wird geformt und verändert.
Fassung B des ‚Schneekinds‘ ist ebenfalls eine deutschsprachige Versversion dieser Geschichte, aber sie beginnt bereits abweichend, hat eine andere Pointe (nämlich Hitze und Sonne in Ägypten), umfasst zwar ebenfalls 90 Verse, ist also exakt gleich lang, ist jedoch aufgrund ihrer Änderungen als eigenständige Fassung zu bewerten. Auch hier ist kein Autor genannt. Im ‚Schneekind B‘ wird der Geschichte ein Paratext von vier Versen vorangestellt:
Kain laster er gesat,
der untrü wider gat.
Der ist och ain wiser man,
der stat wol gebiten kan. (‚Schneekind B‘, V. 1–4)[^9 Vgl. Grubmüller, ebd., S. 82.]
Hier schaltet der Erzähler eine Vorbemerkung vor die eigentliche Geschichte, die gewisse Wertungen formuliert: ‚Derjenige, der Untreue erwidert, sät kein Laster aus.
Derjenige ist sogar ein kluger Mann, der eine Situation aushalten (und dabei auf eine gute Gelegenheit warten) kann.‘
Ist der Erzähler parteiisch? Ist er mit diesen Worten offen auf der Seite des Mannes, der keine Schandtat begeht, wenn er das Kind verkauft und seiner Frau durch diese Racheaktion die Antwort auf ihre Untreue gibt? Der Ehemann sei sogar klug, dass er den richtigen Zeitpunkt für seine Reaktion abwarte und nicht die Ehefrau verstoße, eventuell sogar verprügele und bestrafe, wie wir es aus anderen literarischen Texten kennen.[^10 Siegfried bestraft Kriemhild durch Schläge, weil sie die Wormser Königin Brünhild im sogenannten Frauenstreit der 14. Aventiure beleidigt hat: ‚Nibelungenlied‘, Str. 894 (Kriemhild erwähnt die Strafe später vor Hagen). Vgl. Das Nibelungenlied und die Klage. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mittelhochdeutscher Text, Übersetzung und Kommentar. Hg. von Joachim Heinzle, Berlin 2015 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 51), hier S. 286f.] Die Untreue der Frau muss von dem betrogenen Mann klug beantwortet werden, so formuliert diese Einleitung; wie es in der Geschichte erfolgt, sei es keine Untat. Ist das eine klare Beeinflussung der Leser und Hörer oder ist dies eine satirische Überhöhung? Wir sehen auf jeden Fall bereits hier am Texteingang Veränderungen am Text, Erweiterungen der Geschichte, Bewegungen im Wortlaut. Diese Veränderungen, Erweiterungen und Bewegungen können wir als Textdynamiken bezeichnen, um die es in unserem Projekt geht.
Das ‚Schneekind A‘ stammt aus dem 13. Jahrhundert, das ‚Schneekind‘ B ist später entstanden.[^11 Schupp (‚Das Schneekind‘, Sp. 775) datiert B nur als „etwas später als A“, Grubmüller hingegen erwägt einen längeren zeitlichen Abstand: Fassung A „vor 1280“, Fassung B „ist deutlich jünger, genauere Anhaltspunkte fehlen (Ende 14. Jahrhundert?)“ (Grubmüller, Novellistik, Sp. 1056).] Der Stoff (die materia) ist jedoch älter und vom 11. bis ins 19. Jahrhundert verbreitet,[^12 Schupp, ‚Das Schneekind‘, Sp. 775.] vorerst in lateinischer Sprache, der Gelehrtensprache, dann auch übertragen in viele europäische Sprachen, in Liedern und Texten wie den vorgestellten.[^13 Die erste literarische Umsetzung liegt in einem lateinischen Schwank, dem ‚Modus Liebinc‘, vor, dazu vgl. Volker Schupp: ‚Modus Liebinc‘, in: 2 VL 6, 1987, Sp. 630–632.] Die Erzählung lebt weit über das Mittelalter hinaus. Dass sie auch im Lateinischen vorliegt, zeigt uns, dass sie nicht nur zur Populärliteratur zu zählen ist, sondern auch in den Kreisen der Intellektuellen oder angehenden Intellektuellen bekannt war und dort sogar Gegenstand des Sprachunterrichts wurde.
Wir haben mit dem ‚Schneekind‘ einen Text gelesen, der eine Version einer weit verbreiteten Geschichte darstellt. Man hat von diesem Schneekind erzählt, lange kursierte die Geschichte vermutlich mündlich, dann wurde sie zum Text, wurde schriftliterarisch fixiert, im und für den lateinischen Unterricht, aber auch in der deutschen Erzähl- und Liedliteratur. Aus einer Geschichte, die in der Mündlichkeit lebte, wurde geschriebene Literatur. Eine Geschichte wurde zum Text, der wiederum nicht als fester Text kursierte, sondern in verschiedenen Fassungen tradiert wurde. Ein variables Erzählen vom Schneekind ist im gesamten Mittelalter und weit darüber hinaus bezeugt. D.h. wir haben nicht nur einen Text erhalten, sondern verschiedene Texte und verschiedene Fassungen überliefert. Das ist die Beweglichkeit der mittelalterlichen Literatur, die ich anfangs angesprochen habe. Wir müssen uns Literatur des Mittelalters mündlich erzählt vorstellen, in ganz verschiedenen Räumen der Mündlichkeit, am Fürsten- oder Bischofshof, bei Festen, beim Ausreiten, aber auch im Schulunterricht. Daneben ist Literatur auch schriftfixiert. Hierbei ist zu bedenken, was für einen langen Zeitraum des Mittelalters galt: Texte wurden per Hand kopiert, denn Vervielfältigungsmöglichkeiten wie der Buchdruck oder das Vervielfältigen durch Holztafeldruck entstehen erst ab den 1420er und den 1450er Jahren. Vorher musste ein Text aufwendig handschriftlich abgeschrieben werden, wenn man ihn vervielfältigen wollte, wenn man eine zweite oder dritte Kopie haben wollte. Wir sprechen von der handschriftlichen Überlieferung der Texte und können für das deutsche ‚Schneekind‘ heute immerhin noch sechs Handschriften nennen, die aus dem 13., dem 14. oder dem 15. Jahrhundert stammen. Es sind Handschriften, die diese Geschichte vom Schneekind überliefern, und die wir in die zwei Fassungen, A und B ordnen können.[^14 Zur handschriftlichen Überlieferung des ‚Schneekinds‘ s. die Angaben im Handschriftencensus unter: https://handschriftencensus.de/werke/2225 (abgerufen am 12. Oktober 2022).]
Wenn wir ‚das Schneekind‘ lesen wollen, müssen wir präziser benennen, was wir meinen.
Welches ‚Schneekind‘ lesen wir? Eine lateinische Version, einen deutschen Verstext, Fassung A oder Fassung B?[^15 Zu den Unterschieden der beiden Fassungen s. Nora Eichelmeyer und Matthias Kirchhoff: List, lüg und snöder reichtum. Zum Wandel der Schuldbewertung im ‚Schneekind‘ A und B, in: ZfdA 145, 2016, S. 343–356.] Hieran ist bereits die Relevanz der eingangs gestellten Frage (Welchen Text lesen wir, wenn wir einen mittelalterlichen Text lesen?) erkennbar.
Mittelalterliche Schreiber haben dem Text vom Schneekind bereits einen Namen gegeben, aber auch hierfür gibt es keine festgefügte Einheitlichkeit: Von einem kaufman heißt der Text in der einen Handschrift (München, Universitätsbibliothek, Cim. 4, f. 85rb), Daz mer von ainem sne pallen oder Daz mer von dem sne pallen heißt der Text in zwei anderen Handschriften (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2885, f. 126va oder Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Hs. FB 32001, f. 8ra), auch titellos ist der Text tradiert (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2705 und Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Donaueschingen 93).[^16 Dazu vgl. Deutsche Versnovellistik des 13. bis 15. Jahrhunderts, Bd. 1/1, S. 49 (Textapparat) und S. 53 (Handschriften).] Die mittelalterlichen Titel nennen also in den deutschen Fassungen A einen Kaufmann oder einen (den) Schneeball als Identifikationspunkt der Geschichte, der Titel Schneekind ist eine spätere Setzung in der Fassung B.[^17 Hierzu vgl. Deutsche Versnovellistik des 13. bis 15. Jahrhunderts, Bd. 4, S. 291 (Textapparat).]
Wir lesen also, wenn wir einen mittelalterlichen Text lesen, einen von einem Schreiber handschriftlich fixierten und kopierten Text. Texte des Mittelalters sind Manufaktur.
In diese Handarbeit fließt vielfach individuelle Variation: Arbeit am Text, Arbeit an der Geschichte, bewusste Veränderung oder Veränderung aus einer gewissen Nachlässigkeit des Schreibers heraus, bewusste Änderung am Wortlaut, Fehlerhaftigkeit durch Übermüdung, viele Möglichkeiten sind hier zu bedenken, die Änderungen, Bewegungen des Textes zur Folge haben können.
Veränderungen sind der mittelalterlichen Literatur also inhärent. Sie können aber verschiedene Gründe haben. Ein zweiter Text kann völlig unabhängig von dem ersten schriftlich fixiert worden sein und eine im Kern vergleichbare, aber in der Ausführung abweichende Geschichte tradieren. Ein Text kann aber auch sehr nah an einer Vorlage bleiben, oder er kann einen lateinischen Text ins Deutsche übertragen.
Neben der Manufaktur eines Textes und der schriftlichen Fixierung muss man jedoch weiterhin mit der mündlichen Tradierung rechnen, vom Schneekind (und vielen anderen Texten) wurde das gesamte Mittelalter über auch mündlich erzählt. Das lesen wir an den verschiedenen Text-Versionen ab, die bis heute existieren und die aus unterschiedlichen Regionen stammen, aber auch an der Tatsache, dass Literatur oftmals in ein Bild-Medium übertragen erzählt wurde. Bilder sind als Kurzformen von Geschichten oder als Begleitmedium zu einer Handschrift oder einer gedruckten Version des Textes zu nennen. Vom ‚Schneekind‘ gibt es keine illustrierte Textfassung des Mittelalters. Aber das Thema ist in ähnlicher Form sehr viel später, nämlich 1904, von dem Berliner Maler Heinrich Zille umgesetzt worden (Abb. 1).

Abbildung 1: Heinrich Zille: Fünf Geschwister, 1904. Bild (Postkarte): Archiv K.D. ©publicon Verlagsgesellschaft mbH, Poststr. 12, 10178 Berlin.
Fünf Kinder verschiedenen Alters halten sich an den Händen, sind von schräg hinten gezeichnet, sie tragen teilweise Mützen, Schals oder festes Schuhwerk. Die Bildunterschrift setzt eine kesse oder vielleicht auch naive Äußerung eines der Kinder um: „Vater wird sich freuen, wenn er aus dem Zuchthaus kommt, dass wir schon so viele sind.“[^18 Zitiert und abgebildet nach einer Postkarte: Heinrich Zille, Fünf Geschwister, 1904. Bild: Archiv K.D. ©publicon Verlagsgesellschaft mbH, Poststr. 12, 10178 Berlin. Der Text auf dem Bild lautet im Original: „Vater wird sich freiʼn, wenn er ausʼt Zuchthaus kommt, det wir schon so ville sind!“] Hier ist ebenfalls eine Vermehrung der Nachkommen zu beobachten, bei der der Ehemann wohl nicht anwesend war. Das Motiv des Ehebruchs bei Abwesenheit des einen Ehepartners ist Anlass für eine Auseinandersetzung in der Kunst und Literatur, auch lange nach der mittelalterlichen Erzählung vom ‚Schneekind‘.
Text- und Bildebene
Kehren wir zur mittelalterlichen Literatur zurück, deren Inhalte und Themen mehrfach in eine zweite Ebene neben dem Text übertragen werden, nämlich in eine Bildebene. Literatur des Mittelalters wird in den sie überliefernden Textzeugen (Handschriften und Drucken) mehrfach von Illustrationen begleitet, Text und Bild gehen hierbei eine synoptische Einheit ein, man liest den Text und man sieht einzelne Szenen im Bild. Dies soll an einem Beispiel aus der ‚Tristan‘-Literatur verdeutlicht werden (Abb. 2), und zwar aus dem ersten deutschsprachigen ‚Tristan‘-Roman des Eilhart von Oberg, dem ‚Tristrant‘ (entstanden in den 1170er Jahren), hier in einer Handschrift, die auf um 1465 datiert wird (Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 346, f. 4r).[^19 Zur Handschrift vgl. Handschriftencensus: https://handschriftencensus.de/4921 (abgerufen am 13. Oktober 2022). Die Handschrift steht als Digitalisat zur Verfügung unter: https://doi.org/10.11588/diglit.154#0021 (abgerufen am 26. Februar 2023). Die Abbildungen daraus sind open access verfügbar.]

Abbildung 2: Eilhart von Oberg: ‚Tristrant‘: Tristan wird zur Erziehung einer Amme übergeben, kolorierte Federzeichnung der Handschrift Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 346, f. 4r.
Der kleine Tristrant wird zur Erziehung einer Amme übergeben. Die Mutter Tristrants ist bei der Geburt des Jungen gestorben, der Vater, König Riwalin übergibt das Neugeborene (im Text: daz vil lîbe kindelîn, V. 122), einer Amme, die es aufzieht.[^20 Der ‚Tristrant‘ wird zitiert nach der Ausgabe: Eilhart von Oberge. Hg. von Franz Lichtenstein, Hildesheim/New York 1973 (Nachdruck der Ausgabe Straßburg und London 1877) (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker XIX).] Ein Maler hat dies in eine Bildszene übertragen (f. 4r), das Baby ist hier nicht als solches dargestellt, das kindelîn kann hier bereits eigenständig stehen und ist sicher schon zwei bis drei Jahre alt. Das Bild setzt den Inhalt anders um als der Text.
Der gesamte Verstext der Handschrift von Eilharts ‚Tristrant‘ wird von 91 kolorierten Federzeichnungen begleitet. Eine zweite Szene aus diesem Roman in dieser Handschrift ziehe ich heran (Abb. 3): die sogenannte Schwalbenhaar-Episode (Cpg 346, f. 27r).

Abbildung 3: Die sogenannte Schwalbenhaarepisode aus dem Eilhartschen ‚Tristrant‘ in der Handschrift Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 346, f. 27r (kolorierte Federzeichnung).
König Marke sitzt in seiner Kemenate und denkt nach; die Barone an seinem Hof wollen, dass er sich verheiratet, damit die Nachfolge der Herrschaft gesichert ist. Marke will jedoch nicht heiraten (V. 1379: wen he enwolde wîbes nît), er ist glücklich in dem Zustand des Augenblicks, sein Neffe Tristrant lebt bei ihm, das ist ihm Freundschaft und Anregung genug. In dieser Situation des Nachdenkens setzt das Bild an, es passiert etwas, ein Zufall bringt Marke auf eine Idee: Zwei Schwalben fliegen nämlich durch das geöffnete Fenster in den Raum hinein und kämpfen miteinander, sie tragen (zufällig) ein langes Haar mit sich (V. 1381–1387). Marke hat daraufhin eine Idee und einen Plan: Diejenige Frau, der dieses Haar gehört, soll seine Ehefrau werden. Diese Frau muss man finden. Wie soll das gehen? Tristrant wird sich darum kümmern, er nimmt sich dieser Aufgabe an, er sagt zu Marke: ich wil ez dorch ûwern willen tûn / und wil sie wîte sûchin (V. 1450f.). Diese Szene des Eilhart-Textes setzt der Maler in eine Illustration um, er zeigt die Kemenate, den König, die beiden Schwalben und das lange Haar und markiert diese Szene durch die bildliche Umsetzung als eine besondere. Mit der Suche Tristrants nach einer Ehefrau für König Marke beginnt zugleich die verhängnisvolle Geschichte einer Dreiecksbeziehung zwischen Marke, Tristrant und Isalde.
Von Tristan und Isolde (oder bei Eilhart: Tristrant und Isalde) ist im gesamten Mittelalter und im gesamten europäischen Raum intensiv erzählt worden, davon zeugen die erhaltenen Texte, aber auch die vielfältigen Bildmedien: Kunstgegenstände, Kästchen, Spiegelkapseln, Kämme, Bildteppiche, Wandmalereien, immer wieder hat man hat sich mit dieser Tristanfigur und seiner Geschichte umgeben.[^21 Dazu vgl. Stephanie Cain Van DʼElden: Tristan and Isolde. Medieval Illustrations of the Verse Romances, Turnhout 2016.] Die Liebe zu Isolde war ein großes Thema für die Literaten und Erzähler des Mittelalters, war aber auch Streitthema, schließlich beruhte die Liebe auf einem Minnetrank, auf einer Art Droge.[^22 Explizit als „Droge“ benennt Jan-Dirk Müller den Trank (Die Destruktion des Heros oder wie erzählt Eilhart von passionierter Liebe?, in: Il romanzo di Tristano nella letteratura del Medioevo. Der Tristan in der Literatur des Mittelalters, a cura di Paola Schulze-Belli / Michael Dallapiazza, Triest 1990, S. 19–37, hier S. 24f.).] Tristan liebte nur, so sagten einige (z. B. Heinrich von Veldeke), weil er einen giftigen Trank zu sich genommen hatte, ein poisûn zwang ihn zur Liebe (MF 58,37).[^23 Heinrich von Veldeke: Tristran muose sunder sînen danc / staete sîn der küneginne, / wan in daz poisûn dar zuo twanc / mêre danne diu kraft der minne (Des Minnesangs Frühling, bearbeitet von Hugo Moser und Helmut Tervooren, I Texte, 38., erneut revidierte Auflage. Mit einem Anhang: Das Budapester und Kremsmünsterer Fragment, Stuttgart 1988, S. 108).] Die Liebe war also unecht, sie war gewissermaßen gedopt und vergiftet, sie zählt nicht als wahre, als echte menschliche Liebe. Trotzdem oder gerade deswegen ist die Geschichte von Tristan, Isolde und Marke immer wieder und immer wieder erzählt worden.[^24 Vgl. Monika Schausten: Erzählwelten der Tristangeschichte im hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den deutschsprachigen Tristanfassungen des 12. und 13. Jahrhunderts, München 1999 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur 24).] Große Romane liegen uns zu dieser Liebe vor, Gottfried von Straßburg schafft mit seiner Version von Tristan und Isolde (entstanden um 1210) einen Klassiker. Er entfaltet die Geschichte intensiv, die Geschichte von Liebe und Leid, vom guten Menschen, von der Kunst und der Leistung der Kunst, auf die wir so angewiesen sind. Literatur ist unser Brot, sagt der Prolog: wir lesen ir leben, wir lesen ir tôt / und ist uns daz süeze alse brôt (V. 235f.), ‚Wir hören von ihrem Leben, hören von ihrem Tod, und das ist uns köstlich so wie Brot‘.[^25 Gottfried von Strassburg, Tristan und Isolde. Hg. von Walter Haug † und Manfred Günther Scholz. Mit dem Text des Thomas, hg., übersetzt und kommentiert von Walter Haug †, 2 Bde., Berlin 2012, S. 22f. Im Prolog lautet die Stelle weiter: Ir leben, ir tôt sint unser brôt. / sus lebet ir leben, sus lebet ir tôt. / sus lebent si noch und sint doch tôt. / und ist ir tôt der lebenden brôt (V. 37–240, Bd. 1, S. 22–24). Das Leben von Tristan und Isolde wird als unser Brot benannt, ihr beider Tod ist das Brot für die Lebenden.]
Fazit
Was haben wir nun mit den verschiedenen Beispielen erreicht? Was lesen wir, wenn wir einen mittelalterlichen Text lesen? Wir sind nun für diese Frage sensibilisiert, denn wir haben verschiedene Bedingungen, Veränderungen, Umwandlungen, Medienwechsel beobachtet. Literatur des Mittelalters ist nicht nur als Text (in einer modernen Edition) existent, sondern vor allem als mündliche Erzählung, die wir vermuten, von der wir jedoch (Binsenwahrheit) keine Audioquellen aus dem Mittelalter besitzen. Bisweilen ist Literatur in illustrierten Texten vorhanden, überliefert ist sie in verschiedenen Textzeugen, die voneinander abweichen können. Literatur ist auch übertragen worden in Bildmedien (illustrierte Handschrift, Teppich, Wandmalerei etc.). Hier ist sie in einer Szene oder in einem Motiv (Schwalbenhaar, der junge Tristrant) verkürzt und pointiert gefasst oder auch als Serienerzählen wie in Bildteppichen oder Wandmalereien möglich. Diese angedeuteten Phänomene erweisen sehr eindrücklich die Eigenschaft der Textdynamik mittelalterlicher Literatur.
Wir haben einen Text kennengelernt, der eine Geschichte vom Schneekind bietet, die uns (heute) durchaus irritiert. Sie erzählt davon, wie der eine Ehepartner den Betrug des anderen erst aushält, dann aber adäquat darauf reagiert, eine List muss mit einer anderen List beantwortet und die Tat damit gerächt werden, so die Lehre des Textes. Zwei deutsche Fassungen in gewisser Variation existieren neben mehreren anderen Versionen vom Schneekind in lateinischer oder französischer Sprache.
Wir schauen heute gleichsam in einem distant reading auf die uns erhaltenen schriftlichen Zeugnisse aus dem Mittelalter und erkennen an den mehrfachen Umsetzungen von ‚Schneekind‘ und Tristanerzählung ein lebhaftes Interesse an einem Stoff, an einer Geschichte und einem Motiv. Es ist nicht nur Interesse, sondern diese verschiedenen Umsetzungen bilden ein kulturelles und literarisches Gespräch ab, wie es die Text- und Bildzeugnisse andeuten.[^26 Dazu vgl. die beiden Aufsatzbände: Literatur und Wandmalerei I. Erscheinungsformen höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter. Hg. von Eckart Conrad Lutz u.a. Tübingen 2002; Literatur und Wandmalerei II. Konventionalität und Konversation. Hg. von Eckart Conrad Lutz u. a. Tübingen 2005.] Man wollte die literarischen Helden um sich haben (im privaten oder auch öffentlichen oder halböffentlichen Raum), man sprach über sie, und zwar auf verschiedene Art und Weise, die sich umgesetzt in Kunstwerke bis heute erhalten haben.
Literatur des Mittelalters existiert in vielerlei Form, mündlich erzählt und weitererzählt, schriftlich fixiert und poetisch geformt. Nicht immer kennen wir die Autoren, bisweilen sehen wir bereits mittelalterliche Titel für die Texte, die zwar voneinander abweichen, aber dieselbe Geschichte meinen: Von einem Kaufmann oder Von einem Schneeball (s.o.). Manchmal fügt ein Schreiber eine moralische Wertung ein, stellt sie der Geschichte voran oder beschließt die Erzählung damit. Am Text wird gearbeitet. Die Vorstellung eines festen und unabänderlichen Autortextes ist eine Idee, die im späteren Mittelalter aufkommt, die jedoch in den Jahrhunderten vor dem 15. Jahrhundert sehr flexibel ausgelegt wurde. Der gelehrte Dominikaner Heinrich Seuse (1295/97–1366) stellt seiner Werkausgabe eine Bedingung voran, die sich an die Kopisten richtet, nämlich nichts am Wortlaut zu ändern, jedes Wort, jeder Gedanke habe eine logische Berechtigung;[^27 Dazu vgl. Sabine Griese: Heinrich Seuse in Ulm, Marbach 2017 (Spuren 113), S. 6f.] wir kennen eine Praxis des Abschreibens und Tradierens, die leichtfertig und bisweilen intensiv dagegen verstößt. Texte werden den Autoren aus der Hand genommen und korrigierend bearbeitet, tradiert, kopiert, verändert. Das ist die Arbeit am Text, die wir in den Jahrhunderten des Mittelalters an der Überlieferung ablesen und daran sehen, wie lebendig und beweglich, in gewisser Weise auch unruhig die mittelalterliche Erzählkultur war. Das Thema Textdynamik ist mit der mittelalterlichen Literatur eng verbunden.
Primärliteratur
- Bibel. Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung. Kommentierung von Eleonore Beck, Stuttgart 1980.
- Eilhart von Oberge. Franz Lichtenstein (Hg.), Hildesheim/New York 1973 (Nachdruck der Ausgabe Straßburg und London 1877) (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Völker XIX).
- Gottfried von Straßburg, Tristan und Isolde: Walter Haug † /Manfred Günther Scholz (Hgg.). Mit dem Text des Thomas, hg., übersetzt und kommentiert von Walter Haug †, 2 Bde., Berlin 2012.
- Des Minnesangs Frühling, bearbeitet von Hugo Moser und Helmut Tervooren, I Texte, 38., erneut revidierte Auflage. Mit einem Anhang: Das Budapester und Kremsmünsterer Fragment, Stuttgart 1988.
- Das Nibelungenlied und die Klage. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mittelhochdeutscher Text, Übersetzung und Kommentar. Joachim Heinzle (Hg.), Berlin 2015 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 51).
- Das Schneekind A und B, in: Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Hg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller, Frankfurt a. M. 1996 (Bibliothek des Mittelalters 23 / Bibliothek deutscher Klassiker 138), S. 82–93.
- ‚Schneekind A‘, in: Deutsche Versnovellistik des 13. bis 15. Jahrhunderts (DVN). Band 1/1: Nr. 1–38. Klaus Ridder /Hans-Joachim Ziegeler (Hgg.), Berlin 2020, S. 49–54 (Nr. 13).
- ‚Schneekind B‘ in: Deutsche Versnovellistik des 13. bis 15. Jahrhunderts (DVN), Band 4: Nr. 125–175. Klaus Ridder / Hans-Joachim Ziegeler (Hgg.), Berlin 2020, S. 291–294 (Nr. 154).
Sekundärliteratur
- Cain Van D’Elden, Stephanie: Tristan and Isolde. Medieval Illustrations of the Verse Romances, Turnhout 2016.
- Eichelmeyer, Nora und Kirchhoff, Matthias: List, lüg und snöder reichtum. Zum Wandel der Schuldbewertung im ‚Schneekind‘ A und B, in: ZfdA 145, 2016, S. 343–356.
- Griese, Sabine: Heinrich Seuse in Ulm, Marbach 2017 (Spuren 113).
- Henkel, Nikolaus: Reduktion als poetologisches Prinzip. Verdichtung von Erzählungen im lateinischen und deutschen Hochmittelalter, in: Die Kunst der brevitas. Kleine literarische Formen des deutschsprachigen Mittelalters. Rostocker Kolloquium 2014. In Verbindung mit Ricarda Bauschke-Hartung und Susanne Köbele. Franz-Josef Holznagel /Jan Cölln (Hgg.), (Wolfram-Studien XXIV), Berlin 2017, S. 27–55.
- Literatur und Wandmalerei I. Erscheinungsformen höfischer Kultur und ihre Träger im Mittelalter. Eckart Conrad Lutz u.a. (Hgg.), Tübingen 2002.
- Literatur und Wandmalerei II. Konventionalität und Konversation. Eckart Conrad u.a. (Hgg.), Tübingen 2005.
- Müller, Jan-Dirk: Die Destruktion des Heros oder wie erzählt Eilhart von passionierter Liebe?, in: Il romanzo di Tristano nella letteratura del Medioevo. Der Tristan in der Literatur des Mittelalters, a cura di Paola Schulze-Belli / Michael Dallapiazza, Triest 1990, S. 19–37.
- Schausten, Monika: Erzählwelten der Tristangeschichte im hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den deutschsprachigen Tristanfassungen des 12. und 13. Jahrhunderts, München 1999 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur 24).
- Schupp, Volker: ‚Modus Liebinc‘, in: ² VL 6, 1987, Sp. 630–632.
- Schupp, Volker: ‚Das Schneekind‘, in: ² VL 8, 1992, Sp. 774–777.
Beitrag 2
Minnesang im Spannungsfeld der Kulturen. Das dynamische Bild der Entstehung einer Gattung
Unter ‚Minnesang‘ versteht man mittelhochdeutsche Liebeslyrik, wie es sich bereits im ersten Bestandteil des Begriffs andeutet:[^1 Der diesem Beitrag zugrunde liegende Vortrag sollte aus dem Blickwinkel des Ober themas exemplarisch in die Gattung Minnesang einführen. Diese Zielrichtung wird auch in der Schriftfassung beibehalten. Dementsprechend beschränke ich mich in den Fußnoten auch auf wenige grundlegende Literaturhinweise und Lektüreempfehlungen.] Das mittelhochdeutsche Wort minne ist in der Neuzeit nicht mehr gebräuchlich und verrät bereits so den Bezug zu der Zeit um 1200, darüber hinaus birgt es semantisch ein anderes Verständnis von Liebe, als wir es in moderner Lyrik vorfinden. Der zweite Bestandteil ist ebenso wichtig und bezeichnet etwas, was in aller Regel weniger präsent ist: ‚Sang‘ meint gesungene Lieder über Liebe. Das ist so wichtig zu betonen, da die Melodien in den allermeisten Fällen verloren gegangen und heute nur noch die Texte zugänglich sind, so dass man den Eindruck gewinnen könnte, es handle sich um Leselyrik. In manchen Fällen ist bekannt, dass ein Lied auf dieselbe Melodie gesungen wurde wie ein altfranzösisches oder provenzalisches, die noch bekannt ist. Aber alles in allem sind es wenige Einzelfälle.
Die Texte haben wir dank einer Reihe von Handschriften zur Verfügung, die uns ein paar Dinge über Minnesang verraten. Die wichtigsten drei, zugleich die ältesten, sind um 1300 herum im südwestdeutschen Sprachraum entstanden und auch heute dort aufbewahrt. Sie enthalten Lieder von den Anfängen des Minnesangs um 1150 bis zur Entstehungszeit der Handschriften selbst, überliefern damit eine Tradition, deren Anfänge bereits damals in der historischen Vergangenheit lagen und deren prominente Vertreter wie Heinrich von Morungen, Friedrich von Hausen oder Walther von der Vogelweide – um nur drei Namen zu nennen – schon lange nicht mehr leben. Die erste dieser drei ist die nach ihrem Aufbewahrungsort so genannte ‚Kleine Heidelberger Liederhandschrift‘, die in der Forschung mit der Sigle A bezeichnet wird. Sie stammt aus dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts und wird in der Universitätsbibliothek Heidelberg unter der Signatur Cpg 357 aufbewahrt.[^2 Die Handschrift ist im Volldigitalisat zu lesen und zu durchsuchen unter https://doi.org/10.11588/diglit.164 (12.11.2022); nähere Informationen unter https://handschriftencensus.de/4927 (12.11.2022).] Die zweite mit der Sigle B ist zwischen 1300 und 1320 entstanden und heute in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart unter der Signatur HB XIII zu finden.[^3 Volldigitalisat: https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=12064&tx_dlf%5Bpage%5D=1 (12.11.2022), weitere Informationen unter https://handschriftencensus.de/5914 (12.11.2022).] Ursprünglich war sie in der Bibliothek des Klosters Weingarten, weshalb sie auch Weingartener Liederhandschrift genannt wird. Die dritte, die bekannteste von allen, trägt die Sigle C und wird, da sie auch in Heidelberg aufbewahrt wird (mit der Signatur Cpg 848) und wesentlich umfangreicher als A ist ‚Große Heidelberger Liederhandschrift‘ oder, nach dem mutmaßlichen Mäzen und Financier, auch Manessische Liederhandschrift genannt.[^4 Volldigitalisat unter: https://doi.org/10.11588/diglit.2222 (12.11.2022). Eine Einführung in Entstehung und Geschichte bei Voetz, Lothar (2020); weitere Literatur unter obigem Link, auch unter https://handschriftencensus.de/4957 (12.11.2011).]
Alle drei Handschriften sind so genannte Sammelhandschriften; sie wurden also angelegt, um eine (insbesondere im Falle von C möglichst vollständige) Sammlung mittelhochdeutscher Liebeslyrik zu haben. Sie macht den Kern aller drei aus, auch wenn sich z. B. auch Spruchdichtung darin findet. Alle drei sind nach Autoren gegliedert, indem jede Abteilung mit einem stilisierten Portrait beginnt, das den jeweiligen Sänger mit Attributen darstellt, die sich aus seinen Liedern ergeben. Dazu kommt stets ein Wappen, das auch erfunden sein kann, wo es nicht mehr bekannt war, oder wenn die Familie des Sängers nicht adlig war und keines hatte (wie etwa im Fall Walthers von der Vogelweide). Hinter dem Bild des Sängers folgen dann dessen Lieder; freigelassene Blätter nach dem letzten und vor dem Portrait des folgenden zeigen an, dass man noch damit rechnete, weitere Lieder zu finden und diese dann einzutragen. In C sind einige solche Fälle sichtbar.
Die Textgattung Minnesang, die in diesen und weiteren Handschriften überliefert wird, verdankt die erste große Entwicklung vor allem einer Dynamik aus der Begegnung mit dem altfranzösischen und dem altprovenzalischen Minnesang und der Aufnahme und Verarbeitung neuer Motive und Formen daraus. Um diese Dynamik soll es hier gehen. Dazu möchte ich die Gattungsgeschichte über die klassischen drei ersten Phasen zwischen 1150 und 1200 nachzeichnen und dabei deutlich machen, wie die Entwicklung über diese drei Phasen hin verlief.[^5 Zum Minnesang und den aktuellen Fragen der Forschung Kellner, Beate (2018).]
Donauländischer Minnesang
Fast alles, was wir über diese Entwicklung wissen, müssen wir aus der Überlieferung der Handschriften heraus rekonstruieren. Es beginnt mit dem so genannten donauländischen Minnesang, dem man die ältesten, ab 1150 entstehenden Lieder zurechnet. Die Sänger, die hier mit Namen genannt werden, kann man an Höfen lokalisieren, welche an der Donau liegen, deshalb wird diese erste Phase so genannt. Beispiele sind die Burggrafen von Regensburg und von Rietenburg, oder möglicherweise Dietmar von Aist, benannt nach dem Fluss Aist, der bei Linz in die Donau mündet. Auch der Kürenberger könnte an der Donau lokalisiert werden.[^6 Diskussion der möglichen Herkunft des Kürenberges bei Schweikle, Günther (1985).] Generell muss hier festgehalten werden, dass oft die Zuschreibungen der Lieder in den Handschriften variieren und die die Autorschaft eines Sängers für einzelne Lieder aus dem unter seinem Namen überlieferten Corpus in der Forschung oft in Frage gestellt wurde.
Diese Lieder sind Zeugnisse der sich im deutschen Sprachraum derzeit etablierenden Höfischen Kultur, die ihren Ursprung in Frankreich hat, wo Minnesang als Form der Repräsentation dieser Kultur bereits bekannt war. Auf welche Traditionen der Lieddichtung die deutschen Sänger an der Donau sich stützten, ist schwer zu sagen; man findet Anklänge von mündlich überlieferten Volksliedern wie auch von der gebildeten lateinischen Lyrik, die in deutschen Klöstern schon immer überliefert und gepflegt wurde. Vieles lässt sich einfach nicht mehr erschließen. Was die frühen Zeugnisse verbindet, ist vor allem die metrische Form der Langzeilenstrophe und der fehlende Einfluss von Konzepten und Motiven aus dem romanischen Minnesang, insbesondere des so genannten Frauendienstes, auf den ich noch kommen werde.[^7 Hierzu Benz, Maximilian (2014).] Das erste Beispiel dieser frühen Phase sollen Strophen sein, die unter dem Namen des bereits genannten Kürenbergers überliefert sind.
Der ‚Kürenberger‘
In der Handschrift C finden sich nach seinem Portrait zunächst zwei Strophen metrisch gleicher Bauform, gefolgt von 13 Strophen, die diese Bauform leicht variieren:[^8 Zum Kürenberger informiert aktuell der Artikel von Benz, Maximilian (2021).] Hier werden vier Zeilen durch Paarreim zu einer Strophe verbunden. Sie bestehen aus zwei Teilen, einem An- und einem Abvers. Ersterer hat in der Regel vier und letzterer drei Hebungen; sie sind durch eine Zäsur in der Mitte getrennt. Diese so genannten Langzeilenstrophen sind die charakteristische Form der Lieder dieser frühesten Phase. Ihre Form entspricht jener, mit denen das Nibelungenlied erzählt wird, das wohl in Passau und damit im selben geographischen Raum entstanden ist.
Inhaltlich bilden diese Strophen allerdings keinen durchgehenden (Erzähl-)Zusammenhang wie das ‚Nibelungenlied‘. Mal beziehen sich zwei deutlich aufeinander; die meisten stehen allerdings einzeln für sich und lassen sich allenfalls thematisch mit der folgenden verbinden. Der Redaktor der Handschrift hat offenbar alle Strophen zusammengestellt, die unter dem Namen des Kürenbergers bekannt waren und sie in eine gewisse Ordnung gebracht. Ein erstes Beispiel soll die vierte in C enthaltene sein:[^9 Ich verwende die Texte des Projekts Lyrik des deutschen Mittelalters, dabei wähle ich unter ‚Einstellungen‘ den Text in normalisiertem Mittelhochdeutsch in den Grundeinstellungen aus. Geboten werden jeweils Transkription, Edition, Kommentierung und Digitalisat. Die Strophen des Kürenbergers finden sich mit Edition und Kommentar von Simone Leidinger unter https://www.ldm-digital.de/show.php?au=K%FCrn&hs=B2&lid=1626 (12.11.2022).]
›Swenne ich stân aleine in mînem hemede,
unde ich gedenke an dich, ritter edele,
sô erblüet sich mîn varwe, als der rôse an dem dorne tuot,
unde gewinnet daz herze vil manegen trûrigen muot.‹
‚Immer, wenn ich in meinem Hemd alleine stehe,
und ich, edler Ritter an dich denke,
dann erblüht meine Farbe, wie die der dornigen Rose
und mein Herz füllt sich mit großer Trauer.‘
Sie erzählt von der Sehnsucht nach einem edlen Ritter, der Sehnsucht – so lässt sich schließen – einer Dame, die hier mit dem Sänger-Ich identisch ist. In direkter Ansprache erzählt sie diesem Ritter von der Erinnerung an ihn und kleidet dies in Bilder, die vergangene erotische Erfüllung andeuten: sie ist alleine, sie erwähnt ihr Hemd und dass sie beim Gedanken an ihn rot wird, eher aus Erregung denn vor Scham. Der Vergleich mit der rôse an dem dorne greift ein Bild aus der Marienlyrik auf. Das mag erstaunlich wirken, war aber im Mittelalter nicht selten. Offenbar konnte man mit solchen Anspielungen einer Schönheitsbeschreibung noch mehr Intensität verliehen.
Der letzte Vers kontrastiert dies dann mit der großen Trauer, die ihr Herz im Moment erleidet, offenbar, weil das Paar nun voneinander getrennt ist. Was die beiden trennt, bleibt offen; in den Versen geht es lediglich um die Schilderung der schmerzlich-sehnsuchtsvollen Erinnerung, die nicht narrativ begründet werden muss.
Die folgende Strophe bleibt bei einem ähnlichen Thema; möglicherweise wurde sie deshalb im Anschluss aufgeschrieben. Sie lautet:
ez hât mir an dem herzen vil dicke wê getân
daz mich des geluste des ich niht mohte hân
noch niemer mac gewinnen. Daz ist schedelîch.
jône mein ich gold noch silber: ez ist den liuten gelîch.
‚Es hat mir im Herzen sehr oft weh getan,
dass ich mich nach dem sehnte, was ich nicht haben konnte
noch jemals erlangen kann. Das ist nicht gut.
Doch meine ich weder Gold noch Silber: Das ist den Menschen ähnlich.‘
Auch hier handeln die ersten drei Zeilen vom Schmerz einer unerfüllten Sehnsucht, die offenbar auch nicht zu erfüllen war. Wir erfahren weder genau, was oder wer ersehnt wurde, noch, ob der Sänger hier in der Rolle einer Dame singt oder eines Ritters, ob das Sänger-Ich also männlich oder weiblich zu denken ist.[^10 Da man davon ausgeht, dass der Vortrag dieser Strophen in der Regel von Männern erfolgte, die auch die Frauenstrophen sangen, belasse ich den Begriff ‚Sänger-Ich‘ bewusst in der maskulinen Form. Zeugnisse von Sängerinnen sind bislang nur aus dem provenzalischen Minnesang bekannt; als prominenteste wäre die Gräfin Beatriz von Die, die ‚Comtessa de Dia‘ zu nennen.] Erst die letzte Zeile verdeutlicht mit dem Hinweis, das Sehnen richte sich nicht auf Edelmetall, dass es um Immaterielles geht, nämlich, wie der Kontext nahelegt, um Liebe. Die Sehnsucht nach materiellen Werten sei dem gemeinen Volk, den liuten gleich und damit etwas Minderwertiges, von dem das Sänger-Ich sich abheben möchte.
An diesen beiden Strophen zeigt sich bereits mehreres: Die Liebe wird häufig aus dem Zustand der Sehnsucht nach einem nicht oder nicht mehr zu erreichenden Menschen heraus beschrieben. Häufig klingen dabei Reflexionen an, welche diese Liebe als besonderen Affekt und somit als Zeichen eines besonderen Charakters exponieren. Für diese frühe Phase des Minnesangs speziell typisch ist der sehr lose Zusammenhang der Strophen, wie auch der Befund der zweiten hier vorgeführten Strophe, dass das Sänger-Ich nicht eindeutig einer männlichen oder weiblichen Stimme zugeordnet werden kann. Zugleich wird hier oft wesentlich eindeutiger vom vergangenen Liebesglück erzählt; oftmals werden Neider und Intriganten gescholten, die offenbar für die Trennung verantwortlich sind. Im Œuvre des Kürenbergers bleibt es bei solch punktuellen Andeutungen.
Ein Autor, der bereits am Übergang zwischen der frühesten und der nächsten Phase des Minnesangs steht, ist Dietmar von Aist.[^11 Zu ihm Tervooren, Helmut (1980).] Unter seinem Namen ist auch eine Reihe von Langzeilenstrophen überliefert; in den Handschriften B und C finden sich fünf in der gleichen Reihenfolge, die auf ähnliche Weise wie die des Kürenbergers in eher losem Zusammenhang miteinander stehen.[^12 Text und Kommentar von Simone Leidinger unter https://www.ldm-digital.de/show.php?au=Dietm&hs=C&lid=571 (12.11.2022).] Die letzten beiden dagegen beziehen sich deutlich aufeinander und sollen uns als nächstes beschäftigen; die erste beginnt mit einem Bild aus der Natur:
Ûf der linden obene, dâ sanc ein kleinez vogellîn.
vor dem walde wart ez lût. dô huop sich aber daz herze mîn
an eine stat, dâ ez ê dâ was. ich sach dâ rôsebluomen stân,
die manent mich der gedanke vil, die ich hin zeiner frouwen hân
‚Oben auf der Linde sang ein kleines Vögelchen.
Am Waldrand erklang seine Stimme. Da erhob sich mein Herz hin
an einen Ort, an dem es vorher schon gewesen war. Ich sah dort Rosen blühen,
die erinnern mich an viele Gedanken an eine Dame, die ich in mir habe.‘
Das Sänger-Ich erzählt von einer Situation am Waldrand, in der die Stimme eines Vogels von einer Linde herab zu hören war; dies nimmt sein herze gefangen, also den Sitz der Gefühle, und führt es an eine Stelle, an die es (das Herz) sich erinnert. Über die dort zu sehenden Rosen gelangt die Erinnerung schließlich zu einer Dame, an die das Herz viele Gedanken bewahrt. Dass es die geliebte Dame ist, bleibt auf diese Weise nur angedeutet.
Der Beginn ruft das Motiv einer aufblühenden Natur im Frühjahr auf, die den vom Sänger-Ich erinnerten locus amoenus und damit den Ort der Liebe vorwegnimmt. Ein solches Motiv zu Beginn ist im Minnesang als Natureingang bekannt; die erste Strophe dieser Reihe von Dietmars Langzeilenstrophen wird im Übrigen davon ganz eingenommen.[^13 Vgl. den Artikel von Lieb, Ludger (2021).]
Das Sänger-Ich zeigt sich anhand des vierten Verses (hin zeiner vrouwen) als eindeutig männlich markiert. Gleich der erste Vers der folgenden Strophe aber zeigt einen Wechsel der Sprechinstanz an und präsentiert die Strophe somit als so genannte Frauenstrophe:[^14 Die einfachen Anführungszeichen zu Beginn und Ende einer Strophe werden in einer Edition üblicherweise gesetzt, um anzuzeigen, dass es sich um eine Frauenstrophe handelt. In der handschriftlichen Überlieferung taucht dies nicht auf.]
›Ez dunket mich wol tûsent jâr, daz ich an liebes arme lac.
sunder âne mîne schulde fremdet er mich manigen tac.
sît ich bluomen niht ensach noch hôrte kleiner vogel sanc,
sît was al mîn fröide kurz unde ouch der jâmer al zelanc.‹
‚Es scheint mir wie tausend Jahre, dass ich im Arm meines Liebsten lag.
Ohne meine Schuld bleibt er seit vielen Tagen fern von mir.
Seit ich keine Blumen sah noch den Gesang der Vögel hörte,
Seitdem hatte ich wenig Freude und allzu viel Kummer.‘
Auch die Dame berichtet aus der Erinnerung über die Liebe, die ihr fast tausend Jahre lang vergangen scheint. Der erste Vers allerdings (das ich an liebes arme lac) fasst die Erinnerung sehr konkret. Als Zusatzinformation aus dieser Strophe erfährt man, dass der Ritter die Dame zu ihrem Kummer und aus unerklärlichen Gründen seit einiger Zeit meidet. Die Verbindung der Erinnerung beider an das Zusammensein mit dem Gesang der Vögel und der Blumen macht wieder deutlich, dass beide Strophen über dieselbe Liebe handeln.
Beide Sprechende (man müsste eigentlich sagen: Singende) erzählen wechselweise jeweils dem Publikum vom anderen; sie reden übereinander und nicht, wie in einem Dialog, zueinander. Eine solche Abfolge nennt man im Kontext des Minnesangs ‚Wechsel‘. Wie die zitierten Strophen des Kürenbergers konzentriert sich auch dieser Wechsel Dietmars auf die Innensicht von Liebenden, deren Liebe gestört oder getrennt ist; angesichts dessen tritt die Nennung genauerer Gründe oder Begleitumstände zurück.[^15 Die weitere Entwicklung der Gattung Wechsel und deren Poetologie beschreibt Eikelmann, Manfred (1999).]
Die zweite Phase: der rheinische Minnesang
Einige Zeit später als der donauländische – grob gesagt zwischen 1170 und 1190 – entsteht der so genannte Rheinische Minnesang, und zwar an den Kaiserpfalzen entlang des Rheins im flandrisch-deutschen Grenzgebiet. Dort herrschte ein reger Austausch von Handelswaren und Kultur. Insbesondere der kulturelle Austausch erhielt wichtige Impulse durch die Gesellschaften am Hof des Kaisers Barbarossa, der seit 1156 mit Beatrix von Burgund, der Tochter des Herzogs Rainald III. von Burgund verheiratet war. Hier trafen deutsche Minnesänger, provenzalische Trobadors und französische Trouvères aufeinander. Die so entstehenden mittelhochdeutschen Lieder beeinflussten zumindest in der Rezeption die bereits vorhandenen des donauländischen Minnesangs und verdrängten offenbar dessen Formen.
Der Kulturtransfer zeigt sich auf deutschsprachiger Seite in der Übernahme von Formen und Motiven der französischen oder provenzalischen Tradition, häufig auch in der mittelhochdeutschen Nach- oder Neudichtung romanischer Lieder. Oftmals wurden dabei die Melodien übernommen, was man an den identischen metrischen Formen von Vorlage und Nachdichtung ablesen kann. Die Strophen dieser Lieder weisen eine gemeinsame Form auf, nämlich die der ursprünglich in der romanischen Lyrik beheimateten Stollen- oder Kanzonenstrophe, die ein bekanntes melodisches Schema abbildet: der erste Abschnitt einer Melodie wird einmal mit einem anderen Text wiederholt (im Schema wird dies mit zwei identischen Abschnitten A und A‘ abgebildet), bevor ein zweiter, melodisch neuer Abschnitt die Strophe beendet (Abschnitt B). Dieses Schema AA’B besteht dann aus zwei Teilen, den beiden Stollen A und A‘, die zusammen den Aufgesang bilden, und dem Abgesang B. Mit dieser Strophenform verbindet sich ein neues Konzept von Minne, das ebenfalls aus der romanischen Lyrik übernommen wurde. Die metrische Füllung dieser Form bildet letztlich die Melodie ab, die nun für jedes Lied individuell ist, so dass man an der metrischen Form einer Strophe auch ohne Kenntnis der Melodie die Zusammengehörigkeit mehrerer Strophen zu einem Lied erkennen kann.
Friedrich von Hausen, ein Sänger im Gefolge des Kaisers, der 1190 auf demselben Kreuzzug zu Tode kam wie Barbarossa selbst, gilt als Hauptvertreter dieser neuen Phase des Minnesangs, die nach ihm in früherer Forschung auch Hausen-Schule genannt wurde.[^16 Zu Friedrich von Hausen: Schweikle, Günther (1981); zu seiner engen Verbindung zum romanischen Minnesang Touber, Anthonius (2005). Zur Rezeption romanischer Lieder im deutschen Minnesang Zotz, Nicola (2005); vgl. ferner Millet, Victor (2019).] Ein kurzes Lied mit zwei Strophen von ihm soll den rheinischen Minnesang vorstellen.[^17 Das Lied ist so in der Handschrift C überliefert; Edition und Kommentar von Simone Leidinger unter: https://www.ldm-digital.de/show.php?au=Hausen&hs=C&lid=2554 (12.11.2022). Die Handschrift bietet an späterer Stelle zwei weitere metrisch nahezu gleiche Strophen, die auch in B enthalten sind. Sie werden meistens mit den hier vorliegenden zu einem vierstrophigen Lied zusammengezogen, wobei die Strophen 3 und 4 dann in mancher Hinsicht Differenzen aufweisen; z. B. fehlt der einleitende Ausruf Wafenâ! An dieser Stelle gehe ich auf das Lied in zwei Strophen ein, wie sie es in C überliefert wird. Edition in dieser Form mit eingehender Untersuchung bei Hassel, Veronika (2018), S. 107–121.] Die erste lautet wie folgt:
I.
Wâfenâ! wie hât mich minne gelâzen,
diu mich betwanc, daz ich lie mîn gemüete
an solchen wân, der mich wol mac verwâzen,
ez ensî, daz ich genieze ir güete,
5 von der ich bin alsô dicke âne sin.
mich dûhte ein gewin, unde wolte diu guote
wizzen die nôt, diu wont in mînem muote.
‚Hilfe, wie hat die Liebe mich im Stich gelassen,
Die mich überwältigt hat, so dass ich mein Herz
solcher Hoffnung überließ, die mich wohl verderben kann;
es sei denn, ihre gute Art hilft mir,
von der ich vollkommen verzaubert bin.
Es schiene mir ein Gewinn zu sein, wenn die Gute
um die Qual wüsste, die in meinem Herzen wohnt.‘
Zunächst zum Formalen: Die ersten vier Verse bilden den Aufgesang, der durch Kreuzreim zusammengehalten wird; jeweils zwei Verse bilden dabei einen Stollen. Die letzten drei bilden den Abgesang; würde man den ersten Vers nach dem Binnenreim umbrechen (dann ergäbe sich der Reim ich bin … âne sin), könnte man von vier Versen mit Paarreimen im Abgesang sprechen; dies gilt analog für beide Strophen. Anhand der – leider verlorenen – Melodie könnte man näher überlegen, ob die Reimsilben auch musikalisch akzentuiert wurden. Auf jeden Fall scheint man im Abgesang in der Versmitte eine Zäsur ansetzen zu können, denn die Silben davor passen stets zu einem Reimschema. Ist es in Strophe I, Vers 6[^18 Im Folgenden zitiere ich die Strophen mit ihrer römischen Zahl und die Verse mit der arabi schen, in diesem Falle also: I, 6.] die Reimsilbe gewin, die den Binnenreim von 1,5 aufgreift, ergibt sich an der entsprechenden Stelle in der zweiten Strophe ein Reim der Silben vor der Zäsur von II,6 und II,7 (triuwen – bliuwen). Der Binnenreim in II,5 (wân – hân) ist davon unabhängig.
Inhaltlich klagt ein Sänger-Ich darüber, dass die Minne ihn verraten habe. Im Aufgesang, eingeleitet mit dem militärischen Alarmruf wâfenâ, wird es beschrieben: Die Minne hat ihn dazu gebracht, dass er sich ganz und gar auf eine Hoffnung gestützt hat, Hoffnung auf Liebe, die für ihn geradezu bedrohlich werden und ihn zugrunde richten könnte. Rettung kann einzig und allein von der Dame kommen, wie man im Abgesang erfährt, indem sie ihn nämlich ihre güete erfahren lässt. Das Wort güete steht dabei für die Tugenden, das Gutsein der Dame oder ihre gute Art. Daher hält das Sänger-Ich es für richtig, wenn diese von seiner Herzensnot erfährt.
Die Situation ist wesentlich prekärer als jene in den bereits oben besprochenen Strophen: Die Minne hat den Sänger nicht nur affiziert, sie hat ihn überwältigt; der Schmerz über die fehlende Erfüllung der Hoffnung ist so tiefgehend, dass die Existenz des Sängers von der Gnade der Dame abhängig zu sein scheint. Im Gegensatz zu den beiden angesprochenen Beispielen aus dem donauländischen Minnesang ist hier gar keine Rede von irgendeinem Liebesglück in der Vergangenheit; die letzten beiden Verse unterrichten das Publikum vielmehr darüber, dass die Dame vom wân, der Hoffnung des Sängers, noch gar nichts weiß.
Die zweite Strophe führt das fort:
II.
Wâfenâ! waz habe ich getân sô ze unêren,
daz mir diu guote ir gruozes niht engunde?
sus kan si mir wol daz herze verkêren.
daz ich in der werlte bezzer wîp iender funde,
5 seht, dest mîn wân. dâ für sô wil ich’z hân
unde wil dienen mit triuwen der guoten,
diu mich dâ bliuwet vil sêre âne ruoten.
‚Hilfe, was habe ich so Unrechtes getan,
dass mir die Gute ihren Gruß nicht gegönnt hat?
So kann sie mir wohl das Herz brechen.
Dass ich nirgendwo auf der Welt eine bessere Frau fände,
seht, das ist mein fester Glaube. Daran will ich festhalten
und will der Guten in Treue dienen,
die mich ohne Ruten so heftig schlägt.‘
Mit den ersten beiden Versen beklagt der Sänger, dass die Dame ihm noch nie ein Zeichen geben wollte, dass sie ihn überhaupt freundlich wahrnimmt, so ist der gruoz (II,2) zu erklären. Wieder wird im folgenden Vers die drohende Gefahr des gebrochenen Herzens durch diese Nichtachtung erwähnt, bevor der letzte Vers des Aufgesangs (II,4) zu einer anderen Lösung überleitet, die dann im Abgesang entwickelt wird: Das Sänger-Ich will an seiner festen Vorstellung (wân, II,5) festhalten, er finde auf der ganzen Welt keine bessere Dame. Und so will er seinen Dienst an ihr fortsetzen, auch wenn sie ihn bliuwet âne ruoten (II,6), also ihn (bzw. seine Seele) quält, indem sie ihn nicht erhört.
In dem Begriff dienst wird das oben angesprochene neue Konzept von Minne sichtbar, das der rheinische Minnesang zusammen mit der Form der Kanzonenstrophe in die deutsche Liebeslyrik hineinbringt: der so genannte Frauendienst bildet das System lehensrechtlicher Herrschaft des Adels auf das Verhältnis zwischen Sänger-Ich und verehrter Dame ab: Letztere wird zur Herrin, zur vrouwe, stilisiert, der Sänger dagegen zu ihrem Vasallen, einem man oder dienstman, der sich in die Abhängigkeit von ihrer Gnade überantwortet und zum Dienst an ihr verpflichtet. Dies wird begründet im Gutsein, in der güete der Dame, mit der sie ihren Teil des Verhältnisses erfüllt. Dazu gehört auch ein gewisser lon des Dienstes, für den am häufigsten der gruoz, also ein mit Gestik und/oder Mimik erwiesener Gunstbeweis, genannt wird. In Verkehrung der gesellschaftlichen Realitäten wird also die Geliebte zur Herrin und zur idealen Dame überhöht, die höfische Tugenden und außerordentliche Schönheit auszeichnen, wohingegen der Sänger lediglich mit seinem Dienst durch Gesang um sie werben kann. In den Liedern wird dann die unsichere Situation der Werbung thematisiert, in der noch nicht absehbar ist, ob der Dienst jemals Erfolg haben wird. Dies gibt dem Sänger die Gelegenheit, seinerseits ritterliche Tugenden zu zeigen wie Beständigkeit (staete) und unverbrüchliches Beharren im Dienst (triuwe).
Im Minnesang dieser neuen Form geht es also um den Preis weiblicher Schönheit und höfischer Tugenden als Dienst an ihr, aber auch um den Schmerz durch vermeintliche Zurückweisung und um nicht gelingende oder unmögliche Kommunikation. Dabei tritt die Welt des Hofs deutlicher zutage als im donauländischen Minnesang; zugleich werden die Lieder in Form und Darstellung der Innensicht der Liebenden spürbar artistischer.
Der Hohe Minnesang
Kann man in der eben behandelten Phase noch eine große Nähe der Lieder zu romanischen Vorlagen – altfranzösischen oder altprovenzalischen – beobachten, tritt doch bald, etwa ab 1190, eine weitere Entwicklung ein. Die deutschsprachigen Minnesänger lösen sich mehr und mehr von den Vorlagen und entwickeln auf der Grundlage der Motive und Formen des rheinischen Minnesangs eine eigenständige Tradition. Hier rückt die Überhöhung der besungenen Dame in ihrer Schönheit und ihren Tugenden noch mehr in den Vordergrund; die unüberbrückbare Distanz, die Unmöglichkeit, mit ihr überhaupt zu kommunizieren, wird zum reizvollen Gegenstand der lyrischen Darstellung. Die Sänger, die hierfür am häufigsten genannt werden, sind Heinrich von Morungen, Reinmar der Alte oder Walther von der Vogelweide. Ist Reinmar dafür bekannt, den Kummer über die Vergeblichkeit der Werbung künstlerisch von allen Seiten zu durchdringen und so seine Lieder zur Beschreibung und Reflektion des trûrens zu machen (Ingrid Kasten hat aus seinen Liedern eine „Poetologie des trûrens“ herausgearbeitet),[^19 Kasten, Ingrid (1986), S. 310–319.] so überhöht Morungen seine Dame bis in eine Unerreichbarkeit hinein, in der sie nur noch mit Bildern für Übernatürliches, Transzendentes oder auch Überirdisches beschrieben werden kann. Sein Lied wê, wie lange sol ich ringen, das lediglich in der Handschrift C überliefert ist, soll hier als Beispiel für Hohen Minnesang dienen.[^20 Zu Heinrich von Morungen aktuell Kellner, Beate (2021a).] Die erste von drei Strophen lautet wie folgt:[^21 Dieses Lied ist bei LDM noch (12. 11. 2022) nicht verfügbar. Ich zitiere es nach der Ausgabe von Kasten, Ingrid (1995); hier ist es das Lied 112 auf der S. 264. Die Übersetzung ist von mir.]
I
Wê, wie lange sol ich ringen
umbe ein wîp, der ich noch nie wort zuo gesprach?
wie sol mir an ir gelingen?
seht, des wundert mich, wan es ê niht geschach,
5 daz ein man alsô tobt, als ich tuon zaller zît,
daz ich sî sô herzeclîche minne,
und es ê nie gewuoc und ir dient iemer sît.
‚Ach, wie lange soll ich mich noch bemühen
um eine Frau, zu der ich noch nie ein Wort gesprochen habe?
Wie soll ich bei ihr Erfolg haben?
Seht, das wundert mich, denn es geschah bisher noch nie,
das ein Mann so von Sinnen ist, wie ich es immerzu bin,
dass ich sie so von Herzen liebe,
und ich es bisher noch nie gesagt habe und ihr doch immer gedient habe.‘
Das Sänger-Ich beklagt vor dem Publikum und allem Anschein nach in Abwesenheit der Geliebten die Situation, in die es geraten ist: Es hat sich in eine Dame verliebt, zu der es noch nie gesprochen hat. Seinen inneren Zustand beschreibt es als toben, von Sinnen sein, und die Spannung zwischen seiner Sehnsucht und der ausbleibenden Kommunikation oder mehr noch, der Erwiderung der Liebe scheint sich eher zu steigern als zu beruhigen. Darauf deutet auch der letzte Vers hin: Nie hat die Dame ein Wort des Sängers gehört, aber er hat ihr stets gedient, das heißt: er hat durchaus für sie gesungen. Diese Diskrepanz reflektiert die Tatsache, dass die Minnedame in den Liedern vom Publikum zunächst als eine fiktionale Figur verstanden wird, über die der Sänger dem Publikum berichtet. Offenbar hat er seine Lieder an eine reale Dame gerichtet, die dies nicht wahrnimmt. So wird angedeutet, dass auch die aktuelle Aufführungssituation einen solchen Hintergrund haben könnte. In der letzten Strophe wird das noch wichtig. Es dient dies aber auch zur Darstellung der schwierigen oder nicht gegebenen Möglichkeiten einer Kommunikation mit der Dame. Die Intensivierung der so entstehenden Spannung beschreibt die folgende Strophe:
II
Ich weiz vil wol, daz sî lachet,
swenne ich vor ir stân und enweiz, wer ich bin.
sâ zehant bin ich geswachet,
swenne ir schœne nimt mir sô gar mînen sin.
5 got weiz wol, daz si noch mîniu wort nie vernam,
wan daz ich ir diende mit gesange,
sô ich beste kunde, und als ir wol gezam.
‚Ich weiß sehr gut, dass sie lacht,
jedes Mal, wenn ich vor ihr stehe, und nicht mehr weiß, wer ich bin.
Sogleich bin ich ohne jede Kraft,
immer wenn ihre Schönheit mir vollkommen den Verstand raubt.
Gott weiß, dass sie noch nie meine Worte gehört hat,
außer dass ich ihr mit meinen Liedern gedient habe,
So gut ich es konnte und wie es ihr angemessen war.‘
Der erste Satz ist nicht leicht in seiner tieferen Bedeutung zu verstehen: Wenn das Sänger-Ich vor der Dame steht, weiß es nicht mehr, wer es ist – und die Dame lacht darüber. Dieses etwas unhöfische Verhalten ließe sich entschärfen, wenn man lachet der Situation angemessener als ‘lächelt’ auffasst.[^22 Den Hinweis auf diese Möglichkeit verdanke ich einem Beitrag von Markus Greulich zur Diskussion des Vortrags – herzlichen Dank an dieser Stelle.] Dies macht die Situation zugleich vieldeutiger: ein Lächeln könnte auch eine persönliche Affizierung der Dame signalisieren, nicht nur Spott über die Absenz des Sängers – und zugleich bewirkt es eine Steigerung seiner Gefühle, ist also so etwas wie eine wortlose Kommunikation. Aber in der persönlichen Begegnung, so lässt sich festhalten, ist der Sänger nicht in der Lage, der Dame seine Liebe konkret zu erklären. Dass der Sänger angesichts ihrer Schönheit Sprache und Sinne verliert, entspricht einem gängigen Topos in der lateinischen Elegie wie auch in der provenzalischen Lyrik.[^23 Vgl. Tervooren, Helmut (1996), S. 167.]
Was ihm in dieser Situation bleibt, beschreibt der zweite Teil, der Abgesang, in dem noch einmal betont wird, dass die Dame außer dem Dienst mit Gesang noch nie ein Wort zu hören bekommen hat – dieser Dienst besteht allerdings aus Worten und Gesang nach dem besten Vermögen des Sängers. Wieder klingt an, dass die Dame zwischen der fiktionalen Minnedame und sich selbst fälschlicherweise unterscheidet, also die künstlerische (und wohl an ein breiteres Publikum gerichtete) Darbietung nicht als an sie adressierte Botschaft versteht. Im Rahmen seines Dienstes gelingt die Kommunikation also auch nicht.
Die dritte Strophe versucht folgerichtig, diese Kluft zwischen künstlerischer Performanz und persönlicher Kommunikation zu schließen:
III
Owê des was rede ich tumbe?
daz ich niht enrette als ein sæliger man!
sô swîge ich rehte als ein stumme,
der von sîner nôt nicht gesprechen enkan,
5 wan daz er mit der hant siniu wort tiuten muoz.
als erzeige ich ir mîn wundez herze
unde valle für si unde nîge ûf ir vuoz.
‚O weh darüber, was rede ich so töricht,
dass ich nicht redete wie ein Glückseliger!
So schweige ich, ganz wie ein Stummer,
der nicht über seinen Kummer sprechen kann,
sondern seine Worte mit Gesten andeuten muss.
So zeige ich ihr mein verwundetes Herz,
falle vor ihr nieder und verneige mich bis auf ihre Füße‘
Der Sänger bricht in Wehklagen aus über seine Sprachlosigkeit, das ihn zu den in der zweiten Strophe angedeuteten nonverbalen Mitteln der Kommunikation führt, die er nun explizit nutzen möchte: Er zeigt der Dame durch eine Geste der Unterwerfung an, dass sie die besungene Minnedame ist.[^24 Kasten, Ingrid (1995), S. 781 zufolge ist das Vorbild für diese Geste „der lehnsrechtliche Akt des ‚Handgangs‘ (immixtio manuum), der bei den Trobadors gelegentlich als Geste der Huldigung erscheint.“] Die Wirkung davon zeigt sich potentiell auf zwei Ebenen: Auf der des Textes erhält das Sänger-Ich durch diesen Ausgriff ins Nonverbale seine Sprache zurück, deren Verlust es eben noch beklagt hatte. Zugleich kann der Sänger auf der performativen Ebene diese Geste vor einer Dame aus dem Publikum vollziehen – und damit wieder den fiktionalen Charakter seines Gesangs verdeutlichen, da alle Anwesenden dies als Spiel verstehen werden.[^25 Die Dimension der Theatralität in den Liedern Morungens beschreibt eindrucksvoll Toepfer, Regina (2013).]
Diese kommunikativ kaum zu überbrückende Kluft zwischen Sänger und Dame ist eines der wichtigsten Themen, an denen sich Morungens Lyrik abarbeitet. Oft wird diese Kluft als existentieller Bruch inszeniert, indem er die Dame metaphorisch als liehter morgensterne oder als Sonne beschreibt, die am hellsten strahlt, wenn sie mittags am weitesten von ihm entfernt ist.[^26 Kasten, Ingrid (1995), Lied 111 (S. 262), hier Strophe 3.] Hier wird die Distanz in astronomische Verhältnisse überhöht. Die Darstellung der Dame als vênus hêre, die ihn nur durch ein Fenster kurz anschaut reht als der sunnen shîne, um sich gleich wieder zuo andern vrouwen, zurückzuziehen, versetzt die Angebetete in die Sphäre der Göttinnen und macht sie damit kaum erreichbarer.[^27 Kasten, Ingrid (1995), Lied 116 (S. 270 bis 74), hier Strophe 3. Zur Überhöhung der Dame als antike Göttinnen vgl. meinen Beitrag: Rupp, Michael (2009).] Die dabei eingesetzte Lichtmetaphorik wie auch die Beschreibung einer geradezu meditativen Versenkung in den Anblick der Dame führte dazu, dass aus seinen Liedern eine Poetik des schouwens herausgelesen wurde.[^28 Kasten, Ingrid (1986), S. 319–329; zur Poetologie Morungens eingehend Leuchter, Christoph (2003).]
Reinmar der Alte dagegen beschreibt in zahlreichen Liedern den Kummer, mit dem diese Kluft und Sprachlosigkeit den Sänger zurücklässt, und demonstriert die Tugenden, mit denen ein Höfischer Ritter seinen Dienst für die Dame dennoch nicht niederlegt. Natürlich wird damit auch so etwas wie Durchhaltevermögen dargestellt, hinter dem letztlich immer noch die Hoffnung auf Erhörung steht. Im Gegensatz zu Morungen sieht man bei Reinmar wie schon erwähnt eine Poetik des trûrens am Werk.
Im Hohen Minnesang sieht man also eine Fortentwicklung der Formen und Motive des rheinischen Minnesangs. Die Form der Kanzonenstrophe wird immer raffinierter gefüllt; die Sprache wird ebenfalls artistischer wie auch die Motive und Bilder, mit denen die Liebe und ihre Folgen beschrieben werden. Gleichzeitig sieht man die Zusammengehörigkeit mehrerer Strophen zu einem Lied nicht nur an deren übereinstimmender Metrik, sondern zunehmend auch an inhaltlicher Stringenz, die immer wieder – wie das Beispiel Morungens hier zeigt – auch die Komposition einer sinnvollen Abfolge der Strophen einschließt. Gerade die allerdings kann, wie auch der Strophenbestand eines Lieds, im Zuge der Überlieferung variieren, so dass nicht selten mehrere sinnvolle Versionen – so genannte Fassungen – eines Lieds überliefert sind, ohne dass man zwingend eine ursprüngliche Fassung herausarbeiten könnte. Zum einen mag es eine solche auch nicht gegeben haben, zum anderen aber hat sich die Philologie von der Suche nach einer solchen verabschiedet und beschränkt sich sinnvollerweise auf das, was die Überlieferung bietet.
Die weitere Entwicklung — ein Ausblick
Die Dynamik, mit der die Distanz zwischen Sänger und Dame immer unüberbrückbarer wird, bringt Walther von der Vogelweide in manchen seiner Lieder zum Stillstand. In ihnen reflektiert er über die richtige Minne, oder, wie er sie hin und wieder nennt, die herzeliebe. Sehr bekannt ist hier eines, das in verschiedenen Fassungen überliefert ist. Neben C überliefern es noch die oben nicht erwähnten Handschriften E (die Würzburger Liederhandschrift),[^29 Aufbewahrt in der Universitätsbibliothek München mit der Signatur 2° Cod. ms. 731 (Cim. 4); Digitalisat als PDF-Datei zugänglich unter https://epub.ub.uni-muenchen.de/10638/ (12.11.2022).] F (die Weimarer Liederhandschrift)[^30 Heute in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Signatur Cod. Quart 564; digitalisiert unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:32-1-10013478588 (12.11.2022).] und O, eine ehemals in der Berliner Preußischen Staatsbibliothek aufbewahrte Handschrift, von der nur noch ein paar wenige Blätter übrig sind.[^31 In Berlin mit der Signatur mgo 682 aufbewahrt; heute in der Bibl. Jagiellońska in Krakau, Berol. Ms. germ. oct. 682. Digitalisat unter: https://www.mr1314.de/2083, der Beginn des Lieds auf Bl. 2v (12.11.2022).] Es soll hier nur kurz und anhand einiger für den vorliegenden Zusammenhang exemplarischen Stellen angesprochen werden.[^32 Zur Überlieferungssituation Kasten, Ingrid (1995), S. 955. In ihrer Ausgabe ist es als Lied 176 in der Reihenfolge nach E und F (mit dem Text von C) abgedruckt und wird von mir so zitiert.]
In E und F beginnt dieses Lied geradezu programmatisch mit der dringlichen Bitte des Sängers an das Publikum: Saget mir ieman, waz ist minne. Animiert schon dies zumindest zum Mitdenken, wird zu Beginn der folgenden Strophe zum aktiven Mitmachen aufgefordert: Ob ich rehte râten künne, / waz diu minne sî, sô sprechent denne jâ. Dann lässt der Sänger einen Vorschlag folgen: minne ist zweier herzen wünne, / teilent sie gelîche, sô ist diu minne dâ. Allein die Reimsilbe dâ suggeriert schon die erwünschte Antwort des Publikums darauf. Natürlich konnte Walther auch mit Zustimmung rechnen, wenn er – wie in allen weiteren Strophen des Lieds – argumentiert, die von seinen Kollegen als einseitig dargestellte Liebe, die nur Kummer und Schmerz bedeute, wäre doch eigentlich keine Liebe. So heißt es in der ersten Strophe provokant: tuot si wê, so heizet si niht minne. Walther wirbt damit für ein anderes Konzept von Minne (das den anderen Sängern womöglich weniger fernsteht, als er es suggeriert) und erteilt damit dem unverbrüchlichen Dienst, der über alle Distanz und Unsicherheit hin aufrecht erhalten wird, eine klare Absage. In Strophe 3 wendet er sich direkt an die Dame: sî aber ich dir gâr unmaere, / daz sprich endelîche, sô lâze ich den strît – um in der letzten Strophe, wieder Zustimmung zu seiner Position heischend, das Publikum mit der rhetorischen Frage zu konfrontieren: waenet si daz ich ir liep gebe umbe leid?
Diese kurzen Eindrücke sollen hier nur den öfters gemachten Versuch Walthers vorstellen, das Konzept der Hohen Minne aufzubrechen. Diese Lieder markieren allerdings kaum das Ende des Hohen Minnesangs – Walther selbst hat zahlreiche Lieder in dessen Tradition geschrieben – sie erweitern vielmehr das Spektrum der Formen und Motive und stehen so für eine einsetzende große Dynamik der Weiterentwicklung, die zu einer breiten Diversifizierung der Themen und Formen des Minnesangs im 13. Jahrhundert führt.[^33 Breit diskutiert im Tagungsband: Köbele (2013); eine Einführung von Hübner, Gert (2008).]
Will man die Entwicklung der Gattung generell betrachten, muss man von den gesungenen Liedern ausgehen, also von ihrer historischen Performanz an den verschiedensten Höfen, von der uns die Handschriften heute nur noch sehr wenig Zeugnis geben. Und doch, dies sollte deutlich geworden sein, lässt sich auch hier bereits ablesen, dass die meisten Lieder in verschiedener Form vorgetragen wurden. Bereits im donauländischen Minnesang wird ein Lied ‚Nû endarf mir nieman wissen‘ in zwei verschiedenen Formen und unter zwei verschiedenen Namen überliefert, wobei die Fassung in C formal an eine Kanzonenstrophe angeglichen wurde – hier macht sich der Einfluss des rheinischen Minnesangs bemerkbar.[^34 So ist z. B. das Lied ‚Nû endarf mir nieman wissen‘ des Burggrafen von Riedenburg mit zwei Strophen in C überliefert, von denen in B nur die erste und in anderer metrischer Form hat. Das Budapester Fragment Bu (Cod. germ. 92 der Nationalbibliothek Budapest, online unter https://web.archive.org/web/20070205062849/http://www.uni-graz.at/ub/ausstellungen/1999/budapest/budapest.html (12.11.2022)) hat die Strophe in derselben Form wie B unter dem Namen des Burggrafen von Regensburg; die zweite, in B nicht erhaltenen Strophe, hat Bu wiederum in einer anderen Form unter dem Namen des Burggrafen von Regensburg. Beide Versionen sind einsehbar bei LDM: https://www.ldm-digital.de/show.php?au=Riedenb&hs=C&lid=2741 (12.11.2022). Sichtbar wird in der metrischen Varianz offenbar eine Auseinandersetzung mit der neuen romanischen Form, welche die herkömmliche ältere beeinflusst. Vgl. Brunner, Horst (2005), S. 204–205.] Neun Strophen des Kürenbergers sind auch im so genannten Budapester Fragment (Sigle Bu) überliefert, in denen inhaltlich einiges anders akzentuiert ist als in der bereits besprochenen in C.[^35 Vergleich der Fassungen bei Kern, Peter (2001).] So ist die oben zitierte Anspielung an Marienlyrik dort nicht enthalten.
Solches gilt genauso und noch mehr für die verschiedenen Fassungen, in denen die Lieder des späteren Minnesangs überliefert werden. Auch hier variiert nicht nur der genaue Wortlaut an verschiedenen Stellen, sondern wie erwähnt auch der Bestand und die Reihenfolge der Strophen, was in dieser Phase aber die Kohärenz der Lieder verändert. Auch die Zuschreibung an Autoren ist nicht immer fest; so wird eines der berühmtesten Lieder Morungens, das Narziss-Lied, in zwei verschiedenen Fassungen überliefert: In C findet sich nur die erste Strophe; die Handschrift e überliefert diese und drei weitere – allerdings unter dem Namen Reinmars des Alten. Sonst ist dieses Lied nirgends bezeugt.
Auch intertextuell entwickelt sich eine große Dynamik. Die oben angeführte kritische Auseinandersetzung Walthers mit den Liedern seiner Kollegen ist nur ein Beispiel. Es gibt zahlreiche mehr oder weniger deutliche Bezugnahmen auf Lieder anderer im Hohen Minnesang; berühmt geworden ist eine Reihe von Liedern Walthers und Reinmars, in denen sie auf das Minnekonzept des jeweils anderen kritisch eingehen; in der Forschung wurde daraus auch eine regelrechte „Fehde“ herausgelesen.[^36 Erste Orientierung zu Walther mit aktueller Literatur: Bauschke, Ricarda (2021).]
Den lyrischen volkssprachigen (das meint hier: nicht lateinischen) Diskurs über Minne in den Jahrzehnten vor und nach 1200 kann man sich also durchgehend als sehr dynamisch vorstellen. Dabei wäre es im Übrigen verkehrt, sich die literaturhistorischen Hilfskonstrukte von verschiedenen Phasen als eine Abfolge vorzustellen, in denen jeweils eine Phase die vorige beenden würde. Nicht nur waren die Lieder Reinmars und Walthers zur gleichen Zeit aktuell; auch die aus dem Rheinischen Minnesang werden auch dann noch beliebt gewesen sein, als bereits Neidhart das von Walther erweiterte Spektrum mit seinen Dörperparodien abermals bereichert hatte. Am besten kann man sich dies wohl als einen Prozess produktiver Auseinandersetzung mit der Tradition vorstellen, der diese Tradition zugleich weiterträgt, die bis zum Ende des 13. Jahrhunderts anhält und noch währenddessen in die Handschriften aufgenommen wird: Der Schweizer Minnesänger Johannes Hadloub hatte wohl Verbindungen zum Kreis um Rüdiger Manesse, aus dem heraus vermutlich die Herstellung der Handschrift C initiiert wurde. Er selbst ist noch darin vertreten. In ihrer Varianz bewahren die drei hier näher angesprochenen Kodizes wie auch die vielen weiteren also ein Bild der Dynamik, die im Minnesang die Entstehung und Entwicklung der Lieder über nahezu 150 Jahre hinweg prägte.
Primärliteratur
- LDM: Lyrik des deutschen Mittelalters, online hg. von Manuel Braun u.a. (Hgg). URL: https://www.ldm-digital.de (12.11.2022).
- Kasten, Ingrid: Deutsche Lyrik des frühen und hohen Mittelalters. Edition der Texte und Kommentare von Ingrid Kasten, Übersetzungen von Margerita Kuhn, Frankfurt a. M. 1995 (=Bibliothek des Mittelalters 3).
- Tervooren, Helmut: Heinrich von Morungen, Lieder. Mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch. Text, Übersetzungen und Kommentar von Helmut Tervooren, Stuttgart 1975, verbesserte und bibliographisch erneuerte Auflage 1996 (Reclams Universal-Bibliothek 9797).
Sekundärliteratur
- Bauschke, Ricarda: Walter von der Vogelweide, in: Kellner, Beate u.a. (Hgg.):
- Handbuch Minnesang, Berlin, Boston 2021, S. 698–711.
- Benz, Maximilian: ‚Der von Kürenberg‘, in: Kellner, Beate u.a. (Hgg.): Handbuch Minnesang, Berlin, Boston 2021, S. 649–653.
- Benz, Maximilian: Minnesang diesseits des Frauendienstes und der Kanzonenstrophe. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 136, 2014, S. 569–600.
- Brunner, Horst (Hg.): Früheste deutsche Lieddichtung. Mittelhochdeutsch – neuhochdeutsch, Stuttgart 2005 (Reclams Universal-Bibliothek, 18388).
- Eikelmann, Manfred: Dialogische Poetik. Zur Kontinuität älterer poetologischer Traditionen des Minnesangs am Beispiel des Wechsels, in: Mittelalterliche Lyrik: Probleme der Poetik. Herausgegeben von Thomas Cramer und Ingrid Kasten, Berlin 1999, S. 85–106.
- Hassel, Veronika: Das Werk Friedrichs von Hausen. Edition und Studien, Berlin 2018.
- Hübner, Gert: Minnesang im 13. Jahrhundert. Eine Einführung, Tübingen 2008 (Narr Studienbücher).
- Kasten, Ingrid: Frauendienst bei Trobadors und Minnesängern im 12. Jahrhundert. Zur Entwicklung und Adaption eines literarischen Konzepts, Heidelberg 1986 (Germanisch-Romanische Monatshefte. Beihefte, 5).
- Kellner, Beate u.a. (Hgg.): Handbuch Minnesang, Berlin, Boston 2021.
- Kellner, Beate: Heinrich von Morungen. In: Kellner, Beate u.a. (Hgg.): Handbuch Minnesang. Berlin, Boston 2021, S. 665–677 (= Kellner 2021a).
- Kellner, Beate: Spiel der Liebe im Minnesang, Boston 2018.
- Kern, Peter: Die Kürenberg-Texte in der Manessischen Handschrift und im Budapester Fragment. In: Entstehung und Typen mittelalterlicher Lyrikhandschriften. Akten des Grazer Symposiums. 13.–17. Oktober 1999. Hg. von Anton Schwob und András Vizkelety, unter Mitarbeit von Andrea Hofmeister-Winter, Bern u. a. 2001 (JIG, Reihe A 52), S. 143–163.
- Köbele, Susanne u.a. (Hg.): Transformationen der Lyrik im 13. Jahrhundert. Wildbader Kolloquium 2008, Berlin 2013 (Wolfram-Studien XXI).
- Leuchter, Christoph: Dichten im Uneigentlichen. Zur Metaphorik und Poetik Heinrichs von Morungen, Frankfurt a.M. 2003 (Kultur, Wissenschaft, Literatur, 3).
- Lieb, Ludger: ‚Natur und Natureingang‘. In: Kellner, Beate u.a. (Hgg.): Handbuch Minnesang, Berlin, Boston 2021, S. 410–420.
- Millet, Victor: Sinnvolle Alterität? Zu unterschiedlichen formalen Entwicklungen in der mittelhochdeutschen, okzitanischen und altfranzösischen Literatur. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 9, 2019, S. 163–173; online unter https://doi.org/10.14361/zig-2018-090211(12. 11. 2022).
- Rupp, Michael: Narziß und Venus. Vom Blick auf die Antike bei Heinrich von Morungen, Konrad von Würzburg und dem Wilden Alexander. In: Christiane Ackermann / Ulrich Barton (Hgg.): „Texte zum Sprechen bringen“. Philologie und Interpretation. Festschrift für Paul Sappler, Tübingen 2009, S. 35–48.
- Schweikle, Günther: Kürenberg (Der von Kürenberg), in: ² VL, 5, 1985, Sp. 455–456.
- Schweikle, Günther: Friedrich von Hausen, in: ² VL, 3, 1981, Sp. 935–947.
- Tervooren, Helmut: Heinrich von Morungen, Lieder. Mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch. Text, Übersetzungen und Kommentar von Helmut Tervooren, Stuttgart 1975, verbesserte und bibliographisch erneuerte Auflage (Reclams Universal-Bibliothek 9797) 1996.
- Tervooren, Helmut: Dietmar von Aist, in: ² VL, 2, 1980, Sp 95–98.
- Toepfer, Regina: Sehen und gesehen werden. Die Blickregie im Minnesang Heinrichs von Morungen. In: Manfred Kern (Hg.): Imaginative Theatralität. Szenische Verfahren und kulturelle Potenziale in mittelalterlicher Dichtung, Kunst und Historiographie. Unter Mitarbeit von Felicitas Biller, Claudia Höckner, Anja-Mareike Klingbeil und Manuel Schwembacher. Heidelberg 2013 (Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit, Band 1), S. 53–79.
- Touber, Anthonius H.: Romanischer Einfluss auf den Minnesang. Friedrich von Hausen und die Hausenschule. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 127, 2005 S. 62–81.
- Voetz, Lothar: Der Codex Manesse: die berühmteste Liederhandschrift des Mittelalters, 3. Aufl. Darmstadt 2020.
- Zotz, Nicola: Intégration courtoise. Zur Rezeption okzitanischer und französischer Lyrik im klassischen deutschen Minnesang, Heidelberg 2005 (Beihefte zur Germanisch-Romanischen Monatsschrift 19).
Beitrag 3
Mit dem ‚Nibelungenlied‘ steht einer der wuchtigsten und eindringlichsten Texte des Mittelalters auf dem Programm. Erzählt wird von Kriemhild und Siegfried sowie von Gunther und Brünhild, weiterhin von Hagen, der Siegfried ermordet und den Untergang der Nibelungen damit einleitet und eine große Racheerzählung in Gang setzt, in deren Mittelpunkt Kriemhild steht. Kriemhild, die sich von einer wunderschönen jungen Frau in eine rächende Königin verwandelt, die nicht davor zurückschreckt, die eigenen Brüder zu opfern, im Text wird sie am Ende als Teufelin, als vâlandinne (Str. 2371,4), beschimpft.[^1 Das ‚Nibelungenlied‘ und die ‚Klage‘ werden zitiert nach der folgenden Ausgabe: Das Nibelungenlied und die Klage. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mittelhochdeutscher Text, Übersetzung und Kommentar. Hg. von Joachim Heinzle, Berlin 2015 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 51).]
Wie es dazu kommt, erzählt das ‚Nibelungenlied‘. Die Ermordung Siegfrieds ist der zentrale Auslöser für die Veränderung Kriemhilds. Der Tod ihres geliebten Mannes, den sie selbst mit verantworten muss, ist für sie ein nicht zu verwindendes Ereignis. Es ist der Dreh- und Angelpunkt des Epos, das im zweiten Teil zu einer Rachegeschichte wird, denn Kriemhild ist vil lancraeche (Str. 1461,4), sie „rächt mit langem Atem“ (Heinzle 2015, S. 467).
In folgenden drei Schritten möchte ich an dem Textverbund von ‚Nibelungenlied‘ und ‚Nibelungenklage‘ Textdynamiken thematisieren:
Erste Dynamik: mündliches Erzählen und schriftlicher Text
Zweite Dynamik: Fassungen des ‚Nibelungenlieds‘
Dritte Dynamik: Antworten der ‚Nibelungenklage‘
Der zweite im Titel genannte Text, die sogenannte ‚Nibelungenklage‘, ist nicht gleichermaßen prominent wie das ‚Nibelungenlied‘, auf sie werde ich am Ende blicken, denn mit diesem Text, der in der handschriftlichen Überlieferung eng mit dem ‚Nibelungenlied‘ verbunden ist, decken wir mittelalterliche Lektüren der Nibelungengeschichte auf; Lektüren, die uns sowohl eine zeitgenössische Verständnissicherung als auch den Versuch und die Notwendigkeit einer Interpretation und Klärung des Untergangsgeschehens erkennen lassen. Die ‚Klage‘, so nennen wir die ‚Nibelungenklage‘ meist verkürzend, ist Kommentar zum ‚Nibelungenlied‘, ist Reflexion des im Lied erzählten Geschehens, das einen unvorstellbaren und unentrinnbaren tödlichen Ausgang nimmt. Stimmen und Deutungen des Untergangs, Zuweisungen der Schuld, Entschuldigungen werden in der ‚Klage‘ formuliert, ein Blick in die Zukunft wird geworfen, ein Prozess der Memoria eingeleitet. Ein Erzählen nach dem Untergang wird vorgeführt, das die Verschriftlichung fordert und gleichzeitig darstellt.
Wir lernen mit der ‚Klage‘ einen Text kennen, der mit einem anderen Text (dem ‚Nibelungenlied‘) gemeinsam überliefert ist, und der diesen ersten Text erklären möchte, und zwar im Genre der Literatur, im Modus des literarischen Erzählens, das annähernd zeitgleich mit dem ersten Text passiert.
Das ‚Nibelungenlied‘ ist um 1200 zum Text geworden, zu einem Text, der bis heute einen unglaublichen Sog entwickelt. Einen Autor des Textes kennen wir nicht mit Namen.
Der Text ist anonym überliefert.[^2 Anregende Einführungen bieten: Ursula Schulze, Das Nibelungenlied, Stuttgart 1997; Jan-Dirk Müller, Das Nibelungenlied, 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 2015 (Klassiker-Lektüren 5). Vgl. auch die Aufsätze in dem Band: Fasbender, Christoph (Hg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung, Darmstadt 2005.] Das ‚Nibelungenlied‘ wurde in einer Zeit zum Text gemacht, die wir die „Klassik des Mittelalters“ (Schulze 1997, S. 11) nennen, die von Namen wie Walther von der Vogelweide, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg geprägt ist, Autoren, die die höfische Klassik prägen, die ein Erzählen von Liebe und Minne in der deutschen Literatur ausprägen. Gleichzeitig entsteht das mittelhochdeutsche ‚Nibelungenlied‘, ein Heldenepos, das in Strophen verfasst ist, das eine Geschichte von Liebe, Verrat, Rache und vom Tod der vielen erzählt. Das ‚Nibelungenlied‘ ist ein Text ohne Autornamen, aber mit Spuren von Autorschaften. Am Text wurde im Zeitraum der Überlieferung gearbeitet.
Erste Dynamik: mündliches Erzählen und schriftlicher Text
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das ‚Nibelungenlied‘ mit Homers ‚Ilias‘ verglichen. Eine Auseinandersetzung der Philologen begann. Friedrich August Wolf hatte 1794 das Homerische Epos als „heterogenes Gebilde“, als „sekundäre Verbindung traditioneller, ehedem mündlich tradierter Lieder verschiedener Verfasser“ gesehen.[^3 Zitiert bei Joachim Heinzle, Traditionelles Erzählen. Beiträge zum Verständnis von Nibelungensage und Nibelungenlied, Stuttgart 2014 (Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beihefte 20), S. 125.] Daraus ergaben sich Brüche, Widersprüche, Unebenheiten im Text. Plötzlich stand das Genie Homer in der Kritik. War die ‚Ilias‘ keine autonome Dichtung eines Autors? Kein einheitliches Konzept eines Genies? Diese Diskussion wurde auf das ‚Nibelungenlied‘ übertragen. Karl Lachmann[^4 Zu dem Philologen der klassischen und deutschen Philologie, Karl Lachmann (1793– 1851), vgl. den Band von Anna Kathrin Bleuler und Oliver Primavesi (Hgg.): Lachmanns Erben. Editionsmethoden in klassischer Philologie und germanistischer Mediävistik, Berlin 2022 (Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie 19).] sah 1816 die „ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibelungen Noth“ in einzelnen romanzenartigen Liedern.[^5 Zitiert bei Heinzle 2014, S. 126.] Widersprüche und Motivationsdefizite im Text wurden als Spuren der Zusammenfügung dieser Lieder erklärt. Als Ursprung des ‚Nibelungenliedes‘ galten Lieder zu einzelnen Episoden, die zu einem Text ‚zusammengefügt‘ wurden; die Kohärenz des Textes stand zur Debatte.
Aus diesen Aspekten leite ich eine erste Bewegung ab, die Bewegung des mündlichen Erzählens über die Nibelungen hin zu einem Text, dem um 1200 verschriftlichten ‚Nibelungenlied‘. Mündlich vorgetragene Lieder und Erzählungen werden um 1200 zu einem Text geformt. Ich erinnere dafür an die Entstehungsumstände, wie die Forschung sie skizziert:
Die Nibelungensage ist im frühen Mittelalter entstanden, wohl zwischen dem 5. und 7. Jh. bei den Burgunden und Franken. Über Jahrhunderte hin mündlich tradiert, verbreitete sie sich über die Germania. Bezeugt ist sie spätestens seit dem 10. Jahrhundert in bildlichen Darstellungen aus dem nordwesteuropäischen Raum. Verschriftlicht wurde sie zuerst um 1200 im mhd. ‚Nibelungen-Buch‘ – dem Werkverbund von ‚Nibelungenlied‘ und ‚Klage‘ -, dann im 13. Jh. in Skandinavien: in der ‚Thidrekssaga‘ und in den Liedern der ‚Edda‘ sowie deren Prosatransformationen in der ‚Völsunga saga‘. (Heinzle 2014, S. 128)
Das mittelhochdeutsche ‚Nibelungenlied‘ um 1200 und die etwas spätere skandinavische Dichtung (‚Edda‘, ‚Thidrekssaga‘ und ‚Völsunga saga‘) verfestigen das Nibelungenerzählen, bilden aber auch das variante Erzählen in ihren Texten ab. Das Erzählen von den Nibelungen ist im mittelhochdeutschen Heldenepos ein anderes als in der altnordischen Lied- oder Prosadichtung. Und das Erzählen ist mit dem Text, der um 1200 entsteht, nicht stillgestellt.
Wir erkennen, dass bis ins 15. Jahrhundert hinein verschiedene Versionen nebeneinander bestanden haben müssen, in denen beispielsweise Kriemhild unterschiedlich gedeutet wurde, eher positiv oder eher negativ besetzt. Dem Dichter und den Bearbeitern des ‚Nibelungenlieds‘und auch dem Publikum waren Geschichten von Siegfried und den Burgunden in verschiedenen Varianten bekannt, darauf verweisen einzelne Textzeugen des ‚Nibelungenlieds‘ sehr deutlich. Zu denken ist an die Kurzform im ‚Nibelungenlied‘ n aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, die einen deutlichen Fokus auf den zweiten Teil der Erzählung legt, den ersten dagegen in wenigen Strophen raffend berichtet[^6 Zu der Handschrift n vgl. den Handschriftencensus unter: https://handschriftencensus.de/3520 (abgerufen am 19. November 2022) und die Textausgabe Das Nibelungenlied nach der Handschrift n. Hs. 4257 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. Hg. von Jürgen Vorderstemann, Tübingen 2000 (ATB 114); vgl. weiterhin Heinzle 2014, S. 175–196.] und an das sogenannte Darmstädter Aventiurenverzeichnis (‚Nibelungenlied‘ m) aus dem 14. Jahrhundert, das in diesem Relikt eines Inhaltsverzeichnisses (erhalten hat sich nur ein auf Vorder- und Rückseite beschriebenes Pergamentblatt) auf einige Jugendtaten Siegfrieds weist, die in das normale ‚Nibelungenlied‘ nicht eingegangen sind.[^7 Zur Handschrift m (Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 3249) vgl. den Handschriftencensus unter: https://handschriftencensus.de/2182 (abgerufen am 19. November 2022) sowie Johannes Janota, Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit (1280/90–1380/90), Tübingen 2004 (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit III/1), S. 220 und Tafel 9/1 und 9/2.]
Das mittelhochdeutsche ‚Nibelungenlied‘ ist also „Teil einer umfassenden Erzähltradition, aus der es entwickelt und in deren Zusammenhang es rezipiert wurde“ (Heinzle 2014, S. 129). Joachim Heinzle schlägt für diese narrativen Diskurse die Bezeichnung „Traditionelles Erzählen“ vor.[^8 Vgl. dazu Heinzle 2014, S. 125–135.] Diesem Erzählen liegt eine besondere Poetik zugrunde, die auf Summenbildung zielt, divergente Aspekte werden in den Text integriert, Varianten werden nicht ausgeschieden, sondern versammelt und miteinander verbunden, das trifft auch auf die Verschriftlichung zu. Der Verfasser des Buchepos emanzipiert sich um 1200 nicht von der mündlichen Tradition, sondern schreibt sie in einer spezifischen Weise fort. Wir haben im ‚Nibelungenlied‘ also einen Text vor uns, der die Spuren des variablen Erzählens bewahrt. Nicht alle Varianten des Erzählkontinuums können jedoch handlungslogisch in den Text integriert werden. An manchen Stellen gibt es Brüche oder logische Widersprüche. An diesen Widersprüchen oder Bruchstellen scheidet sich auch die Forschung zum ‚Nibelungenlied‘. Auf der einen Seite könnte man Jan-Dirk Müller positionieren, der mit seiner Monographie „Spielregeln für den Untergang. Die Welt des Nibelungenliedes“ (Tübingen 1998) für eine Interpretierbarkeit des Textes plädiert, auf der anderen Seite steht Joachim Heinzle, der zuletzt die zweisprachige Textausgabe herausbrachte, die endlich das ‚Nibelungenlied‘wieder mit der ‚Klage‘ verbindet, wie die handschriftliche Überlieferung des Mittelalters dies auch vorgibt. Müller sieht in den widersprüchlichen oder brüchigen Stellen Spuren eines bewusst archaischen Erzählens. Der Text wird in seiner Fremdheit anerkannt, das ‚Nibelungenlied‘ wird als interpretierbarer Text bezeichnet; Heinzle betont die Widersprüche des Textes, argumentiert immer wieder mit Bruchstellen, Leerstellen oder Löchern und der mündlichen Erzähltradition.[^9 Vgl. zu verschiedenen Aspekten Heinzle 2014, zu den Bruchstellen besonders S. 149–164.]
Zweite Dynamik: Fassungen des ‚Nibelungenlieds‘
Das ‚Nibelungenlied‘ ist in 37 Handschriften überliefert,[^10 Zur Überlieferung vgl. die Übersicht im Handschriftencensus unter: https://handschriftencensus.de/werke/271 (abgerufen am 19. November 2022).] die ältesten Textzeugen stammen aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts (C und S), die jüngste Handschrift stammt aus dem 16. Jahrhundert (d). Wir unterscheiden zwei Hauptfassungen des Textes: die *AB- oder not-Fassung und die *C- oder liet-Fassung. Das Sternchen (Asterisk) vor den Siglen AB und C bezeichnet die ‚Fassung‘. Die Handschriften mit der Sigle A und B stehen für die Fassung *AB. Die Handschrift mit der Sigle C steht für die Fassung *C.[^11 Vgl. hierzu Heinzle 2014, S. 97–124.]
Was bedeutet not- oder liet-Fassung? Das ist ein Unterscheidungskriterium und bezieht sich auf den Schlussvers des Liedes, den Wortlaut des letzten Verses:
Dieser lautet in *AB: hie hât das maere ein ende: daz ist der Nibelunge nôt
Dieser lautet in *C: hie hât das maere ein ende: daz ist der Nibelunge liet
[Hervorhebung SG]
Der Titel des Textes hat sich aus diesem letzten Vers ergeben.
*AB: ‚Hier ist die Geschichte zu Ende: das ist die Not, der Untergang der Nibelungen‘.
*C: ‚Hier ist die Geschichte zu Ende: das ist die Dichtung, das Epos von den Nibelungen‘ – oder kurz: das Nibelungenlied.
Das ‚Nibelungenlied‘ ist strophische Dichtung, wir finden die Langzeilenstrophe wieder, die wir aus dem frühen Minnesang kennen:
hie hât das maere ein ende: daz ist der Nibelunge liet
Strophische Dichtung heißt, der Text ist in Strophen gegliedert und damit sangbare Dichtung, vorgesungen vorgetragen und musikalisch begleitet. Aber auch hier ist es so wie für den Großteil des Minnesangs: eine aufgezeichnete Melodie ist für das ‚Nibelungenlied‘ nicht erhalten.
Der Text ist jedoch nicht nur in Strophen gegliedert (2379 Strophen), sondern zudem in 39 Kapitel geordnet, die als Aventiuren benannt sind. Das Wort âventiure ist ein „Modewort“ (Heinzle 2015, S. 1017), das gegen Ende des 12. Jahrhunderts aufkam und vor allem in den Artusromanen eine Rolle spielt, die Artusritter reiten dort stets auf âventiure. Ursprünglich bedeutet das Wort ‚Zufall‘ oder ‚Ereignis‘, es wird dann im Deutschen als Bericht und Erzählung verwendet (vgl. ebd., S. 1016f.). Das Wort Âventiure wird im Neuhochdeutschen zum ‚Abenteuer‘.[^12 Vgl. das Mittelhochdeutsche Wörterbuch unter: http://www.mhdwb-online.de/wb.php?linkid=10086000#10086000 (abgerufen am 19. November 2022) und das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm unter: https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=A00327 (abgerufen am 19. November 2022).] Der Nibelungendichter greift dieses Modewort auf, er will zeigen, dass sein Text modern und d.h. höfisch ist, dass er einer höfischen Kultur angehört. Und er führt Kapitelbezeichnungen ein, die er mit diesem Wort benennt: Auenture von den Nibelungen, so beispielsweise in der Handschrift C des ‚Nibelungenlieds‘ (Karlsruhe BLB, Cod. Donaueschingen 63, 2. Viertel 13. Jahrhundert) zu lesen. In der Handschrift C steht die Überschrift rot (rubriziert) über dem Textbeginn auf f. 1r (Abb. 1). In dieser Form nicht nur hier, sondern regelmäßig zur Untergliederung vor dem Beginn eines neuen Kapitels notiert. Das ‚Nibelungenlied‘ ist also ein wohleingerichteter Text, durch Initialen und Kapitelüberschriften gegliedert, das weist deutlich auf eine Buchdichtung hin. Die mündlich erzählte Nibelungensage ist im nun verschriftlichten ‚Nibelungenlied‘ Text geworden.

Abbildung 1: Rubrizierte Überschrift zu Beginn des ‚Nibelungenlieds‘ in Handschrift C (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen 63), f. 1r: Auenture von den Nibelungen.
Wie beginnt nun dieser Text? Sehen wir auf die erste Strophe der ersten Aventiure, sie lautet (nach der Textausgabe von Joachim Heinzle, S. 10):
Ez wuohs in Burgonden ein vil edel magedîn,
daz in allen landen niht schoeners mohte sîn,
Kriemhilt geheizen. si wart ein schoene wîp.
dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp.
‚Im Burgundenland wuchs ein adeliges Mädchen heran,
es war das schönste auf der Welt. Sein Name war Kriemhild.
Es wurde eine schöne Frau, deswegen verloren viele Männer ihr Leben.‘[^13 Meine Übersetzung weicht in Kleinigkeiten von derjenigen Heinzles ab.]
Das Burgundenland bezeichnet die Gegend um Worms zu beiden Seiten des Rheins; es handelt sich nicht um das heutige Burgund (vgl. Heinzle 2015, S. 1038). Dort wuchs Kriemhild zu einer schönen Frau heran. Die vierte Verszeile der ersten Strophe deutet bereits den Tod an. Die Schönheit der Frau wird dafür verantwortlich gemacht. Viele Männer verloren ihretwegen ihr Leben. Ein Textbeginn, der leicht tönt, jedoch eine Wucht bekommt. Wie kann aus der Schönheit eines Mädchens ein solches Untergangsgeschehen resultieren? Diese Frage wird schon hier aufgeworfen.
Das ‚Nibelungenlied‘ beginnt jedoch nicht in allen Fassungen gleichlautend mit dieser Strophe. In der Fassung *C lesen wir den deutlich bekannteren Beginn:[^14 Zitiert nach Heinzle 2015, S. 1036.]
Uns ist in alten maeren wunders vil geseit
von heleden lobebaeren, von grôzer arebeit,
von freuden und hôchgeziten, von weinen unde klagen,
von küener recken strîten muget ir nû wunder hoeren sagen.
‚Uns ist in alten Erzählungen (in Erzählungen aus früherer Zeit) viel Wunderbares berichtet worden von berühmten Helden, von großer Mühsal,
von Freude und von Festen, von Weinen und von Klagen,
vom Kampf tapferer Männer könnt ihr nun Erstaunliches erfahren.‘
Diese Strophe ist eine besondere. Um wie viele Sätze handelt es sich? Wo würden wir einen Punkt machen, wenn wir innerhalb der Strophen einen zweiten Satz ansetzen würden? Wer ist angesprochen? Wer spricht? Michael Curschmann hat die Strophe präzise seziert und ihre Dimension erschlossen. Diese „Prologstrophe“ ist alles, was uns als „Anweisung zur Lektüre“ des ‚Nibelungenlieds‘ erhalten ist, so Curschmann (Curschmann 1992, S. 55). Sie habe „nicht im ursprünglichen Konzept gestanden“ (ebd., S. 62), sondern sei im Zuge eines späteren „Redaktionsvorgangs“ verfasst und ergänzt worden (ebd.). Am Text des ‚Nibelungenlieds‘ wurde gearbeitet, der Text bewegt sich, wenn er weiter abgeschrieben wird, er zeigt damit eine gewisse Dynamik, die wir an den Überlieferungszeugen nachverfolgen können. Man änderte das Verschriftlichte und ergänzte in der etwas späteren Fassung das eine oder andere; hier ergänzte man den unmittelbaren Textanfang um eine Art Prolog. Aber man änderte nicht im Sinne eines Korrekturtextes eines Autors, der seinen eigenen Wortlaut in seinem Manuskript verbessert, sondern es sind Veränderungen in der Niederschrift mehrerer anderer Handschriften, die von anderen Personen (Redaktoren, Abschreibern, Bearbeitern) als dem Autor selbst stammen. Das ist das Spezifische an der Textüberlieferung des Mittelalters: jeder Textzeuge bietet einen individuellen Text in einem spezifischen Abstand zu einer Autorfassung, die wir meist nicht vorliegen haben. Der Blick auf ein ursprüngliches, ein originales ‚Nibelungenlied‘ ist uns gewissermaßen verstellt. Während der Weitertradierung eines Textes kann er sich im Wortlaut verändern.
Man könnte also sagen: Es gibt nicht nur ein ‚Nibelungenlied‘, sondern es existieren mehrere ‚Nibelungenlieder‘. Sie sind weitgehend identisch, aber in einigen Details doch verschieden, wie in der Betitelung am Schluss oder im Textbeginn. Sehen wir noch einmal auf die erste Strophe in der Handschrift C (Karlsruhe, BLB, Cod. Donaueschingen 63). Die Strophe besteht aus einem einzigen Satz nach dem Prinzip einer constructio apokoinou (Curschmann 1992, S. 63f.). Als gemeinsames Objekt von Vor- und Nachsatz fungiert eine Folge von fünf Präpositionalphrasen, die zum Teil kontrastiv angeordnet sind. Uns ist geseit […] muget ir nu bildet die Klammer des Satzes, wunders vil im ersten Vers steht gegen wunder im vierten Vers. In alten maeren hat man schon viel wunders erzählt, nun/jetzt/heute und hier könnt ihr wunder erzählen hören. Es ist das Wunderbare und Herausragende von Geschichten der Vergangenheit, das hier angesprochen ist, jetzt aber, mit der folgenden Geschichte, der Erzählung von den Nibelungen und deren Untergang werdet ihr etwas wirklich Spektakuläres hören.
Wo setzen wir das muget ir nu an? Worauf soll es sich beziehen? Nur auf den Kampf tapferer Männer oder auch auf die anderen Phrasen? Hier merken wir, wie wichtig Orthographie, Kommasetzung, markierte Satzenden für unser Verständnis von Texten sind. Die Herausgeber wissenschaftlicher Texte nehmen hierbei Entscheidungen vor und geben uns damit eine Hilfestellung für unsere Interpretation an die Hand. Aber eine solche Markierung ist für handschriftliche Texte des Mittelalters nicht in gleicher Weise gegeben. Vergewissern wir uns in der Karlsruher Handschrift (vgl. Abb. 1).[^15 Der Textbeginn ist zitiert nach dem Digitalisat in Karlsruhe, unter: https://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/content/pageview/738115 (abgerufen am 20. November 2022). Die Abkürzungen (Nasalstriche, -er) werden aufgelöst.] Wie sieht hier der Beginn aus? Eine große Schmuckinitiale U eröffnet den Text. Dann erkennt man einige Majuskelbuchstaben in grüner und roter Farbe, durch Punkte voneinander abgesetzt:
(U) N S. I S T. Jn alten mæren.
wunders vil geseit. von heleden lobebæren. von
grozer arebeit. von frevde vnd hochgeciten
von weinen vnd klagen. von kvner rec
ken striten. mvget ir nv wunder horen sa
gen. […]
Was erkennen wir noch? Halbverse werden durch Punkte abgetrennt. Es existieren also bereits in dieser Handschrift aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts Textgliederungszeichen. Aber das beantwortet nicht die Struktur des Satzes, die Präpositionalphrasen können sich trotz der Gliederungszeichen auf die alten mæren, aber auch auf das folgende wunder beziehen.
Wir haben in dieser Strophe einen Erzähler vor uns, der das Publikum anspricht und sich selbst mit einbezieht in die Menge derer, denen in alten Geschichten bisher viel Wunderbares erzählt worden ist. Er beginnt mit einem inkludierenden ‚uns‘: Uns ist schon viel erzählt worden, aber jetzt, nu, könnt ihr etwas Neues hören. Er trennt sich hier ab, und zwar als Erzähler von Neuem, er nennt sich aber nicht mit Namen. Wir haben alle schon wunders vil gehört, das eine und das andere von Freude und von Leid, ich bin Mitglied dieser Erzählgemeinschaft, deutet er an, nun aber hört ihr (von mir) wunder – nun hört ihr von mir ein wahrhaftes Wunder. Der Bezug gilt der gesamten folgenden Erzählung von den Nibelungen.
Das ‚Nibelungenlied‘ will mündliche Tradition und mündlichen Stil einheimischer Provenienz ins Literarische verlängern. Es will berichten, wie es die Gattung seit eh und je tut, aber jetzt mit literarischem Anspruch. (Curschmann 1992, S. 64)
Die Nibelungensage ist lange Zeit mündlich erzählt worden, nun aber hört ihr sie neu, jetzt hört ihr das ‚Nibelungenlied‘ als literarischen, schriftlich fixierten Text. So die Introduktion des Heldenepos in der Fassung *C (zitiert in der Handschrift C), die erst danach die Strophe von dem Mädchen Kriemhild folgen lässt (Str. 2). Diese schöne und junge Kriemhild wächst am Königshof in Worms auf, sie wird die Frau des jungen Königssohns Siegfried, der aus Xanten nach Worms kam, weil er von ihrer Schönheit gehört hatte. Siegfried bekommt Kriemhild zur Frau, dafür muss er aber Gunther, dem König und Bruder Kriemhilds behilflich sein. Gunther will ebenfalls heiraten, er hat von einer schönen Frau gehört, die Brünhild heißt. Diese ist stark und wählt ihren zukünftigen Ehemann durch einen Wettkampf aus, nur denjenigen, der sie im Weitsprung, im Speerwurf und im Steinwurf übertrumpft, wird sie heiraten, den Verlierer töten. Gunther ist nicht stark genug für diesen Wettbewerb, das weiß Siegfried; Gunther benötigt die Kraft und Macht des Siegfried, der übermenschliche Kräfte und weitere Möglichkeiten besitzt: Siegfried ist durch das Bad im Drachenblut unverwundbar (bis auf eine Stelle zwischen den Schulterblättern), zudem besitzt er einen Tarnmantel, mit dem er unsichtbar wird. Mit diesen Hilfestellungen gelingt Gunther die Werbung um Brünhild: Siegfried wird ihn unsichtbar begleiten in den einzelnen Wettkämpfen und er wird Brünhild besiegen; es sieht für die Öffentlichkeit so aus, als ob Gunther den Sieg errungen habe, doch eigentlich war Siegfried derjenige, der Brünhild eroberte.
Dieser Betrug hat Folgen. Es wird einige Jahre später zu einem Streit der beiden Königinnen kommen (erzählt in der 14. Aventiure des ‚Nibelungenlieds‘), in dem Kriemhild ihrer Schwägerin vorwirft, dass Siegfried der eigentliche Bezwinger, vor allem in der Brautnacht gewesen sei, denn hier benötigte Gunther noch einmal die Hilfe Siegfrieds. Kriemhild beschimpft Brünhild, ihr Mann Siegfried habe sie, Brünhild, im Bett bezwungen, sie legt Beweise vor, den Gürtel Brünhilds und einen Ring, beides hatte Siegfried ihr abgenommen; die Königin Brünhild weint (Str. 843,1; 852,1), weinend findet sie auch Hagen an (Str. 864,1). Siegfried muss getötet werden: daz Brünhilde weinen sol im wesen leit, so sagt Hagen (Str. 873,3). Warum hat Siegfried seiner Frau diesen Gürtel gegeben und warum hat er sie eingeweiht in diese Männergeheimnisse? Hinterrücks wird Siegfried ermordet (Str. 981), und zwar von Hagen, die unverwundbare Stelle zwischen den Schulterblättern hatte Kriemhild selbst dem treuen Vasallen Hagen genannt und mit einem gestickten Kreuzzeichen auf dem Gewand markiert (Str. 904). Sie hat selbst ihren Mann verraten, so sagt der Text (Str. 905,3). Dieses Leid wird Kriemhild ihr weiteres Leben begleiten. Sie trauert dreizehn Jahre (Str. 1142,2), zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, ihre Liebe ist ihr genommen, auch das Gold, das sie besaß, hat Hagen geraubt und im Rhein versenkt (Str. 1137). Doch dann hört erneut ein Mann von ihrer Schönheit, der König der Hunnen, Etzel (Str. 1143f.), dessen Frau Helche verstorben war; er sendet einen Brautwerber, den treuen Markgrafen Rüdeger aus Bechelaren nach Worms. Dort ist Kriemhild geblieben, zurückgezogen, neben dem Münster, in der Nähe des Grabes ihres Mannes wohnend (Str. 1101f.). Sie lässt sich schließlich auf die Hochzeit mit Etzel ein, denn Rüdeger sagt etwas, was in ihr Rachegedanken entzündet: er werde ihr helfen, ihr erlittenes Leid zu ergetzen (Str. 1255,3), wiedergutzumachen, vergessen zu machen. Rüdeger bittet sie, nicht länger zu weinen (Str. 1256,1), seine Verwandten, seine Vasallen und er selbst würden im Hunnenland dafür sorgen, dass jeder, der ihr etwas angetan hätte, dies schwer büßen müsse (Str. 1256,2–4). Kriemhild lässt ihn darauf einen Eid schwören, dass er derjenige sei, der ihr Leid vergelte. Damit wird sie zur Rächerin gemacht. Sie heiratet Etzel, beide leben an einem kulturell vielfältigen und prächtigen Hof in Ungarn. Kriemhild ist erneut eine mächtige Königin (vgl. Str. 1383 und 1386). Sie lädt nach dreizehn Jahren ihre Brüder aus Worms dorthin ein, sie habe sie so lange nicht gesehen (22. Aventiure). Die Einladung endet im großen Blutbad, das nur wenige überleben. Kriemhild will sich an Hagen rächen, den alle als Mörder Siegfrieds kennen, es kommt zu einer Schlacht, einem Gemetzel, das kaum jemand überlebt. Dietrich von Bern greift endlich ein in das Geschehen und nimmt Hagen und Gunther gefangen (Str. 2352, 2353, 2361, 2362); Dietrich von Bern übergibt nach intensiven Kämpfen, in denen bereits sehr viele Helden getötet worden sind, die beiden Männer, den König Gunther, den Bruder Kriemhilds und dessen Ratgeber und Gefolgsmann Hagen an die Königin Kriemhild. Hagen und Gunther sind gefesselt; schont sie, sagt Dietrich und geht weinend davon (Str. 2364, 2365). Im Fortgang gestaltet diese letzte, die 39. Aventiure des ‚Nibelungenlieds‘ ein grausames Schlusstableau. Was ist aus dem schönen Mädchen Kriemhild geworden?
sît rach sich grimmeclîchen daz Etzelen wîp.
den ûz erwelten degenen nam sie beiden den lîp. (Str. 2365, 1f.)
‚Dann rächte sich die Frau Etzels fürchterlich. Sie nahm den beiden auserwählten Helden das Leben.‘
Wie macht sie das? Schließlich ist sie eine Frau. Sie trennt die beiden Männer voneinander und geht zu Hagen. Voller Hass spricht sie zu ihm:
welt ir mir geben widere, daz ir mir habt genomen,
sô muget ir wol lebende heim zen Burgonden komen. (Str. 2367,3f.)
‚Wenn ihr mir zurückgebt, was ihr mir genommen habt,
dann könnt ihr lebend nach Hause ins Burgundenland kommen.‘
Was kann Hagen ihr jetzt noch zurückgeben, was er ihr genommen hat? Wofür sie ihn nach dieser intensiven Rachezeit nun am Leben lassen und nach Hause ziehen lassen würde?
Kriemhilds Worte sind rätselhaft. Hagen bezieht die Aussage auf den Hort, auf den Nibelungenschatz. Vergeblich fordere sie diesen, sagt der grimme Hagen. Er habe geschworen, dessen Versteck nicht zu verraten, solange einer seiner Herren (gemeint sind die Könige in Worms) lebe.
In der unmittelbar folgenden Strophe heißt es pragmatisch und grausam zugleich:
‚Ich bring ez an ein ende‘, sô sprach daz edel wîp.
dô hiez si ir bruoder nemen sînen lîp.
man sluoc im ab daz houbet. bî dem hâre si ez truoc
vür den helt von Tronege. dô wart im leide genuoc. (Str. 2369)
‚Ich bringe es zu Ende, sagte die Königin.
Da ließ sie ihren Bruder töten.
Man schlug ihm den Kopf ab. Sie trug das abgeschlagene Haupt an den Haaren
vor den Helden von Tronje (=Hagen). Das war für ihn ein großer Schmerz.‘
Was ist passiert? Kriemhild geht zu dem gefesselten Hagen. Sie bietet ihm an, dass er lebendig nach Worms zurückkomme, wenn er ihr zurückgebe, was er ihr genommen hat. Was meint sie? Meint sie es ernst? Sie will ausgerechnet ihren Erzfeind Hagen lebendig zurückschicken, wo sie doch schon so viele Verwandte und Gefolgsleute verloren hat? Ihm galt ihre gesamte Racheintention. Ihm ein Angebot machen? Ist es ein falsches, ein hinterhältiges Angebot? Siegfried ist tot, Hagen hat ihn ihr genommen, ihn kann er ihr nicht zurückgeben. Ein ergetzen des leides wird nie möglich sein. Auf den Schatz bezogen, wie Hagen denkt? Gebt mir den Schatz zurück, dann lasse ich euch am Leben? Wozu bräuchte sie das Gold? Sie hat genug Macht und Reichtümer, Etzel ist unermesslich reich.
Das Angebot ist ein grausamer Todesstoß, denn Hagen weiß, dass niemand lebendig nach Worms zurückkehren wird (Str. 1540–1542, 1580). Das Angebot ist ein Scheinangebot. Kriemhild formuliert dies, wohlwissend, dass eine Rückgabe ihres Besitzes unmöglich ist. Ob sie auch die Konsequenzen berücksichtigt?
Hagen bezieht ihre Forderung auf den Hort – solange noch einer der Könige lebt, werde er, Hagen, das Versteck nicht verraten; da lässt sie ihren eigenen Bruder enthaupten und trägt den blutigen Kopf eigenhändig zu Hagen. Die Geste ist deutlich: Hier, der letzte Zeuge ist tot. Der Weg ist frei, um das Versteck des Horts zu verraten. Doch das tut Hagen nicht. Die Inszenierung geht weiter. Hagen spricht zu ihr: Du hast es nach deinem Willen zu Ende gebracht. Es ist ausgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Deine Brüder, Gunther, Giselher und Gernot sind tot:
den schatz den weiz nû niemen wan got âne mîn.
der sol dich vâlandinne, immer verborgen sîn. (Str. 2371,3f.)
‚Nur Gott und ich wissen nun, wo der Schatz ist.
Dir, Teufelin, soll er für immer verborgen sein.‘
Hier nennt Hagen Kriemhild eine Teufelin. Was tut Kriemhild? Sie zieht aus der Scheide des vor ihr gefesselten Hagen das Schwert Balmung, das ihrem Mann Siegfried gehört hat, hebt den Kopf Hagens an und schlägt ihm den Kopf ab. Das schöne Mädchen Kriemhild ist hier zur Henkerin und Teufelin geworden, sie hat unermessliche Kraft aufgebracht, ihr gesamtes ertragenes Leid liegt in diesem Schlag gegen Hagen. Ihr Mann Etzel steht dabei, sieht es und klagt:
Wâfen, sprach der vürste, wie ist nû tôt gelegen
von eines wîbes handen der aller beste degen,
der ie kom ze sturme oder ie schilt getruoc (Str. 2374, 1-3).
Etzel klagt, aber er handelt nicht. Der beste aller Helden ist von der Hand einer Frau getötet worden. Hagen wurde von Kriemhild enthauptet. Ein Skandalon. Hildebrand stürzt voller Zorn herbei, ein Held auch er, der treue Gefolgsmann von Dietrich von Bern, er handelt:
er sluoc der küneginne einen swaeren swertswanc (Str. 2376,2)
‚Er schlug mächtig mit dem Schwert auf die Königin ein.‘
Was sagt der Nibelungenerzähler?
Dô was gelegen aller dâ der veigen lîp.
ze stücken was gehouwen dô daz edel wîp.
Dieterîch und Etzel weinen dô began.
si klagten inneclîche beide mâge und man. (Str. 2377)
‚Da waren alle tot, die zum Tode bestimmt waren.
Die Königin war in Stücke gehauen.
Dietrich und Etzel brachen in Tränen aus.
Sie beklagten von Herzen Verwandte und Gefolgsleute.‘
Das schöne Mädchen Kriemhild vom Anfang der Geschichte liegt am Ende zerstückelt vor uns. Kriemhild, das schoene wîp (Str. 2,3), sie hatte tatsächlich vielen Männern den Tod gebracht, aber sie hatte sich am Ende eigenhändig an dem Mörder ihres Mannes gerächt.
Ine kan iu niht bescheiden, waz sider dâ geschach,
wan ritter unde vrouwen weinen man dâ sach,
dar zuo die edeln knehte ir lieben vriunde tôt.
dâ hât daz maere ein ende. diz ist der Nibelunge nôt. (Str. 2379)
Der Erzähler, der am Anfang Unerhörtes, wunder versprochen hat, hat Unerhörtes geboten, aber er weiß am Ende nicht, wie es weitergeht:
‚Ich kann euch nicht sagen, was später dort geschah. Nur, dass Ritter und Damen und hochgeborne Knechte ihre lieben Freunde beweinten.
Da endet die Geschichte. Das ist der Untergang der Nibelungen.‘
Diese sogenannte Hortforderung der 39. Aventiure des ‚Nibelungenlieds‘ hat die Forschung beschäftigt. Es gibt Lösungsangebote.[^16 Zu den Deutungen der Forschung, s. Heinzle 2015, S. 1506–1508 (Stellenkommentar); dann besonders auch: Heinzle 2014, S. 149–164. Jan-Dirk Müller dagegen versucht eine Deutung der Stelle, ihm folge ich in meiner Lektüre: Müller 1998, S. 147–151.] Für Joachim Heinzle ist diese Stelle wie manch andere Beweis für die Brüchigkeit des Textes, für Widersprüche, Traditionslinien aus älteren Erzählungen, aus den mündlichen Traditionen, die hier Eingang gefunden hätten in die Verschriftlichung des Textes: „Die Interpretationen unterstellen einen Sinn, der im Text in keiner Weise angelegt ist“ (Heinzle 2015, S. 1507). Er sieht einen „erzähltechnischen Defekt“ (Heinzle 2014, S. 157) und wertet: der „Nibelungendichter war kein Originalgenie“ (ebd.). Dieser Dichter hatte mit einer vielgestaltigen mündlichen Tradition zu tun, die er in seine literarische Fassung einbinden musste:
Die Aufgabe, die er sich (oder die man ihm) gestellt hatte, bestand darin, diese Erzähltradition in Literatur umzusetzen, sie mittels der Erzähltechniken, Erzählmodelle, Deutungsmuster, die in der literarischen Tradition ausgebildet waren, in diese einzubinden. (Heinzle 2014, S. 157)
Wie auch immer die Logik oder Unlogik der Hortforderungsszene zu deuten ist, das Mittelalter selbst hat sich in seiner Literatur um Deutungen des Nibelungengeschehens bemüht. Hier kommt nun der zweite Text zur Sprache, die sogenannte ‚Nibelungenklage‘, die sich beinahe bruchlos in der Überlieferung des ‚Nibelungenlieds‘ anschließt. Damit möchte ich eine dritte Dynamik andeuten, die Dynamik der Antwort, die der zweite Text bietet oder zumindest versucht und damit einen Dialog herstellt zwischen zwei literarischen Texten der Zeit um 1200.
Dritte Dynamik: Antworten der ‚Nibelungenklage‘
In der Handschrift C (Karlsruhe, BLB, Cod. Donaueschingen 63) wird unmittelbar nach dem letzten Vers des ‚Nibelungenlieds‘ gleichsam als neues Kapitel die ‚Klage‘ aufgeschlagen, und zwar unter der Überschrift: Auenture von der Klage. (Abb. 2)

Abbildung 2: Rubrizierte Überschrift und Textanfang der ‚Nibelungenklage‘ in der Handschrift C (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen 63), f. 89r: Auenture von Der Klage.
Wir haben die Handschrift C als Buchdichtung identifiziert, wohl eingerichtet und gegliedert. ‚Nibelungenlied‘ und ‚Klage‘ stehen hier unmittelbar hintereinander, die ‚Klage‘ wird als nächstes Kapitel dieser einen, großen Nibelungengeschichte bezeichnet. Unmittelbar nach dem letzten Wort des zum Text gewordenen ‚Nibelungenlieds‘ fängt doch noch etwas an, obwohl dessen Erzähler behauptet hatte, von einem Fortgang nichts zu wissen. In der Buchdichtung, in der Literatur geht es weiter und kann es weitergehen:[^17 Nicht nur in der einen Handschrift in Karlsruhe folgt die ‚Klage‘ dem ‚Nibelungenlied‘, sondern in den neun vollständigen Handschriften, die den Text der ‚Klage‘ überliefern, ist der Textverbund von ‚Nibelungenlied‘ und ‚Klage‘ erhalten; zur Überlieferung s. den Handschriftencensus unter: https://handschriftencensus.de/werke/195 (abgerufen am 27. November 2022).]
Hie hebt sich ein maere,
daz waere vil redebaere
und waere vil guot ze sagene,
niuwan daz ez ze klagene
den liuten allen gezimt (V. 1–5).[^18 Auch die ‚Klage‘ wird nach der Textausgabe von Heinzle zitiert.]
‚Hier beginnt eine Geschichte, die sehr erzählenswert und durchaus auch gut zu erzählen wäre, wenn sie nicht zugleich alle (die sie hören) zum Klagen und Trauern zwingen würde‘; so lautet der Beginn der ‚Klage‘.
Der Text, der hier einsetzt, ist ein Reimpaartext; genauso notiert wie die Strophen des ‚Nibelungenlieds‘, durch Verspunkte die einzelnen Verse voneinander abtrennend. Eine etwas größere Initiale markiert einen Kapitelanfang auf der Textseite. Darüber hinaus ist kein Trennungsindiz zu erkennen. Der Reimpaarvers ist Trennungs- und Abstandszeichen genug, das ist der Hiatus, der sich ergeben muss zur voraufgehenden Untergangsgeschichte. Ob es eine zeitliche Trennung zwischen den Texten, zwischen der Verschriftlichung der Geschichten gibt, kaschiert der beinahe nahtlose Übergang der Handschriften, die zwei Texte auch in eine zeitliche Nachbarschaft stellen und sie dadurch synchron halten, sie in eine Synchronität bringen. Hier, in Handschrift C, muss man nicht einmal umblättern, nur weiterlesen. Die Überlieferung der Handschriften stellt zwei Texte nebeneinander, die nun auf einer gemeinsamen zeitlichen Ebene existieren; die Überlieferung schaltet sie unmittelbar hintereinander und bringt sie in einen Dialog oder genauer: bildet dadurch einen Dialog ab. Im Unterschied zur Strophenform wählt der Klageerzähler, der sich ebenfalls nicht mit Namen nennt, den für den Roman der Zeit üblichen Reimpaarvers und wendet sich damit vom älteren Modell der Strophe ab, wendet sich damit auch von der Form, dem Duktus und Ton des ‚Nibelungenlieds‘ ab. Die ‚Klage‘ wählt einen neuen Ansatz, sie versucht einen Anschluss an das Untergangsgeschehen, formt aber neu.[^19 Zu den vier Fassungen der ‚Klage‘ vgl. Joachim Bumke (Hg.): Die Nibelungenklage. Synoptische Ausgabe aller vier Fassungen, Berlin/New York 1999.]
Die ‚Klage‘ formuliert sehr bald eine Entschuldigung für Kriemhild. Niemand konnte von Kriemhild etwas Schlechtes sagen; wer die Geschichte kennt, der spricht sie von Schuld frei, denn diese Frau, diz vil edel werde wîp (V. 156) handelte aus Treue (triuwe, V. 157), sie rächte sich aus großem Schmerz (V. 151–158). Kriemhild, die wir gerade noch mit dem blutigen Haupt ihres Bruders vor uns gesehen haben, wird hier von dem unbekannten Verfasser der ‚Klage‘ entschuldigt. Die Lesart der sich mit langem Atem rächenden liebenden Frau wird hier unterstützt.
Der gesamte Text der ‚Klage‘ ist in großen Partien Klagerede; Klage über die Toten, die wir vor uns liegen sehen. Wir gehen lesend und schauend an den Ort des Geschehens, wir stehen in der Burg Etzels und sehen die ganzen Toten, wir schreiten mit dem Erzähler die Fundorte ab und hören die Klagen der Überlebenden, es sind vor allem Dietrich, Hildebrand und Etzel. Der Text vollzieht einen Gang der Erinnerung, indem der Tatort besichtigt und abgeschritten wird; der Text vollzieht das Geschehen nach im Gestus des Zeigens und Erinnerns. Diesen Gestus kennt man aus der geistlichen Literatur, indem man den Gang der Passion Christi nachempfindet, indem man die einzelnen Stationen seines Leidens in Gedanken und in der memorierenden Andacht aufsucht. Der Text der ‚Klage‘ macht überdeutlich, was ein Schlachtfeld ist, man bahnt sich lesend einen Weg durch die blutigen, blutüberströmten Toten und Körperteile. Und dann beugt man sich über einzelne Tote, nicht aus Neugier, sondern, um sie in ihrer Individualität und Würde, in ihrer Lebensleistung aufzurufen und anzuerkennen, für die Nachwelt, für die Leser zu erinnern und um sie zu betrauern.
Der Text der ‚Klage‘ setzt damit am Ende der nibelungischen Katastrophe an und beschaut das Ergebnis, man beklagt und versucht zu verarbeiten, man erinnert sich an die Leistungen der einzelnen Personen, die nun tot vor uns liegen. Lesend und nachvollziehend, ein Akt, der gewissermaßen das Pronomen uns der ersten Nibelungenstrophe aufgreift und uns, alle Leser dieses Textes, miteinbezieht in den Erinnerungs- und Erkenntnisakt. Mit den Figuren sehen wir auf die Toten, auf die Geschichte der Nibelungen zurück und wir erkennen die Zusammenhänge, formen uns eine Meinung aus.
Dietrich von Bern kommt beispielsweise zur Leiche Kriemhilds (V. 759–761). ‚Nie hörte ich von einer schöneren Frau erzählen‘, sagt er (V. 774f.), indem er sich an die Tote wendet, und zwar mit einem muote klegelich (V. 760), im Gestus der Trauer. Dietrich erinnert an die Königin und erweist ihr einen letzten Dienst. Er lässt ihren Leichnam aufbahren und trägt das abgeschlagene Haupt Kriemhilds herbei (V. 786f.). Was für eine Szene, was für eine Tat! Dietrich setzt den Körper Kriemhilds wieder zusammen, den Hildebrand getrennt hatte, mit seinen eigenen Händen hebt er das Haupt aus dem Blut und trägt es herbei. Die Tötung Kriemhilds durch Hildebrand wird hier als Enthauptung identifiziert. Dietrich von Bern erinnert an die Person und Königin, die durch ihre Schönheit einzigartig war in der Welt. Kriemhild hielt am Ende das Haupt ihres Bruders Gunther ihrem Todfeind Hagen entgegen, hier trägt Dietrich nun ihr Haupt zu ihrem Körper und komplettiert die Figur im Nachgang wieder zum Ganzen.
Auch König Etzel kommt hinzu, er ist der jâmers rîche, / dem jâmer wol gelîche (V. 801f.), Etzel ist voller Schmerz, ist ganz Schmerz, er ruft in diesem Zustand seine Frau positiv in Erinnerung: getriuwer wîp wart nie geborn / von deheiner muoter mêre (V. 834f.).
‚Nie wurde von einer Mutter eine treuere Frau geboren‘ als Kriemhild, so seine Deutung der triuwe der Königin.
Von den Figuren der Geschichte wird Trauer- und Erinnerungsarbeit geleistet. Die Taten der einzelnen werden vor den Toten stehend artikuliert, memoriert und dadurch in Erinnerung gehalten, ins kulturelle Gedächtnis überführt. Damit wird ihnen Ehre erwiesen, die Ehre im Kulturraum der Literatur. Die Erinnerung wird damit weitergegeben an die Rezipienten, an jeden Leser des Textes.
Aber es werden auch Urteile gesprochen und ausgesprochen, Hildebrand ruft beispielsweise aus: nû seht, wâ der vâlant / lît, der ez allez riet! (V. 1250f.).
‚Seht dorthin, wo der Teufel liegt, der alles angestiftet hat.‘ Gemeint ist Hagen, den Hildebrand hier zum Schuldigen des Untergangs macht und zum Teufel; er ist der Teufel, nicht Kriemhild. Es ist Hagens Schuld, dass es keine friedliche Lösung gab (V. 1252f.), wird an dieser Stelle formuliert. Hildebrand fällt ein weiteres Urteil. Wer konnte erwarten, dass aufgrund von Siegfrieds Tod so viele tapfere Männer sterben mussten (V. 1264–1267). Die großen Helden haben den schrecklichen Zorn Gottes schon lange verdient (V. 1271–1273), denn: dô muosen si den gotes slac / lîden durch ir übermuot (V. 1276f.). Der Schlag Gottes traf sie aufgrund ihres Hochmuts, daz hânt si in selbe erworben (V. 1282). Sie haben ihn selbst provoziert. Gemeint sind die burgundischen Kämpfer, die Wormser Könige, gemeint sind aber eventuell alle Helden, die nun verdientermaßen tot sind. Alle Helden hat der gotes slac getroffen. Gott hat das Ende der Heldenzeit angemahnt und aufgerufen.
Indem die einzelnen Toten aufgefunden und benannt werden, erhalten sie einen Platz im literarischen Gedächtnis, die ‚Klage‘ gibt ihnen gleichsam einen Gedenk- und Erinnerungsort.
Jan-Dirk Müller spricht hierbei von „buchhalterischer Genauigkeit“ (Müller 1998, S. 117), mit der alle Personen aufnotiert werden. Mehr als 800 Tote hatte man aus dem Saal herausgetragen (V. 1648). Das Unglück wird gemessen und vermessen, es wird in Zahlen übersetzt, dadurch sichtbar und spürbar, benennbar und er-zählbar gemacht. Das Leid wird in eine Zahl und in eine Erzählung überführt, dadurch wird es fassbar und erfassbar gemacht. Die Toten werden benannt und in das Buch der Literatur-Geschichte eingetragen. Die Knappen, die Brüder, einzelne Kämpfer, Trauergesten, krachende Knochen werden genannt. Reaktionen auf den Tod werden vor Augen geführt, berühmte Männer weinen oder werden ohnmächtig angesichts des Leids, das sie vor sich haben.
Die ‚Klage‘ thematisiert die Zeit unmittelbar nach den schrecklichen Kämpfen, zeigt die Folgen, zeigt das Leid auf, sie erzählt das ‚Nibelungenlied‘ in gewisser Weise weiter.
Doch die Toten, die hier nun bestattet sind, haben Verwandte, in Worms oder in Bechelaren. Wie soll man die Botschaft dorthin tragen? Wer soll der Bote sein? Man denkt an die Hinterbliebenen, sie müssen erfahren, was passiert ist. Der Spielmann Swemmel soll der Bote sein. Dem sind die Wege gut bekannt, heißt es (V. 2594), schließlich hatte er schon einmal die Einladung nach Worms übermittelt, als Kriemhild ihre Brüder einlud. Man knüpft also unmittelbar an die vorausgehende Geschichte an, es sind dieselben Figuren, dieselben Kontexte. Swemmel ist Etzels Spielmann, im ‚Nibelungenlied‘ wie in der ‚Klage‘.
Brünhild, die Ehefrau Gunthers muss vom Tod erfahren, auch die Mutter Kriemhilds, Ute, weiterhin Rüdegers Angehörige. Man denkt an die Verwandten in der Ferne, will die Botschaft zu ihnen bringen, die ja noch nicht wissen, was passiert ist. Der Bote muss die Ereignisse und Nachrichten vom Tod der vielen überbringen, in Worte fassen und er muss mit diesen Informationen die Reise antreten vom Hunnenland über Bechelaren, Passau nach Worms.
Der Text zeigt einen Denkprozess auf, er mahnt daran, dass die Familien der Angehörigen gar nichts von dem Untergangsgeschehen wissen. Ein Bote wird sie informieren. Und auch hier werden wir mit Reaktionen konfrontiert, die drastisch sind, die aufzeigen, was der Tod von nahen und geliebten Verwandten für die Angehörigen bedeutet.
Die Boten kommen nach Passau, wo der Bischof Pilgrim residiert (V. 3294–3299); die Könige aus Worms waren die Söhne seiner Schwester. Auf der Hinreise zu Etzel machten sie in Passau Station. Noch wusste der Bischof nicht, dass alle tot sind. Dann berichtet der Spielmann, der ein Augenzeuge des Geschehens im Hunnenland war. Der Bischof will weitere Informationen einholen, will recherchieren, er sendet eigene Leute zu Etzel, ins Hunnenland, um Informationen zusammenzutragen, er will alles aufschreiben lassen, wie es dazu kommen konnte (V. 3464f.). Bischof Pilgrim wird gegen Ende der ‚Nibelungenklage‘ als der Veranlasser der Aufzeichnung genannt. Es wäre schlimm, sagt der Text eigens, wenn diese Ereignisse nicht festgehalten würden. Denn ez ist diu groezeste geschiht, /diu zer werlde ie geschach (V. 3480f.). Der Untergang der Nibelungen und die Ereignisse, die dazu führten, werden als die größte Geschichte genannt, die je auf der Welt geschah. Sie muss festgehalten werden, sie muss Literatur werden.
Swemmel wiederum reist von Passau weiter nach Worms zu Brünhild. Brünhild war im gesamten zweiten Teil des ‚Nibelungenlieds‘ in Vergessenheit geraten. Die berühmte Königin vom Beginn des Liedes, hier wird sie noch einmal erwähnt. Swemmel berichtet dort die Geschichte, wir lesen also eine Nacherzählung und Deutung, die dem Spielmann in den Mund gelegt ist, er erzählt einmal in aller Kürze vor der Königin Brühnhild (V. 3626–3659), dann erzählt er ausführlich vor der Versammlung in Anwesenheit des jungen Königs davon (V. 3776–3947). Danach reist er wieder zurück zu Etzel und Dietrich.
Die ‚Klage‘ ist ein Vor-Augen-Führen des Leides, ein Versuch der Deutung, verschiedene Stimmen im Text werden gehört, durchaus verschiedene Deutungen formuliert. Die Erzählung des Leids schafft neues Leid, denn Trauer und auch Tod sind die Folge.[^20 Ute, die Mutter von Gunther, Gernot, Giselher und Kriemhild stirbt nach sieben Tagen, nachdem sie durch Swemmel von den Geschehnissen gehört hatte, vgl. ‚Klage‘, V. 3952–3959.] Ein Blick in die Zukunft wird geworfen, ein Berichten der Ereignisse an die Hinterbliebenen, ein Versuch des Weiterlebens gezeigt. Der Text schmiegt sich beinahe bruchlos an das ‚Nibelungenlied‘ an, wechselt nur den Modus, vom heldenepischen Ton hin zum höfischen Erzählen in Reimpaaren. Zeigt, dass dieses grausame Geschehen nicht einfach so enden kann. Dass in einem Neuanfang der Versuch einer Deutung liegt.
Das ist ein Textverbund von ‚Nibelungenklage‘ und vorausgehendem ‚Nibelungenlied‘, den wir nicht allzu häufig vorfinden in der Überlieferung mittelalterlicher Literatur. Ein Text ändert das Genre, wechselt den Ton, ist nun Reimpaartext (nicht mehr strophisches Lied) und verfolgt die Handlungsfäden, ent- oder belastet einige Figuren, erzählt weiter. Eine Textbewegung, die eine mittelalterliche Rezeption des ‚Nibelungenlieds‘ darstellt und zugleich aufzeigt, wie Memorierung funktionieren kann. Das ‚Nibelungenlied‘ wird um 1200 zum Text und sogleich Anlass zur Stellungnahme. Die ‚Klage‘ zeigt auf, wie mündliches Erzählen zum Text wird, wie Geschehnisse geklärt, formuliert, besichtigt und verschriftlicht werden müssen. Denn – das haben wir schließlich von Gottfried von Straßburg gelernt – wenn man nicht erinnert an ein Geschehen, dann ist es so gut wie nicht passiert. Diese Erinnerung an das Gute, aber auch an das Schreckliche, ist Aufgabe der Literatur:
Gedenket man ir ze guote niht,
von den der werlde guot geschiht,
sô wære ez allez alse niht,
swaz guotes in der werlde geschiht. (Haug / Scholz 2011, Bd. 1, S. 10f.)
Primärliteratur
- Gottfried von Straßburg, Tristan und Isold. Hg. von Walter Haug und Manfred Günter Scholz. Mit dem Text des Thomas, hg., übersetzt und kommentiert von Walter Haug, 2 Bde. (Bibliothek deutscher Klassiker 192; Bibliothek des Mittelalters 10.11), Berlin 2011.
- Das Nibelungenlied und die Klage. Nach der Handschrift 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mittelhochdeutscher Text, Übersetzung und Kommentar. Hg. von Joachim Heinzle, Berlin 2015 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 51) (= Heinzle 2015).
- Das Nibelungenlied nach der Handschrift n. Hs. 4257 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt. Hg. von Jürgen Vorderstemann, Tübingen 2000 (ATB 114).
- Die Nibelungenklage. Synoptische Ausgabe aller vier Fassungen. Hg. von Joachim Bumke, Berlin/New York 1999.
Sekundärliteratur
- Bleuler, Anna Kathrin und Primavesi, Oliver (Hgg.): Lachmanns Erben. Editionsmethoden in klassischer Philologie und germanistischer Mediävistik, Berlin 2022 (Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie 19).
- Curschmann, Michael: Dichter alter maere. Zur Prologstrophe des ‚Nibelungenliedes‘ im Spannungsfeld von mündlicher Erzähltradition und laikaler Schriftkultur, in: Gerhard Hahn / Hedda Ragotzky (Hgg.): Grundlagen des Verstehens mittelalterlicher Literatur. Literarische Texte und ihr historischer Erkenntniswert, Stuttgart 1992, S. 55–71.
- Fasbender, Christoph (Hg.): Nibelungenlied und Nibelungenklage. Neue Wege der Forschung, Darmstadt 2005.
- Heinzle, Joachim: Traditionelles Erzählen. Beiträge zum Verständnis von Nibelungensage und Nibelungenlied, Stuttgart 2014 (Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beihefte 20).
- Janota, Johannes: Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit (1280/90–1380/90), Tübingen 2004 (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit III/1).
- Müller, Jan-Dirk: Spielregeln für den Untergang. Die Welt des Nibelungenliedes, Tübingen 1998.
- Müller, Jan-Dirk: Das Nibelungenlied, 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 2015 (Klassiker-Lektüren 5).
- Schulze, Ursula: Das Nibelungenlied, Stuttgart 1997.
Beitrag 4
Hartmann von Aue: Dynamiken des Anfangs. Zum Texteingang des ‚Iwein‘
Versucht man sich dem Thema von Textdynamik(en) anhand von Hartmanns von Aue ‚Iwein‘ zu nähern, so ergeben sich gleich mehrere denkbare Themen für einen Vortrag,[^1 Der Beitrag ist eine geringfügig überarbeitete und um ausgewählte Literaturnachweiseergänzte Fassung meiner am 02.12.2021 im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft ‚Textdynamiken‘ (Universität Krakau / Universität Leipzig) gehaltenen Vorlesung.] denn Hartmanns kurz nach 1200 fertiggestellter höfischer Roman ist durch ganz unterschiedliche Dynamiken geprägt.
Als erstes sind sicherlich die Dynamiken der Übertragung zu nennen. Wie bereits sein erster Artusroman – der ‚Erec‘ (um 1180) – so ist auch der ‚Iwein‘ die Bearbeitung eines höfischen Romans von Chrétien de Troyes.[^2 Auf viele wesentliche Aspekte von Hartmanns von Aue ‚Iwein‘ konnte ich im Rahmen der Vorlesung nicht eingehen. Verwiesen sei an dieser Stelle daher auf die Einführungen zu Autor und Werk, die zuletzt erschienen sind: Kropik 2021, Lieb 2020. Darüber hinaus unbedingt empfehlenswert Cormeau / Störmer 2007.] Zu untersuchen und darzustellen wären also die poetischen Prinzipien, die bei der Bearbeitung Hartmanns gegenüber der französischen Vorlage wirksam werden. Die Dynamiken der Übertragung wären aber auch für die Rezeption von Hartmanns ‚Iwein‘ anzudenken. Dies könnte man für das Mittelalter ebenso perspektivieren wie für die Gegenwartsliteratur. So diente der ‚Iwein‘ etwa Felicitas Hoppe als Textgrundlage für ein modernes Erzählen im Kinder- und Jugendbuch: für ihren 2008 erschienenen ‚Iwein Löwenritter‘ (Hoppe 2008).
Anzudenken wäre aber auch die Dynamik von Text und Bild, bzw. Hartmanns ‚Iwein‘ im Kontext bildlicher Darstellungen. Hartmanns zweiter Artusroman muss äußerst bekannt gewesen sein und in den adligen Kreisen eine gewisse Popularität besessen haben. Davon zeugt einerseits die handschriftliche Überlieferung:[^3 Zur Überlieferung und Datierung der Handschriften und Fragmente vgl. die Angaben im Handschriftencensus und die zu den jeweiligen Überlieferungsträgern genannte weiterführende Literatur: https://handschriftencensus.de/werke/150 (letzter Zugriff: 10.11.2022).] Aus der Zeit des 13. bis 16. Jahrhunderts haben sich sechzehn Codices und siebzehn Handschriftenfragmente mit Hartmanns ‚Iwein‘ erhalten (vgl. Hammer 2021).[^4 Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf das online Portal ‚Iwein – digital‘ der UB Heidelberg: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/iwd/index.html (letzter Zugriff: 10.11.2022).] Zudem haben wir mehrere bildliche Darstellungen aus dem Mittelalter überliefert: So findet sich der ‚Iwein‘ etwa auf dem sog. Maltererteppich (frühes 14. Jahrhundert, Freiburg) oder auch als Bilderzyklus wie etwa in Schmalkalden (13. Jahrhundert) oder auf der Burg Rodenegg (13. Jahrhundert) (vgl. Schupp / Szklenar 1996; Rushing Jr. 1995).
Naheliegend wäre auch eine Reflexion über die Dynamik des Textendes, denn die mittelalterlichen ‚Iwein‘-Handschriften überliefern das Textende sowohl mit einem Kniefall Laudines vor Iwein als auch ohne jenen Kniefall (vgl. Hausmann 2000; Schröder 1999). Dies hat Auswirkungen auf die Interpretationen der Figuren ebenso wie auf das Ende des Romans. Damit würden wir uns einem wesentlichen Aspekt mittelalterlicher Dichtung und Überlieferung widmen: den prinzipiell unfesten Texten. Denn in der Regel überliefern zwei mittelalterliche deutschsprachige Handschriften nie einen gänzlich identischen Text (vgl. Baisch 2020; Bumke 1996).
Ich möchte mich heute auf die Dynamiken des Anfangs konzentrieren und das in zwei Richtungen perspektivieren: Zum einem, indem wir den Texteingang von Hartmanns ‚Iwein‘ einer genauen Lektüre unterziehen. Zum anderen aber auch im übertragenen Sinne: Denn selbst wenn es keine normative zeitgenössische Poetik des höfischen Romans gibt, finden wir im ‚Iwein‘ Hartmanns entscheidende implizite Reflexionen, die auf das Wesen der noch neuen Kunst des höfischen Romans abheben.
Ich möchte zunächst einen kurzen Überblick vermitteln und beginne daher zunächst (1) mit ausgewählten Informationen zum Inhalt und zur Faktur des Textes. Im zweiten Teil (2) steht dann der Texteingang des ‚Iwein‘ mit seinen erzählerischen Besonderheiten im Zentrum.
Inhalt und Faktur
Der ‚Iwein‘ ist Hartmanns von Aue zweiter Artusroman, der wahrscheinlich vor 1205 abgeschlossen wurde (vgl. Cormeau / Störmer 2007, S. 30–33). Zuvor hatte er bereits ‚Erec et Enide‘ des französischen Dichters Chrétien de Troyes ins Deutsche übertragen (vgl. zuletzt Masse 2020).
Beide Texte Chrétiens – sowohl ‚Erec et Enide‘ (um 1165) als auch ‚Yvain ou Le Chevalier au Lion‘ (ca. 1175) (vgl. Felber 2021, S. 19f.) – zeichnen sich durch eine signifikante Zweiteiligkeit der Handlung aus. Das ist in der Mediävistik schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrgenommen und diskutiert worden.[^5 Einen kurzen Überblick über die Forschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt: Kellermann 1936, S. 1–7.] Wichtige Grundlagen finden sich beispielsweise bereits bei Wilhelm Kellermann formuliert, wie der prinzipiell zweiteilige Aufbau der frühen Artusromane, in deren Mitte sich ein „entscheidende[r] Konflikt“ (Kellermann 1936, S. 12) findet oder die Bedeutung weiterer sich wiederholender Handlungselemente wie etwa der Zwischeneinkehr am Artushof (vgl. Kellermann 1936, S. 7–15). Darüber hinaus bemerkte Kellermann „in sämtlichen Artusromanen Chrestiens die Wirksamkeit eines überraschend gleichen Schemas“ (Kellermann 1936, S. 11).
Das gilt nun auch für die Übertragungen Hartmanns von Aue. Innerhalb des ‚Erec‘ erfuhren die in Hartmanns Vorlage angelegten strukturellen Konzepte eine Konkretisierung. Es war u. a. Hugo Kuhn, der Mitte des letzten Jahrhunderts ausführlich diese Leistung des deutschen Verfassers herausarbeitete (vgl. Kuhn 1959). Walter Haug griff später die bestehenden Ansätze auf und konkretisierte sie nochmals (Haug 1992, S. 91–107). Heraus kam ein sogenanntes Doppelwegmodell, das sowohl für den ‚Erec‘ als auch für den ‚Iwein‘ Gültigkeit besitze:[^6 Den strukturellen Aufbau des ‚Erec‘ bei Chrétien de Troyes betrachtete Walter Haug als „Handlungsmuster […], das für den Typus des arthurischen Romans konstitutiv werden sollte“. Haug 1992, S. 93.]
- Ausgangspunkt und Endpunkt der Handlung ist die arthurische Tafelrunde. Ihre Erscheinungsform ist die vröude, das Fest. Der Artusroman beginnt mit einem Fest und endet mit einem Fest.
- Die Handlung besteht im Auszug und avanture-Weg eines arthurischen Ritters. Dieser Weg führt ihn in eine Gegenwelt, d. h. in eine Welt antiarthurischer Figuren und Verhaltensformen. Der Held begegnet hier natürlichen oder übernatürlichen Feinden: Riesen, Zwergen, Bösewichten, Untieren, die er bezwingt, um wieder an den Hof zur Fest-vröude zurückzukehren bzw. sie wiederherzustellen.
- Der avanture-Weg ist gedoppelt. Die beiden Ausfahrten sind kontrastiv motiviert. Der erste Auszug wird durch eine Provokation der Tafelrunde von außen angestoßen. Die festliche Freude wird in Frage gestellt. Der Artusritter unternimmt es, sozusagen stellvertretend die Provokation zu bewältigen. Er kehrt aber nicht ohne persönlichen Gewinn zurück: er erwirbt sich auf diesem Weg eine Frau. Der zweite Auszug wird durch eine innere Krise verursacht, in der das Verhältnis zur Partnerin und zur Gesellschaft gleichzeitig problematisiert wird. Der zweite Auszug wiederholt den Weg durch die antiarthurische Gegenwelt unter veränderten Vorzeichen.
- Im Rahmen dieses Handlungsschemas wird eine doppelte Thematik ausgetragen. Zum einen geht es um die ritterliche Tat, d. h. um die Frage der Möglichkeit der Bewältigung der Welt durch die Tat. Dabei übt der Artusritter Gewalt, und er begegnet der Gewalt, er sieht sich dem Tod gegenüber. Das zweite Thema ist die Liebe. Der Held erfährt den Eros als Begierde und als absoluten Anspruch an das Du. (Haug 1992, S. 98f.)
Grundsätzlich ist viel Richtiges an diesen Beobachtungen. Zugleich muss man aber auch konstatieren, dass dieses Schema in der mittelhochdeutschen Artusepik eigentlich nur auf den ‚Erec‘ Hartmanns von Aue und dann bereits mit Einschränkungen (s. u.) auf den ‚Iwein‘ zutrifft. Das Doppelwegmodell von Walter Haug hat daher konzise Kritik erfahren. Diese Kritik betrifft im besonderen Maße die postulierte Verknüpfung von Struktur und Bedeutung (vgl. zuletzt Kropik 2021).
Schauen wir zunächst auf den Inhalt von Hartmanns zweitem Artusroman, bevor wir nochmals auf die Struktur des Textes zurückkommen:
Mit einem Pfingstfest am Artushof setzt die Handlung des ‚Iwein‘ ein. Während sich Königin und König kurzzeitig zurückziehen, erzählen sich Ritter in einem Saal der Burg einander von ihren Taten. Kalogreant berichtet dabei von einem wenig rühmlichen Abenteuer: Er hatte durch das Begießen eines besonderen Steins im Wald den Hüter der Quelle zu einem Kampf herausgefordert. Er unterlag aber im Kampf und musste sowohl seine Rüstung als auch sein Pferd zurücklassen.
Iwein, ein Verwandter Kalogreants, der unter den Zuhörern sitzt, beschließt, die dem Artushof (und seiner Familie) zugefügte Schmach zu rächen. Als König Artus später durch die Königin davon erfährt, will auch er zur Quelle reiten. Doch Iwein kommt ihm zuvor. Allein bricht er nachts auf und gelangt schließlich zum Stein, begießt ihn mit Wasser, löst damit das sonderbare Unwetter aus und sieht sich dem Hüter der Quelle gegenüber. Es kommt zum Kampf, in dessen Verlauf Askalon – der Quellenhüter – tödlich verletzt die Flucht ergreift. Iwein verfolgt ihn. Während der Quellenhüter durch beide Tore der Burg hindurchreiten kann, wird Iweins Pferd vom herabfallenden Tor halbiert. Iwein selbst ist zwischen den Toren gefangen. Da erscheint Lunete, eine junge Dame des Hofes. Sie erkennt in Iwein jenen Ritter des Artushofes, der sich vor einigen Jahren ihr gegenüber äußerst höflich verhalten hatte. Zum Dank gibt sie ihm nun einen Ring, der seinen Träger unsichtbar macht. Damit entgeht Iwein der Suche und Rache der Burgleute, die die Tötung Askalons rächen wollen.
Von einem Fenster aus (in einem versteckten Raum der Burg) betrachtet Iwein die trauernde Herrscherin des Landes: Laudine. Augenblicklich verliebt er sich in sie. Obwohl es aussichtslos erscheint, berichtet er Lunete davon. Taktisch klug gelingt es ihr, die Landesherrin zu überzeugen, dass das Land wieder einen neuen Quellenhüter brauche. Durch ihre geschickte Rede arrangiert Lunete nicht nur eine Begegnung zwischen Iwein und Laudine, sondern sie bewegt Laudine auch dazu, dem Fremden ihre Hand und die Herrschaft über ihr Land anzubieten. Iwein und Laudine heiraten.
In der Zwischenzeit ist auch König Artus zur Quelle aufgebrochen. Dort wird der Sturm ausgelöst und Keie kämpft daraufhin gegen den neuen Quellenhüter – und wird von diesem besiegt. Iwein gibt sich nach seinem Sieg zu erkennen. Es folgt die Einkehr des Artushofes auf die Burg Laudines und Iweins.
Bevor die Artusritter wieder aufbrechen, kommt es zu einem Gespräch zwischen Iwein und Gawein. Letzterer erinnert Iwein daran, dass er sich nicht wie Erec ‚verliegen‘ solle. Vielmehr müsse (durch ritterliche Bewährung) höfisches Ansehen stets neu errungen werden. Schließlich erhält Iwein von Laudine die Erlaubnis, das neue Herrschaftsgebiet zu verlassen – unter der Bedingung, dass er binnen eines Jahres von seinen Rittertaten an den Hof zurückkehren solle. Laudine gibt Iwein einen Ring, der die Vereinbarung besiegelt.
Ich unterbreche den Handlungsüberblick hier, da es mir wichtig erscheint, zumindest kurz auf die Ausgestaltung der Gelenkstelle zwischen dem ersten und dem zweiten Handlungsteil einzugehen. Bemerkenswert an der narrativen Inszenierung ist, dass durch eine intradiegetische Figur des Textes – Gawein – auf den ‚Erec‘-Roman über das Signalwort des zentralen Problems (verligen, V. 2790) referenziert wird. Damit lässt Hartmann eine literarische Figur in direkter Rede einen intertextuellen Verweis auf seinen ersten Artusroman (vgl. Wandhoff 2021, S. 182–184) geben.[^7 Zur Stelle auch: Kern 2002, S. 409: „So können wir getrost sagen, Gawein erzählt Iwein den ‚Erec‘.“] Doch Hartmann treibt das Spiel noch weiter, indem er anlässlich der Trennung von Laudine und Iwein eine Metalepse inseriert, eine ‚Störung‘ der etablierten narrativen Ordnung (vgl. Greulich 2018, S. 192–200). Ganz unvermittelt erscheint nun auf einmal Frau Minne und interveniert – womit zugleich eine weitere Erzählebene im Text kurzzeitig eröffnet wird. Die höfische Liebe, die Minne, ist ein zentrales Thema in diesem Roman. In dieser Textpassage nimmt sie nun Gestalt an und erscheint als (äußerst lebendige) Personifikation.[^8 Vgl. der Passagen zu Chrétiens ‚Yvain‘ bieten u. a.: Bauschke 2005, Laude 2009.] Durch Frau Minne wird ein Hartmann angesprochen. Aber: Wer ist mit diesem Hartmann gemeint? In welcher Gestalt ist dieser Hartmann konzeptualisiert? Corinna Laude hat den sehr überzeugenden Vorschlag eingebracht, dass nicht nur Frau Minne, sondern auch jener Hartmann als Personifikation zu verstehen ist: Im Erzähler-Hartmann dieser Metalepse sieht sie eine Personifikation „der ‚Stimme‘, die diese Kategorie bereits in all ihrer prekären Fragilität – eingeklemmt zwischen Autor und Figuren, textexterner und textinterner Sphäre und sogar zwischen histoire und discours – buchstäblich vor Augen führt“ (Laude 2009, S. 83). Es ist dies zugleich eine äußerst geschickte Weise des Verfassers seinen Namen in seinen Text einzuschreiben. Wir sprechen in diesen Fällen auch von Autorsignatur, „also dem (wörtlichen) Einschreiben des Verfassernamens“ (Greulich 2021, S. 200) in den literarischen Text.
Wie auch immer man versucht, diese Szene konzeptionell zu fassen: Eindeutig haben wir eine Metalepse – einen Verstoß gegen eine konventionelle Erzählordnung und auch die konventionellen Erzählebenen – vorliegen. Als wäre die Konstruktion nicht schon schwindelerregend genug, treibt Hartmann das Spiel noch weiter, denn Thema der Diskussion ist nichts weniger als die Wahrheit des Erzählten und des Erzählens.
Worum geht es? Der Erzähler berichtet von der Trennung von Laudine und Iwein anlässlich des Aufbruchs mit Gawein zu weiteren ritterlichen Taten. Frau Minne insistiert jedoch darauf, dass die Liebenden sich nicht völlig trennten, sondern sie ihre Herzen tauschten und dadurch auch in der Trennung beieinander blieben. Diese Bildlichkeit verwirrt nun den Erzähler, denn eine Frau mit dem Herz eines Mannes müsse nach seinem Verständnis doch Lust verspüren zu turnieren (V. 3005). Ein Mann mit einem Frauenherz hingegen müsse verzagen, könnte kein guter Ritter mehr sein. Diese Argumentation ist zu viel für Frau Minne: sî sprach: ‚tuo zuo den munt: / dir ist diu beste vuore unkunt, / dichn geruorte nie mîn meisterschaft (V. 3013–15) [Sie sagte: Halt den Mund! / Du kennst das Beste nicht, / meine Macht hat Dich nie berührt.].[^9 Text und Übersetzung in diesem Beitrag zitiert nach: Mertens 2008.] Frau Minnes Reaktion ist äußerst hart: Sie verbietet das Wort. Ihr Gegenüber aber bleibt verwirrt: Einerseits muss der Erzähler konstatieren, dass er noch nie Männer oder Frauen ohne Herzen hat leben sehen. Andererseits muss er auch zugeben, dass sich Iweins Charakter durch den Herzentausch nicht veränderte.
Diese außergewöhnliche Diskussion behandelt einen zentralen Aspekt mittelalterlicher Literatur: Es geht wörtlich um die wârheit (V. 2979) (vgl. Raumann 2010, S. 94–99; vgl. Laude 2009, S. 79). Und gleichzeitig stellt sich aber die Frage: Kann man innerhalb eines höfischen Romans überhaupt über dessen Wahrheit diskutieren?
Und: Wer hat Recht? Wer spricht die Wahrheit? Folgt man dem Erzähler in seiner Argumentation, so muss man ihm Recht zusprechen: Kein Mensch kann ohne Herz leben. Aber die Protagonisten des Romans können sehr wohl ihre Herzen tauschen. Es geht somit nicht um die lebensweltliche Realität, sondern um die Möglichkeiten der Sprache und damit zugleich um die Möglichkeiten von durch Sprache erschaffenen Welten – die Literatur.
Zurück zur Handlung und zum zweiten Handlungsteil: Iwein bewährt sich als Ritter und vergisst dabei sein Versprechen gegenüber Laudine. Schließlich erscheint Lunete und verlangt den Ring ihrer Herrin zurück: Iwein hat die Huld Laudines verloren, da er seine triuwe gegenüber Land und Herrin nicht erfüllt habe. Im Begreifen seiner Schuld läuft Iwein in den Wald und fällt in einen wahnsinnsähnlichen Zustand.
Im Wald lebt Iwein bar seines Verstandes und seiner Standesinsignien. Ein Einsiedler versorgt ihn mit Nahrung. Eines Tages finden drei Damen den schlafenden Iwein. Sie erkennen seine Identität an einer Narbe und behandeln ihn mit einer Salbe der Fee Morgane, wodurch der Wahnsinn Iwein verlässt. Die Damen nehmen Iwein auf und pflegen ihn auf der Burg Narison, wo er durch die Gräfin auch ritterliche Kleidung und Waffen und somit auch seine soziale Identität zurückerhält. Kurze Zeit später kämpft er für sie gegen den Grafen Aliers. Iwein siegt, schlägt aber die ihm angebotene Herrschaft über das Land aus – und begibt sich auf seinen Weg. Unterwegs erblickt er einen Drachen und einen Löwen, die miteinander kämpfen. Iwein tötet den Drachen und errettet so den Löwen, der von nun an sein treuer Begleiter sein wird.
Als Iwein das Land Laudines wieder betritt, fällt er zunächst in Ohnmacht, da er sich seines Fehlverhaltens erinnert. An der Quelle findet Iwein Lunete, die dort in einer Kapelle gefangen gehalten wird. Sie wird des Treuebruchs beschuldigt, da auf ihre Initiative die Ehe zwischen Laudine und Iwein zustande kam. Ein Gerichtskampf soll ihre Unschuld klären. Iwein verspricht für Lunete zu kämpfen.
Iwein reitet weiter und erreicht eine Burg, die vom Riesen Harpin bedroht wird. Viel Leid hat jener dem Land und den Burgleuten zugefügt. Iwein sichert auch dem Burgherrn seine Unterstützung für den nächsten Tag zu. Der Riese Harpin erscheint jedoch verspätet. Mit Hilfe des Löwen gelingt Iwein ein Sieg und gerade noch rechtzeitig kann er für Lunete kämpfen – und siegt erneut mit Hilfe des Löwen. Lunete ist von jeder Schuld befreit. Laudine erfährt den Namen des Siegers jedoch nicht, denn Lunete darf dessen Identität nicht verraten. Iwein zieht weiter und wird von Lunete ein Stück des Weges begleitet.
Als nächstes wird Iwein in einem Erbschaftsstreit zweier Töchter um Hilfe gebeten. Während die Ältere Gawein als Kämpfer verpflichten kann, sendet die Jüngere eine Botin aus, den Löwenritter zu finden. Lunete weist ihr den Weg und so trifft sie schließlich Iwein. Zusammen reiten sie und kehren auf der Burg zum Schlimmen Abenteuer ein. Erneut muss sich Iwein gegen zwei Riesen, und dieses Mal auch gegenüber der Schönheit der Tochter des Burgherrn, bewähren. Schließlich befreit er mit seinem Sieg dreihundert Jungfrauen sowie den Burgherrn von den Riesen.
Nur knapp erreicht er den festgesetzten Termin zum Erbschaftskampf am Artushof. Sein Gegner ist Gawein, der ebenfalls unter anderem Wappen kämpft. Bis in die Nacht hinein kämpfen sie gegeneinander. Keinem ist es möglich, den anderen zu besiegen. In einer Kampfpause nennt zuerst Gawein seinen Namen – dann Iwein. Jeder spricht dem anderen den Sieg zu. Der Erbschaftsstreit der Schwarzdorntöchter wird analog entschieden: Das Erbe soll geteilt werden.
Am Artushof werden Iweins Wunden gepflegt. Nur eine bleibt offen – die Trauer ob der Entzweiung mit Laudine. Er reitet in ihr Land und wiederholt den Quellenguss. Das Reich Laudines besitzt nun keinen Verteidiger mehr und Lunete rät Laudine zum Löwenritter, der für sie erfolgreich im Gerichtskampf angetreten war. Laudine soll einen Eid schwören, ihm dabei zu helfen, die Gunst seiner Dame wiederzuerlangen. Daraufhin führt Lunete Iwein vor Laudine und verlangt, dass sie ihren Eid einlöst. Iwein bekennt seine Schuld und verspricht nie mehr das Treueverhältnis zu verletzen. Das Paar kommt wieder zusammen.
Gut erkennbar sind selbst in dieser äußerst verkürzten Inhaltswiedergabe einzelne Aspekte des sogenannten Doppelwegs. Es ist dies aber nicht das einzige Erzählschema, dass für den ‚Iwein‘ Relevanz besitzt. Bemerkenswert ist nämlich zugleich die Nähe der weiblichen Figuren (Laudine und Lunete) und des Quellenreichs zu Traditionen des Erzählens über Feen(reiche) (vgl. Simon 1990, S. 47–64; Mertens 2006, S. 194–198, S. 204f.). Im Namen Lunete ist so beispielsweise noch die Verbindung von Mond und Quelle zu erahnen (vgl. Meyer 2004, S. 242, Anm. 237). Verbunden damit ist ein Erzählschema, das ebenfalls die Handlung des ‚Iwein‘ maßgeblich prägt: das der sog. ‚gestörten Mahrtenehe‘ (vgl. Schulz 2015, S. 214–231; Simon 1990, S. 35–40). Es hat die Liebe zwischen einem Menschen und einer Fee zum Inhalt. Die erste Begegnung ergibt sich dabei zumeist nicht durch die Initiative des männlichen Protagonisten, sondern durch die der Fee. So kann sie den Menschen z. B. in ihr Reich locken. Später verleiht sie dem männlichen Protagonisten in der Regel Macht und Wohlstand. Die Verbindung zwischen Fee und Mensch ist mit einem Tabu verknüpft, das vom Menschen gebrochen wird. Daraufhin verliert der Mensch die Liebe der Fee.[^10 Zur besseren Verständlichkeit habe ich hier sehr stark vereinfacht. Ausführlich ist das Syntagma dargestellt bei Schulz 2015, S. 219–231.]
Besonders deutlich wird die Überlagerung von Mahrteneheschema und arthurischem Doppelweg in der Fügung von Werbung und Heirat von Iwein und Laudine. Denn es ist keineswegs der Ritter, der sich „eine Frau erwirbt“ (Haug 1992, S. 99), sondern Laudine, die „den mittellosen Ritter Iwein“ (Mertens 2006, S. 196) erwählt. Die herausgehobene Position der Königin Laudine gegenüber dem arthurischen Ritter wird deutlich vor Augen geführt. Sie stellt zugleich den Text in der Erzähltradition des Mahrteneheschemas, in der es ebenfalls der Fee zukommt, sich den Partner zu wählen.
Durch die Ehe mit Laudine erhält Iwein nun ein Herrschaftsgebiet und damit Macht und Ansehen. Die von Laudine gesetzte Frist für die Wiederkehr ihres Gatten ist unter der Perspektivierung auf das Schema der ‚gestörten Mahrtenehe‘ als Tabu lesbar, das dann (schemagerecht) vom männlichen Protagonisten gebrochen wird.
Es finden sich im ‚Iwein‘ folglich zwei Erzählmuster miteinander kombiniert. Durch ihre zeitweise Überlagerung entstehen Brüche im Sinngefüge des Romans, die unterschiedliche Positionen der Wertung erlauben. Wenngleich der Roman in ein (verhaltenes) happy ending mündet, so ist der Weg des Protagonisten auch ein Weg der Rezipient:innen durch den Text, in dessen Verlauf sie sich fragen müssen, wie sie sich bezüglich der Handlung und der potentiellen Sinnangebote positionieren möchten. Die unterschiedlichen Erzählmuster tragen hierzu wesentlich bei, da durch ihre transtextuellen Bezüge bestimmte Erwartungen hinsichtlich der Handlungsführung geweckt werden.
Die Übermächtigkeit der Symbolstruktur des Doppelwegs und der mit ihr verknüpften Interpretationen der Romane Hartmanns von Aue erscheint folglich nicht unproblematisch; das von Walter Haug vorgeschlagene Muster nur eingeschränkt gültig. 1999 erschien ein Beitrag von Elisabeth Schmid, dessen provokante These sie bereits im Titel artikuliert: „Weg mit dem Doppelweg“ (Schmid 1999. S. 69). Die Dominanz der strukturell-inhaltlichen Interpretation arthurischer Romane – die in der germanistischen Forschung weit größer ist, als beispielsweise in der romanistischen – verstelle, so das Fazit ihrer Überlegungen, die Sicht auf wesentliche in den Texten angelegte Horizonte der Dichtungen:
Nach dem Primat, den das Strukturmodell des Doppelwegs jahrelang genossen hat, möchte ich als therapeutische Maßnahme eine dekonstruierende Lektüre von Hartmanns beiden Artusromanen empfehlen. Nach einer derart langen Karenz verspricht die Arbeit am Text mit frischen Augen überraschende Einsichten […]. (Schmid 1999, S. 85)
Allerdings: Bereits die erkennbare Überlagerung von zwei Erzählschemata verweist – bei Chrétien und auch bei Hartmann – auf die künstlerische Faktur der Texte.[^11 Das betont auch Elisabeth Schmid, denn auch sie gesteht Chrétiens Romanen „viel Form und Gliederungswille[n]“ (Schmid 1999, S. 76) zu.] Kann man dies als eher implizites Verfahren bezeichnen, so macht die exzeptionelle Diskussion von Frau Minne mit Hartmann an einem neuralgischen Handlungspunkt im Roman diese Markierung der Artifizialität explizit.
Auch am Texteingang lassen sich besondere narrative Verfahren erkennen. Wir wollen daher nun den Blick auf den Beginn des Romans lenken und eine „dekonstruierende Lektüre“ (Schmid 1999, S. 85) des Texteingangs versuchen.
Dynamiken des Texteingangs
Der Texteingang des ‚Iwein‘ wurde von Hartmann in ganz besonderer Weise gestaltet.[^12 Ich habe den Texteingang ausführlich andernorts analysiert: vgl. Greulich 2018, S. 176–192. Für die Vorlesung habe ich die Komplexität stark reduziert.] Das beginnt bereits mit dem Prolog. Lassen sich mittelalterliche Prologe in der Regel recht gut gliedern und folgen sie bestimmten Mustern (vgl. Brinkmann 1964), so ist dies im ‚Iwein‘ gerade nicht gegeben: „Die übliche Reihenfolge von Prologus praeter rem (allgemeine Einführung) und Prologus ante rem (thematische Einführung) ist vertauscht“ (Mertens 2008, S. 975). Gleichwohl mutet der Beginn zunächst recht konventionell an:
Swer an rehte güete
wendet sîn gemüete,
dem volget sælde unde êre.
des gît gewisse lêre
künec Artûs der guote,
der mit rîters muote
nâch lobe kunde strîten.
er hât bî sînen zîten
gelebt alsô schône
daz er der êren krône
dô truoc unde noch sîn nam treit.
des habent die wârheit
sîne lantliute:
sî jehent er lebe noch hiute:
er hât den lop erworben,
ist im der lîp erstorben,
sô lebt doch iemer sîn name.
er ist lasterlîcher schame
iemer vil gar erwert,
der noch nâch sinem site vert.
(V. 1–20)‚Wer auf das Gute
sein Bemühen richtet,
dem wird Glück und Ansehen zuteil.
Ein verläßliches Beispiel dafür gibt
König Artus, der Gute,
der mit ritterlichem Geist
nach Ruhm zu streben wußte.
Er hat zu seiner Zeit
so vorbildlich gelebt,
daß er einst die Krone der Ehren
trug und sein Name sie immer noch trägt.
Deshalb haben
seine Landsleute recht:
sie sagen, er lebe heute noch.
Da er diesen Ruhm erworben hat,
bleibt, über den Tod des Leibes hinaus,
sein Name für immer lebendig.
Der muß sich nie
und nimmer einer Schande schämen,
er heute seiner Lebensregel folgt.‘
Der Prolog setzt mit einer Sentenz ein, in der betont wird, dass derjenige, der sein Denken und Handeln auf das wahrhaft Gute ausrichtet, dadurch belohnt wird, dass ihm Ansehen und Glück folgen. König Artus wird als derjenige benannt, der exemplarisch für den Erfolg dieser richtigen Lebensweise steht (vgl. Mertens 1977, S. 351f.). Denn auch wenn er verstorben sei, so ist das Andenken an ihn bei seinen Landsleuten immer noch sehr lebendig: sein Name lebe noch immer.[^13 Man kann die Nennung von König Artus zugleich als ein „Gattungssignal“ (Mertens 1977, S. 352) interpretieren.] Im Anschluss erfolgt dann eine Wendung zur Gegenwart: Wer auch heute noch sein Leben an den Werten der damaligen Zeit ausrichte, sei immer vor Schande bewahrt. Damit haben wir bereits hier eine Verknüpfung von Erzählen über König Artus (der Landsleute) und der Bedeutung für die Jetztzeit (vgl. Schirok 1999, S. 189) vorliegen.
Die ersten Verse des ‚Iwein‘ versammeln so vornehmlich Informationen, die sich eher als Hinführung zur Handlung (prologus ante rem) ausnehmen. Erst danach erfolgt die Vorstellung des Dichters:
Ein rîter, der gelêrt was
unde ez an den buochen las,
swenner sîne stunde
niht baz bewenden kunde:
daz er ouch tihtens pflac.
daz man gerne hœren mac,
dâ kêrt er sînen vlîz an.
er was genant Hartman
unde was ein Ouwære,
der tihte diz mære.
(V. 21–30)‚Wenn ein Ritter, der gelehrte Bildung besaß
und Bücher las,
seine Zeit
nicht besser zu verwenden wußte,
dann betrieb er das Dichten;
er verwandte Mühe auf etwas,
was zu hören Freude macht.
Hartmann hieß er
und war von Aue,
er verfaßte diese Erzählung.‘
Die Nennung des Autors erfolgt in Vers 28: er was genant Hartman (vgl. Greulich 2018, S. 178). Im Folgenden erfahren die Rezipient:innen über ihn, dass er sowohl Anteil an der ritterlichen, als auch an der klerikalen Sphäre besaß: Denn der genannte Ritter verfügte über die Fähigkeit zu lesen und selbst zu dichten. Hierfür bedarf es einer guten Bildung, die um 1200 lateinbasiert ist und in den Händen des Klerus liegt (vgl. Griese / Henkel 2015). Jener Hartmann – so die Erzählinstanz – dichtete jene Geschichte (mære, V. 30), die nun folgt.
Im unmittelbaren Anschluss setzt dann die Handlung mit der Beschreibung des Pfingstfestes am Artushof ein.
Ez het der künec Artûs
ze Karidôl in sîn hûs
zeinen pfingesten geleit
nâch rîcher gewonheit
eine alsô schœne hôchzît
daz er dâ vor noch sît
deheine schœner nie gewan.
deiswâr dâ was ein bœser man
in vil swachem werde,
wande sich gesamenten ûf der erde
bî niemens zîten anderswâ
sô manec guot rîter als dâ.
ouch wart in dâ ze lône gegeben
in allen wîs ein wunsch leben:
in liebet den hof unde den lîp
manec magt unde wîp,
die schœnsten von den rîchen.
(V. 31–47)‚Es hatte König Artus
in seiner Burg zu Karidôl
einmal zu Pfingsten
in gewohnter Fracht
ein so schönes Hoffest angesetzt,
daß er weder früher noch später
je ein glänzenderes gab.
Wirklich, einen niederen Menschen
duldete man da nicht,
denn nie waren auf Erden
sonst irgendwo
so viele edle Ritter zusammengekommen wie dort.
Da hatten sie auch zum Lohn
in jeder Weise ein wunderschönes Leben:
viele Mädchen und Frauen,
die schönsten aus den besten Familien,
machten ihnen den Aufenthalt am Hoftag angenehm.‘
Doch jene Beschreibung wird nur wenige Verse später plötzlich unterbrochen.
mich jâmert wærlîchen,
unde hulfez iht, ich woldez clagen,
daz nû bî unsern tagen
selch vreude niemer werden mac,
der man ze den zîten pflac.
doch müezen wir ouch nû genesen.
ichn wolde dô niht sîn gewesen,
daz ich nû niht enwære,
dâ uns noch mit ir mære
sô rehte wol wesen sol:
dâ tâten in diu werc vil wol.
(V. 48–58)Es macht mich wirklich traurig –
und hätte es Erfolg, würde ich es beklagen –
daß es nun in unserer Zeit
solche Freude nie mehr geben kann,
wie man sie damals hatte.
Jedoch sollen wir auch heute Freude finden:
ich hätte damals nicht leben mögen,
wenn ich dafür jetzt nicht lebte,
wo es uns mit ihren Geschichten
so richtig gutgehen soll –
damals ging es ihnen mit den Taten gut.
Damit ‚verstößt‘ nun der Text des ‚Iwein‘ signifikant gegen ein wohlgeordnetes Erzählen, denn mit jenen in die Festbeschreibung eingelassenen Versen, kommt es zu einem abrupten Wechsel der Erzählebenen: die Ebene der histoire wird verlassen und die discours-Ebene in besonderem Maße betont. Hartmanns Erzähler „lenkt damit den Blick nicht allein auf das berichtete Geschehen, sondern auch auf den Akt des Berichtens selbst“ (Bauschke 2005, S. 76). Unvermittelt und gleich zu Beginn der Handlung also eine Erzähler-digressio. Sie dient aber nicht dazu, die Handlung zu kommentieren oder durch einen Exkurs zur Entfaltung der diegetischen Welt beizutragen. Stattdessen widmet sie sich der Reflexion über die Fragen, welche Zeit (die Lebenszeit von König Artus oder die der zeitgenössischen Gegenwart) und welcher Modus (ritterliche Taten oder das Erzählen über sie) vorzuziehen sei. Die Erzählinstanz entscheidet sich eindeutig für die mittelalterliche Gegenwart und für das Erzählen über Artus, seine Ritter und deren Heldentaten.
Gleichzeitig stellt sich ob der Bauart des Erzähleingangs die Frage:
Wo endet eigentlich der Prolog von Hartmanns ‚Iwein‘?
Diese Frage – und es wird nach den bisherigen Ausführungen kaum verwundern – kann unterschiedlich beantwortet werden:
- Man kann den Prolog mit dem Beginn der Festbeschreibung am Artushof enden lassen. Dann wäre das Ende des Prologs mit Vers 30 anzusetzen.
- Nun ist die Reflexion der Erzählinstanz inmitten der Festbeschreibung aber so gestaltet, dass sie sich eigentlich auch sehr gut in einem Prolog ausnehmen würde. Allerdings lobt man in den Prologen zumeist die vergangene Zeit – laudatio tempori acti heißt der terminus technicus für dieses Verfahren. Doch Hartmann lässt seinen Erzähler innerhalb der Digressio keineswegs ausschließlich die vergangene Zeit loben, sondern stellt ausgerechnet die Vorteile der zeitgenössisch-mittelalterlichen Erzählgegenwart heraus. Wenngleich den Artusrittern seinerzeit die Taten viel Gutes einbrachten, so wolle die Erzählinstanz doch damals nicht gelebt haben – denn ansonsten könne sie nun nicht davon erzählen (vgl. Bauschke 2005, S. 78; Müller 2005, S. 420–422). Das kann als Variation eines etablierten Topos gelesen werden und ist zugleich eine eigenwillige Betonung der Erzählgegenwart im mittelalterlichen Hier und Jetzt der Rezeption (vgl. Haug 1992, S. 125). Betont wird auf diese Weise zugleich das Erzählen selbst, das „programmatisch zum Wert an sich erhoben“ (Bauschke 2005, S. 76) wird. Man könnte also auch Vers 58 als Ende des Prologs bestimmen.
- Die Besonderheiten des Erzählverfahrens am Beginn des ‚Iwein‘ sind damit aber nicht beendet, denn nach nur 243 Versen beginnt eine intradiegetische Figur – Kalogreant – von seinen Taten zu berichten. Er übernimmt für die folgenden 559 Verse (V. 243–802) die Funktion der Erzählinstanz. Das sind mehr als doppelt so viele Verse wie vom Prolog bis zum Beginn von Kalogreants Erzählung. Damit wird, kurz nach dem Beginn der Handlung im ‚Iwein‘, das Prinzip eines erklärenden und kommentierenden primären Erzählers aufgegeben (vgl. Greulich 2018, S. 181f.). Die Rezipienten sind der Erzählung des Kalogreant ebenso ausgeliefert, wie sein intradiegetisches Publikum auf dem Pfingstfest am Artushof (vgl. Wenzel 2001).
Was hat das nun mit der Frage nach dem Prolog zu tun? Nun, der Beginn von Kalogreants Erzählung ist in besonderer Weise gestaltet:
‚Swaz ir gebiet, daz ist getân.
sît ir michs niht welt erlân,
sô vernemt mit guotem site,
unde miet mich dâ mite:
ich sag iu deste gerner vil,
ob manz ze rehte merken wil.
man verliuset michel sagen,
man enwellez merken unde dagen.
maniger biut die ôren dar:
ern nemes ouch mit dem herzen war,
sô ne wirt im niuwan der dôz,
unde ist der schade al ze grôz:
wan sî verliesent beide ir arbeit,
der dâ hœret unde der dâ seit.
ir mugt mir deste gerner dagen:
wan ichn wil iu deheine lüge sagen.
Ez geschach mir, dâ von ist ez wâr,
(es sint nû wol zehn jâr) …
(V. 243–260)‚„Was Ihr gebietet, wird getan.
Da Ihr es mir nicht erlassen wollt,
hört es mit Wohlwollen an
und belohnt mich eben damit:
ich erzähle es Euch um so lieber,
wenn Ihr gut aufpaßt.
Viele Geschichten erzählt man nur,
wenn die Leute zuhören und still sind.
Mancher leiht wohl seine Ohren,
aber wenn er es nicht mit dem Herzen aufnimmt,
bleibt ihm nur der leere Klang,
und der Schaden ist übermäßig,
denn beider Mühe ist vergeudet —
die des Zuhörers und die des Erzählers.
Ihr habt den besten Grund zu schweigen,
denn ich werde Euch keine Lügen erzählen.
So ist es wahr: mir stieß das zu —
es sind jetzt gut zehn Jahre her …‘
Hervorgehoben sind im Zitat Sätze und Wortgruppen, die sich im Kontext eines intradiegetischen spontanen Vortrags durchaus merkwürdig ausnehmen, denn es „sind die bekannten Prologtopoi – Erzählen auf Befehl, Bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit, Hinweis auf das rechte Verständnis, Wahrheitsbeteuerungen“ (Kartschoke 2002, S. 29). Es sind alles Formulierungen, die ebenso gut auch im Prolog des Romans zu finden sein könnten.
Aus dieser Perspektive betrachtet, lässt sich das Ende des ‚Iwein‘-Prologs nur schwerlich bestimmen. Es obliegt letztlich den Rezipient:innen dies zu entscheiden. Wichtiger als das formale Ende sind aber die Effekte, die durch dieses Erzählverfahren erreicht werden. Sie führen zur Frage:
An wen richten sich eigentlich die Worte Kalogreants (V. 243–263)? Wie ist die Kommunikationssituation des Textes gestaltet?
Man muss sich vergegenwärtigen, dass es bei einem Vortrag aus oder mit der Handschrift für die Rezipient:innen immer die gleiche Stimme ist (die Stimme der:des Vortragenden), die sie sowohl über jenen Hartmann im Prolog unterrichtet, als auch vom Pfingstfest berichtet und die schließlich auch die Worte Kalogreants ausspricht. Damit richten sich die Worte Kalogreants nicht nur an die Ritter im Saal der Artusburg, sondern ebenso an die gegenwärtigen Rezipient:innen des Textes. Wenn Kalogreants Worte das intradiegetische Publikum am Artushof ebenso betreffen wie sie auf die mittelalterlichen Rezipient:innen abzielen, dann geht damit ein weiterer Effekt einher. Denn bei Hartmann (wie zuvor bei Chrétien) ist Kalogreants „Erzählung im nicht-zeremoniellen Teil des höfischen Festes situiert“, also genau dort, „wo auch ein Dichterauftritt stattgefunden haben könnte“ (Mertens 1998, S. 65). Mit der Parallelisierung der Vortragssituationen werden zugleich die etablierten Grenzen literarischer Kommunikation desavouiert: Wenn sich Kalogreants Worte an die Ritter am Artushof und ebenso an das adlige Publikum Hartmanns richten, dann erwächst daraus ein besonderer Effekt. Matthias Däumer hat diesen Effekt als „Raumverschaltung“ (vgl. Däumer 2013, S. 329–333) bezeichnet – der Vortragsort von Hartmanns ‚Iwein‘ wandelte sich dann im Moment von Kalogreants Rede (virtuell) zum Artushof.
Wozu nun elliu disiu mære (V. 892)?
Ein wiederkehrendes Wort am Beginn von Hartmanns ‚Iwein‘ ist das mære. Das Wort besitzt ein weites Bedeutungsspektrum. Es kann „kunde, nachricht, bericht, erzälung, gerücht“ bedeuten; oder aber auch den „gegenstand der erzählung, geschichte, sache, ding“ bezeichnen (Lexer, Bd. I, Sp. 2046). Das Nomen mære kann man einerseits als „das Zielwort des Prologs“ (Wolf 1991, S. 221) bezeichnen. Andererseits begegnet es äußerst variantenreich:[^14 Vgl. Iwein V. 30, V. 56, V. 93, V. 185, V. 227, V. 239, V. 482, V. 550, V. 796, V. 892. Zur Häufung des Nomens mære vgl. auch Chinca / Young 2001, S. 618–626.] Hartmann wird als derjenige benannt, der dieses mære dichtete (V. 30). Später beginnt Kalogreant sein mære (V. 93). In dieser intradiegetischen Geschichte wird ihm schließlich der Waldmensch ein mære (V. 550) über die Quelle erzählen. Schließlich wird die Königin das mære Kalogreants König Artus berichten (V. 892). Das Erzählen von mæren verbindet auf diese Weise unterschiedliche Ebenen der Erzählung. Zudem betont es wiederholt auch die akustische Wahrnehmung: Das Hören ist mit den Erscheinungsformen des mære stets verbunden (vgl. Wandhoff 1994; Wandhoff 1996, S. 204–214). So ist die akustische Wahrnehmung etwa von elementarer Bedeutung, wenn „die Königin vom Geräusch der Worte aus dem Schlaf geweckt wird“ (Wandhoff 1994, S. 12). Manfred Kern hat die Kommunikationssituation von Kalogreants Erzählung am Artushof durch eine „Lust am Zuhören“ (Kern 2002, S. 408) charakterisiert. Erzählen und Zuhören sind nicht nur durch die Kommunikationssituation des Textes gegeben, sondern werden mittels der Binnenerzählung nochmals betont, die letztlich auch zum Auslöser der folgenden Romanhandlung wird. Schließlich bleibt zu erwähnen, dass „Kalogreant […] ausdrücklich das mære für sein laster verantwortlich [macht] und nicht etwa das Geschehen selbst“ (Wandhoff 1994, S. 13)! Mit dieser Repetition am Ende von Kalogreants langer Binnenerzählung komme ich zum Ende meiner Ausführungen und versuche die erarbeiteten Beobachtungen zusammenzufassen.
Der zweite Artusroman Hartmanns von Aue geht – wie ich versucht habe aufzuzeigen – mit einer Reihe von erzählerischen Besonderheiten einher, die die Literarizität und die Artifizialität des Textes hervorheben. Ich habe mich hier v. a. auf drei Aspekte konzentriert: die Faktur des Textes, die Diskussion mit Frau Minne innerhalb der Metalepse und schließlich den Erzähleingang.
Dabei konnte ich unterschiedliche Markierungen der Artifizialität, der künstlerischen Gemachtheit zeigen. Für die Kombination der Erzählschemata griff Hartmann auf das zurück, was sich bereits in seiner Vorlage, Chrétiens de Troyes ‚Yvain‘, findet, nämlich eine Kombination von zwei Erzählmustern: zum einen der sog. Doppelweg (den Chrétien bereits für ‚Erec et Enide‘ nutzte) und zum anderen das Erzählschema der sogenannte ‚gestörten Mahrtenehe‘. Beide sind auch in der Übertragung Hartmanns noch deutlich erkennbar. Daher können sie in ihrer Kombination auch für den deutschen ‚Iwein‘ als Markierung der artifiziellen Faktur des Textes interpretiert werden.
Zwischen dem ersten und dem zweiten Handlungsteil (und damit an einem neuralgischen Punkt der Handlung) hat Hartmann von Aue eine Metalepse positioniert, in der zwei Personifikationen, Frau Minne und Hartmann, miteinander (wörtlich) über die Wahrheit des Erzählens und des Erzählten diskutieren. Die Diskussion über den Tausch von Herzen zeigt u. a. an, dass in der durch Sprache erschaffenen Welt, in der Literatur, Dinge möglich sind, die in der realen Welt unmöglich wären.
Auch der Erzähleingang des ‚Iwein‘ weist auf unterschiedliche Weise auf die Überlegenheit der durch Sprache erzeugten Welt hin. Explizit wird das beispielsweise in der in die Festbeschreibung eingelassenen Erzähler-digressio. Hier wird der Jetztzeit ein Primat gegenüber der Vergangenheit eingeräumt: Denn wenn seinerzeit die Taten der arthurischen Ritter Bedeutung besaßen, so besitzt die Möglichkeit über diese Taten heute zu erzählen, ihre eigene Qualität, ihre eigene Berechtigung. Mit welchen Effekten dieses noch relativ junge höfisch-weltliche Erzählen, einhergeht, führt Hartmann am Texteingang vor, indem er die besonderen kommunikativen Bedingungen der ‚neuen‘ Literatur spielerisch und effektvoll nutzt und unterschiedliche Erzählebenen ebenso wie unterschiedliche Kommunikationsebenen miteinander verschaltet.
Auf diese Weise stellt sich Hartmanns ‚Iwein‘ als ein Roman mit vielfältigen Dynamiken dar, die wiederholt (und variationsreich) die Artifizialität des Textes markieren. Dass diese Textdynamiken ihr Publikum fanden, davon zeugt u. a. die relativ hohe Anzahl erhaltener Handschriften, davon zeugen aber auch die bildlichen Darstellungen – und nicht zuletzt die intertextuellen Verweise anderer mittelalterlicher Dichter auf Hartmanns ‚Iwein‘. Doch das wäre bereits das Thema für einen weiteren Vortrag.
Primärliteratur
- Hoppe, Felicitas: Iwein Löwenritter: Erzählt nach dem Roman von Hartmann von Aue. Mit vier Farbtafeln von Michael Sowa, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2008.
- Hartmann von Aue: Gregorius. Der arme Heinrich. Iwein. Hg. und übers. von Volker Mertens, Frankfurt am Main 2008 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 29 [= Bibliothek deutscher Klassiker 189, Bibliothek des Mittelalters 6]).
Sekundärliteratur
- Baisch, Martin: Überlieferung und Ambiguität. Die Textualität des höfischen Romans nach der Fassungen-Diskussion, in: Egidi, Margreth u.a. (Hgg.): Hartmann von Aue 1230–1517. Kulturgeschichtliche Perspektiven der handschriftlichen Überlieferung, Stuttgart 2020 (ZfdA – Beiheft 34), S. 327–341.
- Bauschke, Ricarda: Adaptation courtoise als ‚Schreibweise‘. Rekonstruktion einer Bearbeitungstechnik am Beispiel von Hartmanns Iwein, in: Andersen, Elizabeth u.a. (Hgg.): Texttyp und Textproduktion in der deutschen Literatur des Mittelalters, Berlin / New York 2005 (Trends in Medieval Philology 7), S. 65–84.
- Brinkmann, Henning: Der Prolog im Mittelalter als literarische Erscheinung. Bau und Aussage, in: Wirkendes Wort 14, 1964, S. 1–21.
- Bumke, Joachim: Die vier Fassungen der ‚Nibelungenklage‘. Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte und Textkritik der höfischen Epik im 13. Jahrhundert, Berlin 1996.
- Chinca, Mark und Young, Christopher: Literary theory and the German romance in the literary field c. 1200, in: Peters, Ursula (Hg.): Text und Kultur. Mittelalterliche Literatur 1150–1450. DFG-Symposion 2000, Stuttgart / Weimar 2001 (Germanistische Symposien, Berichtsbände 23), Stuttgart / Weimar 2001, S. 612–644.
- Cormeau, Christoph und Störmer, Wilhelm: Hartmann von Aue. Epoche – Werk – Wirkung, München ³2007.
- Däumer, Matthias: Stimme im Raum und Bühne im Kopf. Über das performative Potenzial der höfischen Artusromane, Bielefeld 2013 (Mainzer Historische Kulturwissenschaften 9).
- Felber, Timo: Literatur um 1200. Hartmanns Dichtung im literaturhistorischen Kontext, in: Kropik, Cordula (Hg.): Hartmann von Aue. Eine literaturwissenschaftliche Einführung, Tübingen 2021 (utb 5562), S. 15–44.
- Griese, Sabine und Henkel, Nikolaus: Mittelalter, in: Rautenberg, Ursula / Schneider, Ute (Hgg.): Lesen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin / Boston 2015, S. 719–738.
- Greulich, Markus: Hartmanns Erzähler, in: Kropik, Cordula (Hg.): Hartmann von Aue. Eine literaturwissenschaftliche Einführung, Tübingen 2021 (utb 5562), S. 197–220.
- Greulich, Markus: Zwischen Sprechen, Lesen und Schreiben. Zu den medialen Bedingungen von Hartmanns Autorsignatur, in: Egidi, Margreth u.a. (Hgg.): Hartmann von Aue 1230–1517. Kulturgeschichtliche Perspektiven der handschriftlichen Überlieferung, Stuttgart 2020 (ZfdA – Beiheft 34), S. 41–57.
- Greulich, Markus: Stimme und Ort. Narratologische Studien zu Heinrich von Veldeke, Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach, Berlin 2018 (Philologische Studien und Quellen 264).
- Haug, Walter: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Darmstadt ²1992.
- Hausmann, Albrecht: Mittelalterliche Überlieferung als Interpretationsaufgabe. ‚Laudines Kniefall‘ und das Problem des ‚ganzen Textes‘, in: Peters, Ursula (Hg.): Text und Kultur. Mittelalterliche Literatur 1150–1450. DFG-Symposion 2000, Stuttgart / Weimar 2001 (Germanistische Symposien, Berichtsbände 23), S. 72–95.
- Kartschoke, Dieter: Erzählen im Alltag – Erzählen als Ritual – Erzählen als Literatur, in: Lieb, Ludger / Müller, Stephan (Hgg.): Situationen des Erzählens. Aspekte narrativer Praxis im Mittelalter, Berlin / New York 2002 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 20), S. 21–39.
- Kellermann, Wilhelm: Aufbaustil und Weltbild Chrestiens von Troyes im Percevalroman, Halle 1936.
- Kern, Manfred: Iwein liest ‚Laudine‘. Literaturerlebnisse und die ‚Schule der Rezeption‘ im höfischen Roman, in: Meyer, Matthias / Schiewer, Hans-Joachim (Hgg.): Literarische Leben. Rollenentwürfe in der Literatur des Hoch- und Spätmittelalters (FS Volker Mertens), Tübingen 2002, S. 385–414.
- Kropik, Cordula: Komposition und Erzählwelt, in: Kropik, Cordula (Hg.): Hartmann von Aue. Eine literaturwissenschaftliche Einführung, Tübingen 2021 (utb 5562), S. 149–173.
- Kuhn, Hugo: Erec, in: Kuhn, Hugo: Dichtung und Welt im Mittelalter, Stuttgart 1959, S. 133–150 und S. 265–270. [Erstpublikation in: Festschrift für Paul Kluckhohn und Hermann Schneider, hg. v. ihren Tübinger Schülern, Tübingen 1948, S. 122-147.]
- Laude, Corinna: ‚Hartmann‘ im Gespräch – oder: Störfall ‚Stimme‘. Narratologische Fragen an die Erzählinstanz des mittelalterlichen Artusromans (nebst einigen Überlegungen zur Allegorie im Mittelalter), in: Abel, Julia (Hg.): Ambivalenz und Kohärenz. Untersuchungen zur narrativen Sinnbildung, Trier 2009 (Schriftenreihe Literaturwissenschaft 81), S. 71–91.
- Lieb, Ludger: Hartmann von Aue. Erec – Iwein – Gregorius – Armer Heinrich, Berlin: 2020 (Klassiker Lektüren 15).
- Masse, Marie-Sophie: Translations de l’œuvre médiévale (XIIe – XVIe siècles): Érec et Énide – Erec – Ereck, Würzburg 2020 (Rezeptionskulturen in Literatur- und Mediengeschichte 15).
- Mertens, Volker: Imitatio Arthuri. Zum Prolog von Hartmanns ‚Iwein‘, in: ZfdA, 106, 1977, S. 350–358.
- Mertens, Volker: Der deutsche Artusroman, Stuttgart 1998 (RUB 17609).
- Mertens, Volker: Recht und Abenteuer – Das Recht auf Abenteuer. Poetik des Rechts im ‚Iwein‘ Hartmanns von Aue, in: Fijal, Andreas u.a. (Hgg.): Juristen werdent herren ûf erden. Recht – Geschichte – Philologie. Kolloquium zum 60. Geburtstag von Friedrich Ebel, Göttingen 2006, S. 189–210.
- Meyer, Matthias: Blicke ins Innere. Form und Funktion der Darstellung des Selbst literarischer Charaktere in epischen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts, Habilitationsschrift masch. Berlin 2004.
- Müller, Stephan: ‚Erec‘ und ‚Iwein‘ in Bild und Schrift. Entwurf einer medienanthropologischen Überlieferungs- und Textgeschichte ausgehend von den frühesten Zeugnissen der Artusepen Hartmanns von Aue, in: PBB 127 (2005), S. 414–435.
- Raumann, Rachel: Fictio und historia in den Artusromanen Hartmanns von Aue und im ‚Prosa-Lancelot‘, Tübingen / Basel 2010 (Bibliotheca Germanica 57).
- Rushing Jr., James A.: Images of Adventure. Ywain in the Visual Arts, Philadelphia 1995.
- Schirok, Bernd: Ein rîter, der gelêret was. Literaturtheoretische Aspekte in den Artusromanen Hartmanns von Aue, in: Keck, Anna u.a. (Hgg.): Ze hove und an der strâzen. Die deutsche Literatur und ihr ‚Sitz im Leben‘. Festschrift für Volker Schupp zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1999, S. 148–211.
- Schmid, Elisabeth: Weg mit dem Doppelweg. Wider eine Selbstverständlichkeit der germanistischen Artusforschung, in: Wolfzettel, Friedrich / Ihring, Peter (Hgg.): Erzählstrukturen der Artusliteratur. Forschungsgeschichte und neue Ansätze, Tübingen 1999, S. 69–85.
- Schröder, Werner: Laudines Kniefall und der Schluß von Hartmanns ‚Iwein‘, in: Schröder, Werner: Critica selecta, Hildesheim 1999 (Spolia Berolinensia 14), S. 229–257.
- Schupp, Volker und Szklenar, Hans: Ywain auf Schloß Rodenegg. Eine Bildergeschichte nach dem ‚Iwein‘ Hartmanns von Aue, Sigmaringen 1996.
- Wandhoff, Haiko: Aventiure als Nachricht für Augen und Ohren. Zu Hartmanns von Aue ‚Erec‘ und ‚Iwein‘, in: ZfdPh 113, 1994, S. 1–22.
- Wandhoff, Haiko: Der epische Blick. Eine mediengeschichtliche Studie zur höfischen Literatur, Berlin 1996 (Philologische Studien und Quellen 141).
- Wandhoff, Haiko: Poetologische Fiktion und Selbstreflexion des Erzählens, in: Kropik, Cordula (Hg.): Hartmann von Aue. Eine literaturwissenschaftliche Einführung, Tübingen 2021 (utb 5562), S. 175–196.
- Wenzel, Franziska: Keie und Kalogrenant. Zur kommunikativen Logik höfischen Erzählens in Hartmanns ‚Iwein‘, in: Kellner, Beate u. a. (Hgg.): Literarische Kommunikation und Interaktion. Studien zur Institutionalität mittelalterlicher Literatur, Frankfurt am Main 2001 (Mikrokosmos 64), S. 89–104.
- Wolf, Alois: Fol i allai, fol m’en revinc! Der Roman von Löwenritter zwischen mançonge und mære, in: Fritsch-Rößler, Waltraut (Hg.): Uf der mâze pfat. Festschrift für Werner Hoffmann zum 60. Geburtstag, Göppingen 1991 (GAG 555), S. 205–226.
Hilfsmittel
- Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, 3 Bde., Leipzig 1872–1878 (Nachdruck Stuttgart 1992).
Online-Quellen
- https://handschriftencensus.de/werke/150 (letzter Zugriff: 10.11.2022).
- https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/iwd/index.html (letzter Zugriff: 10.11.2022).
Beitrag 5
Wolfram von Eschenbach ‚Willehalm‘ — Gyburg, die Protagonistin, eine Frau mit vielen Facetten
Der folgende Beitrag widmet sich einer der bedeutendsten Frauengestalten (aus Sicht des Verfassers der bedeutendsten Frauengestalt) der deutschen Literatur des Mittelalters. Es handelt sich um die im Titel des Beitrags genannte Gyburg. Bevor auf sie eingegangen wird, gilt es einige allgemeine Aspekte zu behandeln, um das, worum es im Kern gehen soll, nachvollziehbar zu machen. Zunächst sollen der Autor des Werkes, der sich durch als Stilisierungen zu bezeichnende Aussagen über sich selbst fast zu einer literarischen Figur macht, und sein literarisches Schaffen in groben Zügen vorgestellt werden. Es folgt eine Skizzierung des Inhalts des ,Willehalmʻ, die schon auf Besonderheiten in der Gestaltung der Protagonistin hinweisen wird, danach rücken zwei Textpassagen, die eingehender analysiert werden sollen, in den Fokus: das Religionsgespräch und die sogenannte Toleranzrede Gyburgs, die, wie angedeutet, ohne zumindest rudimentäre Kenntnisse der vorangehenden Gesichtspunkte unverständlich bleiben würden. Diese Ausführungen münden in einem Fazit, das Gyburg als Akteurin des Werkes und ihre Bedeutung für das Werkganze skizzieren soll. Das Motto der Vorlesungsreihe aufgreifend wird es abschließend in einem Exkurs kurz um den Aspekt der Textdynamik gehen.
Die Textzitate sind den im Literaturverzeichnis angeführten Ausgaben entnommen. Zu den Textstellenangaben sei vorab angemerkt, dass die Ausgaben des ,Willehalmʻ ebenso wie die des ,Parzival‘, der beiden Werke Wolframs aus denen Zitate vorkommen werden, in 30er Abschnitte gegliedert sind, deren Verse gezählt werden. Es erscheint deshalb vor dem Komma der Stellenangabe eine Zahl, die sich auf den 30er Abschnitt bezieht, danach folgt eine, die die Verse des angegebenen 30er Abschnitts bezeichnet. In den Ausgaben findet sich darüber hinaus eine Gliederung in Bücher, die allerdings für die Stellenangabe keine Rolle spielt, die Erwähnung dient lediglich der Vervollständigung und zielt auf diejenigen ab, die in den angegebenen Ausgaben nachschlagen. Ob die beschriebene Unterteilung der Werke tatsächlich auf Wolfram zurückgeht, ist strittig und kann kaum mit Sicherheit geklärt werden.
Für die nachfolgenden Ausführungen grundlegend wichtige Literatur wird im Literaturverzeichnis angegeben. Das primäre Ziel der folgenden Darlegungen wird nicht sein, verschiedene Forschungsmeinungen darzustellen und einander unmittelbar gegenüberzustellen, vielmehr geht es um den Versuch, aus Gelesenem und eigenen Gedanken einen Text zu verfassen, dessen Inhalt sich nachvollziehbar und schlüssig mit nicht eben einfachen Textstellen auseinandersetzt, diese analysiert und, wie es bereits ausgeführt wurde, in einem Fazit Schlüsse und Ergebnisse zusammenfasst. Das bedeutet für die Vorgehensweise, dass es keine wörtlichen Zitate geben und der fortlaufende Text, fast daraus resultierend, nicht durch Hinweise auf Forschungsliteratur unterbrochen wird. Ein weiterer Grund, der für die beschriebene Vorgehensweise sprach, ist in der Absicht zu sehen, möglichst textnah zu arbeiten und die eingehender analysierten Textstellen für sich sprechen zu lassen. Das soeben Dargelegte bedeutet aber nicht, dass auf der Suche nach der plausibelsten Interpretation nicht doch Forschungstendenzen angesprochen und gegeneinander abgewogen werden. Darüber hinaus sollte der Charakter des mündlichen Vortrages erhalten bleiben, auf den die nachfolgenden Ausführungen zurückgehen. Hintergrund ist eine Vorlesungsreihe, die im Rahmen der Institutspartnerschaft zwischen der Universität Krakau und Leipzig stattfand. Der beträchtliche Umfang entspricht, dies dürfte klar sein, nicht dem Vortragsumfang, sondern resultiert daraus, dass versucht wurde, die lebhafte Diskussion und die Antworten auf die anregenden Fragen bei der Ausarbeitung zu berücksichtigen.
Die Übersetzungen der zitierten mittelhochdeutschen Textstellen sind alle den im Literaturverzeichnis angeführten Ausgaben entnommen. Besonders im Hinblick auf den ,Willehalmʻ ist darauf hinzuweisen, dass dies geschieht, obwohl die Übertragungen sich teilweise vom Wortlaut des Mittelhochdeutschen doch deutlich abheben. Die Vorgehensweise wurde gewählt, um Konfusionen bei denjenigen zu vermeiden, die in der Ausgabe die Textstellen nachlesen und den Text dort weiter konsultieren.
Wolfram von Eschenbach – Anmerkungen zu Dichter und Werk
Wolfram von Eschenbach zählt zu den großen Autoren der Zeit um 1200, zusammen mit Hartmann von Aue und Gottfried von Straßburg zählen er und seine Werke zur oft so genannten höfischen Klassik. Wie bei anderen Dichtern der Zeit ist unser Wissen im Hinblick auf die Biografie und die Lebensumstände sehr begrenzt. Mit mehr oder minder großer Plausibilität lassen sich Daten zu ihrem Leben und ihren Aufenthaltsorten erschließen, dabei werden, in Ermangelung urkundlicher Quellen zu den Dichtern, Aussagen der Dichter über sich selbst, ihre Auftraggeber, Erwähnungen bei anderen Autoren und Hinweise auf historisch nachweisbare Personen und/oder Ereignisse, die in den Werken Erwähnung finden, zu Grunde gelegt. Auf die Aussagen Wolframs zu seiner Person und seinen Lebensverhältnissen wird später zurückzukommen sein. Auf der Basis der soeben angeführten Möglichkeiten ist von einer Lebenszeit von circa 1170/1180 bis 1220/1230 auszugehen. Seit 1917 gibt es im Fränkischen in der Nähe von Ansbach einen Ort, der sich Wolframs-Eschenbach nennen darf. Es existieren deutliche Beziehungen zu der Gegend, in der der Ort liegt, aber es kann keinesfalls als bewiesen gelten, dass Wolfram tatsächlich in dem Ort geboren wurde, der sich heute nach ihm benennt. Wolfram muss sich über einen längeren Zeitraum im Umfeld des Landgrafen Hermann von Thüringen aufgehalten haben. Der Landgraf war der wichtigste Mäzen Wolframs, er hat Wolfram bei der Vollendung des ,Parzivalʻ unterstützt und war, wie im Werk dargelegt wird, der Auftraggeber des ,Willehalmʻ. Ein Aspekt der im Folgenden noch eine Rolle spielen wird.
Wolfram erlebte die Thronstreitigkeiten im Deutschen Reich um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert und deren Folgen gewissermaßen hautnah, was aus seinem ersten überlieferten epischen Werk, dem bereits erwähnten ,Parzivalʻ, geschlossen werden kann. Für den ,Willehalmʻ wichtig erscheint jedoch die Regentschaft von Kaiser Friedrich II., der nicht nur als überaus gelehrt zu gelten hat, sondern auch als tolerant in Glaubensfragen. Immerhin umgab er sich mit zahlreichen muslimischen Gelehrten, was nicht unerhebliche Folgen für die Entwicklung des westeuropäischen Geisteslebens zeitigte. Ein Schlaglicht auf Friedrichs II. Haltung wirft auch der von ihm offensichtlich nur widerwillig unternommene Kreuzzug. Friedrich II. brach erst 1228 – nach päpstlicher Auffassung viel zu spät – zu seinem Kreuzzug auf. Friedrich II. brach erst 1228 – nach päpstlicher Auffassung viel zu spät – zu seinem Kreuzzug auf. Wegen des angedeuteten Hinauszögerns wurde Friedrich II. exkommuniziert, dennoch zog er ins Heilige Land und eroberte Jerusalem ohne Blutvergießen durch Diplomatie. Hilfreich war dabei sicher, dass Friedrich II. arabisch sprach. Der Hinweis auf dessen Kreuzzug dient der Betonung von Friedrichs II. Haltung, die Fahrt ins Heilige Land kann aber ebenso wenig wie das Faktum, dass Friedrich II. Jerusalem friedlich eroberte auf Wolfram und sein Werk einen Einfluss ausgeübt haben, denn als das geschah, war Wolfram sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben, in jedem Fall aber war seine Arbeit am ,Willehalmʻ längst beendet. Die mit diesen Anmerkungen implizit verbundene These, dass die Politik Friedrichs II. und seine Haltung zu Muslimen für Wolfram eine Rolle gespielt haben kann, lässt sich allerdings durch den Hinweis darauf untermauern, dass Ludwig IV., der Sohn des als Wolframs Mäzen erwähnten Landgrafen Hermann von Thüringen, als Parteigänger Friedrichs II. einzustufen ist, eine Haltung, die mit der des Vaters konform ging. Dieser Aspekt wird später aufgegriffen werden.
Wolfram ist, das werden die folgenden Anmerkungen dokumentieren, sicher der eigenwilligste Dichter seiner Zeit, das wird nicht nur durch sein literarisches Schaffen deutlich, sondern auch durch die in diesem anzutreffenden Aussagen über sich selbst, die in der Form für einen Dichter dieser Zeit einzigartig sind. Es handelt sich, wie schon angesprochen, um eine Selbststilisierung, die von einem enormen Autorenbewusstsein zeugt. Gleichermaßen handelt es sich um ein Verwirrspiel, denn das, was Wolfram über sich selbst sagt, ist widersprüchlich. Er bezeichnet sich einerseits als Ritter und verhöhnt den Beruf des Dichters, andererseits beschreibt er sich als einen in bitterster Armut lebenden Menschen. Im vorliegenden Zusammenhang wichtiger sind Wolframs Aussagen seine Bildung betreffend. Zwei Zitate seien an dieser Stelle eingefügt, da es in diesem Beitrag um den ,Willehalmʻ (bei Textzitaten abgekürzt W) geht, zunächst und entgegen der Chronologie der Werke, ein Zitat aus dem genannten Werk:
swaz an den buochen stât geschriben
des bin ich künstelôs beliben
niht anders ich gelêret bin:
wan hân ich kunst die gît mir sin.
(W 2,19–22),Aus den Büchern
hab ich nichts, kein Wissen und kein Können.
Nicht anders bin ich unterwiesen:
was ich weiß und was ich kann, das kommt
mir aus der Einsicht.ʻ
Im Grunde noch rigoroser äußert sich Wolfram im ,Parzivalʻ. In diesem Werk behauptet Wolfram, wenn das Geschriebene wörtlich genommen wird, dass er weder lesen noch schreiben kann, und – paraphrasiert – weiter: dass seine Geschichte, im Gegensatz zu den Erzählungen anderer, ohne Buchgelehrsamkeit auskommt (,Parzivalʻ, 115,27–30). Diese Textstelle regte eine lange und intensive Diskussion an, die im Grunde nicht wirklich zu einer einheitlichen Auffassung führte. Es darf aber wohl kaum angenommen werden, dass Wolfram tatsächlich, wie er es behauptet, Analphabet war. Wolfram will sich durch seine Aussagen gegen die Dichter, die eher stolz auf ihre Bildung sind und auf diese in ihrem Werk hinweisen, wie etwa Hartmann von Aue, abgrenzen.
Es kann, das wird später anhand der beiden Textstellen, die näher betrachtet werden sollen, eindeutig zu beobachten sein, von einer guten Bildung ausgegangen werden. Ausgeprägte Kenntnisse lassen sich aber auch anderweitig im literarischen Schaffen Wolframs deutlich erkennen. Es können als Beispiele für Wissensgebiete, in denen Wolfram durchaus Kenntnisse aufweist, genannt werden: Medizin, Geographie, Astrologie/Astronomie (eine Unterscheidung gab es zu Lebzeiten Wolframs nicht), Französischkenntnisse (hier ist strittig, wie gut diese waren). Darüber hinaus sind weitreichende Kenntnisse im Bereich der Literatur teilweise direkt nachweisbar, teilweise eher implizit bemerkbar. Wolfram kennt Werke unterschiedlicher Gattungszuordnungen, gleichzeitig beeinflusst er auch Werke unterschiedlicher Gattungen bzw. deren Verfasser. Das überschwänglichste Lob wird Wolfram durch Wirnt von Grafenberg, dem Verfasser des ,Wigaloisʻ, zuteil, leien munt nie baz gesprach ,nie hat ein Laie besser erzähltʻ (,Wigaloisʻ, V 6346).
Das Werk keines mittelalterlichen Dichters ist so breit überliefert worden wie das Wolframs. Seine Werke wurden circa 300 Jahre abgeschrieben, dabei auch illustriert und, im Falle des ,Parzivalʻ, sogar gedruckt. Der ,Jüngere Titurelʻ, dazu später etwas mehr, wurde im 15. Jahrhundert, weil er ab ungefähr 1300 fälschlicherweise als eine Dichtung Wolframs galt, sogar als das bedeutendste Werk deutscher Dichtung betrachtet. Wolfram wird darüber hinaus als Sänger des fiktionalen Sängerkrieges auf der Wartburg genannt, und die Meistersinger erklären ihn zu einem ihrer Meister.
Der Hinweis auf Wolfram als Sänger soll zu einem kurz gefassten Werküberblick genutzt werden. Wolfram darf als Wegbereiter einer besonderen Liedgattung im deutschen Minnesang bezeichnet werden. Er verhalf dem Tagelied zumindest zum Durchbruch, die Liedgattung wurde zu einer der beliebtesten im 13. Jahrhundert. Wolfram hat damit auch eine deutliche, unmittelbar dargestellte, sexuelle Komponente in den deutschen Minnesang gebracht.
Mit seinem ersten und gleichzeitig einzig vollendeten epischen Werk, dem ,Parzivalʻ bringt Wolfram den Gralsmythos in die deutschsprachige Literatur. Das Werk wird zwar oft in die Gattung Artusroman integriert, es beinhaltet aber weit mehr, als es von den Artusromanen zu erwarten ist. Es hat sich deshalb auch die Bezeichnung Doppelroman eingebürgert. Das Werk vereint zwei unterschiedliche Motivkomplexe (den Artusstoff und den Gralsmythos) und verbindet – sehr grob gesprochen – mit jedem der Motive einen Protagonisten. Das gilt, obwohl sich durch Parzival auch eine unmittelbare Verbindung ergibt, da er von seiner Genealogie her gesehen der Artussippe und der Gralssippe zugehört. Die Protagonisten treten abwechselnd in den Vordergrund, wobei durch Querverweise dafür Sorge getragen wird, dass der jeweils andere in Erinnerung bleibt. Die Entstehungsgeschichte des Werkes wirft bis heute nicht endgültig beantwortete Fragen auf, vollendet wurde es im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts am Hof des bereits genannten Landgrafen Hermann von Thüringen. Es würde, wenn es so etwas wie eine Bestsellerliste gäbe, auf Rang eins oder zwei anzusiedeln sein, wobei der Konkurrent um Platz eins das Werk ist, dem gleich mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden soll. Der ,Parzivalʻ ist, wie viele andere deutsche Werke dieser Zeit auch, auf der Grundlage einer französischen Vorlage entstanden, wobei Wolfram, was für seine Zeit ungewöhnlich ist, eine deutliche Distanz zu dieser zum Ausdruck bringt.
Die angesprochenen ,Titurelʻ-Fragmente lassen sich nicht genauer datieren, wenn davon abgesehen wird, dass sie nach dem ,Parzivalʻ entstanden sind. Aus den Fragmenten ergibt sich immerhin, dass Wolfram sich auch hier mit der Gralsippe beschäftigte, möglicherweise war es der Plan, eine Art Genealogie dieser Sippe zu verfassen, und dass der Inhalt der Fragmente mit dem Inhalt des ,Parzivalʻ verwoben ist. Das Innovative liegt besonders in der Form. Wolfram verwendet die Strophe als formale Einheit und als deren Elemente die Langzeile. Beides wird sonst in der höfischen Epik nicht verwendet, beide Grundkomponenten sind aber bekannt aus der germanischen Heldendichtung. Warum Wolfram diese Form aufgriff, bleibt sein Geheimnis. Es lässt sich allerdings belegen, dass Wolfram zumindest das ,Nibelungenliedʻ, einen zentralen Vertreter der genannten Gattung, kannte. Die ,Titurelʻ-Fragmente wurden später, wie implizit bereits gesagt, aufgegriffen und es entstand ein Werk von circa 6500 Strophen, das auf einen Albrecht (von Scharfenberg) zurückgeht, aber – wie ebenfalls schon angedeutet – bald für ein Werk Wolframs gehalten wurde.
Zu erwähnen bleibt noch der ,Willehalmʻ, das Werk, das im Zentrum des Interesses steht. Das Werk ist sicher nach dem ,Parzivalʻ entstanden, denn Wolfram beschwert sich im ,Willehalmʻ darüber, dass sein Erstlingswerk nicht überall positiv aufgenommen wurde. Der ,Willehalmʻ blieb unvollendet. Die Ursache dafür ist, so eine These, die den meisten Zuspruch fand, darin zu sehen, dass der im Werk erwähnte Auftraggeber und Mäzen Wolframs starb. Es handelt sich um Hermann von Thüringen, der 1217 gestorben ist. Der Versuch einer Datierung in die zwanziger Jahre ist eher spekulativ, denn eine Förderung des Autors durch Hermanns Nachfolger Ludwig IV. und dessen Ehefrau Elisabeth erscheint unwahrscheinlich. Es ist demnach davon auszugehen, dass Wolfram seine Arbeit am Werk 1217 bzw. bald danach eingestellt hat. Eine andere Annahme geht davon aus, dass Wolfram selbst starb und deshalb sein Werk nicht vollenden konnte. Für die Datierung bedeutet das nach dem bisher Gesagten, dass Wolfram die Arbeit an seinem Werk wohl gegen Ende des zweiten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts einstellte. Eine Entscheidung, welche der angesprochenen Annahmen die richtige ist, kann nicht getroffen werden. Wolfram arbeitete auch bei diesem Werk nach einer französischen Vorlage, der ,Aliscansʻ aus dem Epenzyklus um Guillaume d´Orange. Auch mit dem ,Willehalmʻ geht Wolfram neue Wege und fand darin bald Nachfolger: In einer Zeit, in der der höfische Roman eine Blüte erlebte, wendet sich Wolfram von den höfischen Stoffen ab und greift einen Stoff der französischen Heldenepik auf.
Das bedeutet für die damaligen Rezipienten eine Hinwendung zur Geschichte, denn als historisches Geschehen wurden die im Rahmen der Chanson de geste erzählten Ereignisse aufgefasst. Als Chanson de geste wird die französischen Heldendichtung bezeichnet. In der Forschung wurde diese Hinwendung zur Geschichte als Wagnis bezeichnet. Ob diese Wende im literarischen Schaffen eine von Wolfram gewollte ist, oder ob sie auf den Mäzen zurückgeht, kann und soll hier nicht thematisiert werden, eine Antwort auf diese Frage könnte ohnedies nur den Anspruch erheben, spekulativ zu sein. Der ,Willehalmʻ gehört jedenfalls, wie schon gesagt, neben dem ,Parzivalʻ zu den am meisten überlieferten, literarischen Werken des Mittelalters, und er ist, auch darauf gilt es als Besonderheit hinzuweisen, dasjenige, das am häufigsten illustriert, das heißt mit bildlichen Darstellungen versehen wurde. Offenkundig hat Wolfram den literarischen Geschmack seiner Zeit getroffen, denn das Interesse war so groß, dass der Text nicht einfach abgeschrieben wurde, er wurde, wie gesagt, auch häufig illustriert, was die Kosten und den Wert der Handschriften enorm steigerte. Zu betonen ist außerdem, dass Wolframs Text das Mittelstück eines Zyklusses bildet, denn es entstand eine Vorgeschichte und das fehlende Ende wurde ergänzt.
Durch den angekündigten Exkurs zum Aspekt Textdynamik am Ende des Beitrags werden die jetzt eher ekklektisch oder gar kryptisch erscheinenden Hinweise zur Überlieferung aufgegriffen und etwas genauer erläutert werden.
Der ‚Willehalm‘ — Skizzierung des Inhalts
Der ,Willehalmʻ beginnt mit einem umfangreichen Prolog (W 1,1–5,15), der, wie vieles Andere auch, eine Zutat von Wolfram ist, also ohne Vorbild in der Vorlage von Wolfram verfasst wurde. Dieser Prolog ist geprägt von religiösen Motiven, er beginnt mit einem Gebet, er hat auch weithin einen gebetsartigen Charakter. Auf den Prolog kann nicht näher eingegangen werden, denn eine Beschäftigung damit würde von der gewählten Thematik zu weit abführen und durch seine Komplexität einen breiten Raum einnehmen. Es sollte aber erwähnt werden, dass Aspekte, die bereits im Prolog thematisiert werden, auch im Religionsgespräch zwischen Gyburg und ihrem Vater Terramer sowie in ihrer Rede im Fürstenrat, also den beiden Teilen des Werkes, die später in dieser Abhandlung intensiv behandelt werden, eine Rolle spielen. Der Prolog ist aber nicht nur mit dem Religionsgespräch und der Rede im Fürstenrat verzahnt, er verweist geradezu programmatisch auf im Textverlauf wiederkehrende Motive. Er entwickelt darüber hinaus sogar eine eigene Überlieferungsgeschichte, auf die im Exkurs zumindest kurz hingewiesen werden wird.
Im Anschluss an den Prolog wird berichtet, dass Willehalm – wie seine neun Brüder – von seinem Vater enterbt wurde, zu Gunsten von dessen Patenkind. Dies führt dazu, dass Willehalm sich nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch Besitz erstreiten muss. Dabei gerät er in heidnische Gefangenschaft und lernt Arabel kennen, die mit ihm flieht, zum Christentum konvertiert, sich auf den Namen Gyburg taufen lässt und Willehalm heiratet, obwohl sie in ihrer heidnischen Heimat bereits verheiratet ist. Damit ist die ursprüngliche Ursache der kriegerischen Auseinandersetzungen, mit denen das Werk beginnt, erwähnt, denn Arabel lässt ihren Ehemann, Tybalt, und, wie im Verlauf des Werkes bekannt wird, Kinder zurück, von denen Ehmereiz, ein Sohn, im Werk als Kämpfer gegen Willehalm in Erscheinung tritt. Tybalt verfolgt das Paar, unterstützt von seinem Schwiegervater Terramer, dem obersten Herrscher der Heiden. Es geht am Anfang also eher um einen privaten Konflikt. Ein verlassener Ehemann will seine Ehefrau zurückholen, wobei auch Herrschaftsansprüche eine Rolle spielen, die jedoch familienintern angesiedelt sind. Anzumerken ist, dass der Erzähler den Rezipienten eigentlich für das Verständnis wichtige Informationen vorenthält, die später nach und nach mitgeteilt werden.
Noch in die Beschreibung der Heere, die sich gegenüberstehen, fällt ein Erzählerexkurs, der Gyburgs Rolle thematisiert. Schon mit dem Hinweis darauf, dass sie die Frau mit den zwei Namen ist, weist der Erzähler auf die unterschiedlichen Perspektiven hin, aus denen die Gestalt zu bewerten ist. Dementsprechend sind auch die Beurteilungen verschieden. Gyburg wird im Verlauf des angesprochenen Erzählerexkurses zunächst für das große Sterben der Christen und den Tod vieler ihrer heidnischen Verwandten verantwortlich gemacht. Doch dann vollzieht der Erzähler eine radikale Wende. Schuldlos sei Gyburg, wird nun behauptet, Grundlage für diese Feststellung ist, dass Gyburgs Tun aus der Liebe zum christlichen Gott resultiert. Die positive Bewertung hat als Grundlage also den Glauben, den religiösen Aspekt von Gyburgs Handlungsweise, der höher zu veranschlagen ist, als die zuvor geäußerte eher profan weltlich orientierte Schuldzuweisung bzw. Orientierung. Dies macht der Erzähler seinen Rezipienten unmissverständlich klar. Er überlässt es also nicht seinen Rezipienten, die Gestalt zu beurteilen, er nimmt ihnen die Entscheidung ab.
Das Heer der Heiden ist zahlenmäßig weit überlegen. Dennoch gelingt es dem christlichen Heer, den Kampf offen zu gestalten, bis Terramer mit seinen Truppen in den Kampf eingreift. Das christliche Heer wird nun aufgerieben. Vivianz, der Neffe und Ziehsohn von Gyburg und Willehalm, wird nach heroischem Widerstand tödlich verletzt. Willehalm findet den im Sterben Liegenden und möchte die Leiche von Vivianz mit in seine Burg nehmen, was ihm jedoch verwehrt bleibt. Der Tod von Vivianz hat für den Handlungsfortgang eine große Bedeutung. Willehalm kann sich schließlich allein nach Oransche, seine Burg, durchschlagen, wo Gyburg auf ihn wartet. Nachdem Willehalm in Oransche eingelassen wurde, erweist sich Gyburg nicht nur als treue, sondern auch als liebende – auch im geschlechtlichen Sinn – Ehefrau. Die beiden begegnen sich, was für die damalige Zeit außergewöhnlich ist, auf Augenhöhe, sie beraten sich und fällen einen Entschluss. Die Verbindung von wahrer Liebe und Ehe betont Wolfram schon in seinem ,Parzivalʻ, es handelt sich bei der Darstellung also um ein werkübergreifendes Motiv bei Wolfram.
Willehalm will sich nach Munleun durchschlagen, wo sich der französische König aufhält. Er möchte mit dessen Hilfe ein neues Heer zusammenstellen, um wieder gegen die Heiden kämpfen zu können. Gyburg soll in der Zwischenzeit die Burg gegen die heidnischen Angriffe verteidigen. Sie und die höfischen Damen tragen nun Rüstungen, sie werden zu Kämpferinnen. Dies klingt sehr außergewöhnlich, aber es ist verbürgt, dass Frauen an den Kreuzzügen im 12. Jahrhundert auch als Kämpferinnen teilgenommen haben. Ungeachtet dessen dürfte es den Rezipienten als etwas Besonderes aufgefallen sein, dass Gyburg und die höfischen Damen ein heidnisches Heer, das die Burg belagert und immer wieder angreift, in Schach gehalten haben. Die wenigen männlichen Mitstreiter verschwinden demgegenüber im Hintergrund. Gyburg erweist sich bei der Verteidigung der Burg als überaus klug. So stellt sie etwa tote Ritter in ihren Rüstungen auf die Zinnen, um eine größere Besatzung der Burg vorzutäuschen. Der Erzähler fühlt sich bemüßigt, zu erklären, warum Gyburg die heidnischen Angriffe abwehren kann. Er erläutert, dass es beim Abschied von Willehalm zu einem Herzenstausch kam, sie behielt seines in Oransche, er zog mit ihrem nach Munleun (W 109,8–14). Außerdem wird später darauf hingewiesen, dass Gyburg schon oft Waffen getragen habe (W 215, 6–7).
Wir können für Gyburg als kleines Zwischenfazit festhalten: Sie hat, wie sie später immer wieder betonen wird, für Gott, aber auch für Willehalm, ihren Ehemann verlassen und sich taufen lassen, sie ist also getaufte Heidin, Ehefrau des Markgrafen Willehalm und dessen Partnerin auf Augenhöhe, ihre Liebe wird auch in deren erotischer Komponente in den Fokus gerückt. Willehalm berät sich mit ihr, sie ist die Ziehmutter von Vivianz, dessen Tod sie fast über die Maßen betrauert, was später noch deutlicher wird, als es dies bisher wurde.
Willehalm macht sich auf den Weg, um Hilfe zu gewinnen. Auf seinem Zug, auch dies ein Zeichen der innigen Verbindung des Paares, verzichtet Willehalm auf alle Annehmlichkeiten, das betrifft sowohl seine Übernachtungsmöglichkeiten als auch die Mahlzeiten, die er zu sich nimmt. Der Zutritt zum Hof wird Willehalm zunächst auf Betreiben von dessen Schwester, der Frau des französischen Königs, verweigert, als Willehalm tags darauf doch eingelassen wird, kommt es zum Affront. Mit knapper Not kann verhindert werden, dass Willehalm seine Schwester tötet. Die Weigerung des Königspaars, Willehalms Bitte um Unterstützung nachzukommen, war der Anlass. Der Bericht vom Tod von Vivianz ändert die Situation. Willehalms Schwester ist nun bereit, ihren Bruder tatkräftig zu unterstützen. Schließlich sagt auch König Lois seine Unterstützung zu. Davor hatte dies bereits auch die Familie von Willehalm getan. Das Reichsheer wird versammelt. Durch die Zusage des Königs wird der Krieg auf eine andere Ebene verlagert, er ist jetzt eine Reichsangelegenheit. Wichtig am Besuch des Hofes ist, dass Willehalm dort den riesenhaften Rennewart kennen lernt. Dieser lebt, obwohl von hoher Geburt, als Küchenhilfe am Königshof, weil er sich weigert, sich taufen zu lassen. Durch seine Sprachkenntnisse kann sich Willehalm mit Rennewart in dessen Muttersprache unterhalten. Er bittet den König, Rennewart mit sich nehmen zu dürfen, was dieser schließlich, auch auf Bitten seiner Tochter Alize, die in Rennewart verliebt ist, zulässt. Lois übergibt Willehalm die Reichsfahne und macht ihn zum Heerführer des Reichsheeres. Der Fokus kann so auf Willehalm bleiben, der Krieg, der nun geführt wird, bleibt auch ohne persönliche Beteiligung des Königs, wie bereits angedeutet, ein Krieg des Reiches gegen Invasoren. Unter der Führung Willehalms zieht das Heer Richtung Oransche. Von weitem sieht Willehalm nachts ein Feuer leuchten, das in der Richtung der Stadt liegt. Er ist verzweifelt.
Der Erzähler wendet seinen Blick zurück. Gyburg ist es während der Abwesenheit von Willehalm gelungen, die Burg zu halten. In einer Kampfpause kommt es zum so genannten Religionsgespräch, das später näher behandeln werden soll. Das Gespräch findet im Grunde in zwei Abschnitten statt, wobei nur der zweite Teil als Religionsgespräch bezeichnet wird. Dennoch sollen vor der Behandlung des eigentlichen Religionsgesprächs einige Hinweise auf die erste Tochter-Vater-Begegnung nach der Konversion Arabels erfolgen. Bei der Rückkehr Willehalms kommt es wieder zu einem liebevollen Empfang, obwohl Gyburg deutlich von den Strapazen gezeichnet ist. Als die französischen Fürsten in Oransche eintreffen, befiehlt Gyburg ihren Hofdamen, sich schön zu machen, um für gute Stimmung während des stattfindenden Festmahls zu sorgen. Es entsteht in zweierlei Hinsicht eine groteske Situation. Zum einen kann Willehalm selbst das Festbankett nicht ausrichten, er bedarf der Unterstützung von Heimrich, seinem Vater, zum anderen – und bemerkenswerter – das Festbankett wird vor der Kulisse der brennenden Stadt abgehalten. Es ist zwar gelungen, die Burg zu halten, die sie umgebende Stadt aber brennt. Als Rennewart beim Festbankett erscheint, fühlt sich der Erzähler an den jungen Parzival erinnert. Es wird so eine unmittelbare Verbindung zum ersten Werk Wolframs hergestellt. Gyburg selbst sieht die Ähnlichkeiten zu ihren Verwandten.
Das Festbankett ließe sich zwar näher betrachten. Da der Fokus auf Gyburg ruht, soll aber nur kurz etwas zu ihr bzw. ihrem Verhalten während des Banketts und einigen zentralen Aspekten des Festes ausgeführt werden. Ihr Schwiegervater setzt sie an seine Seite. Sie ist untröstlich und weint, was im gegebenen Zusammenhang als unhöfisches Verhalten gelten muss. Willehalm kümmert sich nach der Aufhebung des Festmahls darum, dass alle gut versorgt sind, und lädt alle zur Fürstenversammlung am nächsten Tag ein. Das Paar zieht sich in seine Kemenate zurück. Die Geschehnisse um Rennewart, der während des Festbanketts schon für einen Eklat sorgte, es wird nicht der einzige bleiben, sollen nur andeutungsweise thematisiert werden. Rennewart zieht sich schlussendlich in die Küche zurück, um zu schlafen. Der Erzähler fasst Rennewarts Geschichte folgendermaßen zusammen: Rennewart wurde als Kleinkind entführt und kam schließlich an den Hof des französischen Königs. Er hadert mit seinem Schicksal, weil er glaubt, seine Familie habe ihn im Stich gelassen. Sein Kampf für die Christen, obwohl er selbst Heide ist und sich weigert, sich taufen zu lassen, ist als Rache an seiner Familie zu betrachten. Allerdings hat seine Familie nach ihm gesucht, seine Rache basiert deshalb im Grunde auf einer falschen Annahme. Die Rezipienten erfahren wieder einen Teil der Geschichte, der ihnen das Verständnis erleichtert.
Auch in der Küche kommt Rennewart nicht zur Ruhe. Ein Koch versengt ihm seinen Bart, was dazu führt, dass Rennewart den Koch im Feuer verbrennt. Als Willehalm am nächsten Morgen davon erfährt, übergibt er Rennewart Gyburg, die ihn besänftigen soll. Als Gyburg und Rennewart sich treffen und unterhalten, bemerken sie eine gewisse Nähe. Gyburg möchte Näheres über die Herkunft Rennewarts erfahren, dieser verweigert jedoch die Auskunft. Gyburg ist Rennewarts Schwester, er ist also Terramers Sohn. Er versichert ihr, dass er treu an der Seite von Willehalm kämpfen werde. Nur widerwillig lässt sich Rennewart, der immer nur mit seiner Stange kämpfte, von Gyburg eine Rüstung schenken, deren Einsatz zwar für das Textverständnis bzw. für die Interpretation des Werkes von Interesse ist, im vorliegenden Zusammenhang aber keine Rolle spielt und nicht näher betrachtet werden muss.
Bevor es zur zweiten Schlacht kommt, findet die angesprochene Fürstenversammlung statt, an der auch Gyburg teilnimmt – ein erstaunliches Phänomen. Noch auffälliger ist, dass sie das Wort ergreift, eine Rede hält, in der es um die Schonung des Gegners und Toleranz gegenüber den Andersgläubigen geht. Gyburg selbst bezeichnet sich während dieser Rede, die ebenfalls genauer analysiert werden wird, als „törichte Frau“.
Rennewart wird zur entscheidenden Gestalt. Er zwingt nicht nur die französischen Fürsten, die angesichts der riesigen Übermacht des heidnischen Heeres fliehen wollen, an der Seite Willehalms zu kämpfen, er führt auch die Wende in der Schlacht herbei. Die Darstellung der Schlacht wäre es sicher wert, getrennt in den Blick genommen zu werden, für den vorliegenden Zusammenhang, genügen jedoch einige eher summarische Hinweise. Rennewart stellt sich an die Spitze des christlichen Heeres, das vor einer neuerlichen Niederlage steht, und führt es als Heide zum Sieg. Dies ist bei Wolfram jedoch kein zentraler Gedanke, er formuliert dies im Gegensatz zu seiner französischen Vorlage nicht explizit. Die siegreichen christlichen Truppen plündern, viele betrinken sich. Die Gefallenen werden nach ihrem Stand behandelt, also an Ort und Stelle begraben, dies gilt für die einfachen Ritter, die Fürsten und Könige, die nach Hause überführt werden sollen, werden einbalsamiert. So weit ließe sich formulieren, dass alles den gewohnten Bahnen gemäß verläuft. Die Freude über den Sieg wird allerdings massiv getrübt, als bekannt wird, dass Rennewart verschwunden ist. Willehalm ist völlig verzweifelt. Er lässt sich kaum beruhigen, er ist auf Grund seiner maßlosen Trauer handlungsunfähig. Seine Getreuen rügen ihn deswegen und fordern ihn auf, seine Pflichten als Heerführer zu erfüllen.
Willehalm rafft sich auf und erteilt Befehle. Es lässt sich formulieren, dass die geschilderte Handlungsweise dem entspricht, was Gyburg im Verlauf ihrer Rede im Fürstenrat von den christlichen Kämpfern forderte. Willehalm schont die noch lebenden Heiden, er verfolgt sie nicht und lässt sie auch nicht töten. Es wäre gemäß der Situation nach der Schlacht durchaus möglich, das verbliebene heidnische Kontingent restlos aufzureiben, niederzumetzeln oder wenigstens zu verlangen, dass die Heiden sich zum Christentum bekehren, nichts davon geschieht. Willehalm lässt stattdessen die toten Heidenkönige zusammentragen und einbalsamieren. Er beauftragt einen der gefangenen Heidenkönige, Matribleiz, alle toten Könige, auch die in der ersten Schlacht gefallenen, zu Terramer zu bringen, damit sie nach heidnischem Ritus bestattet werden können. Matribleiz solle Terramer mitteilen, dass er nicht aus Furcht handle, er wolle vielmehr das Geschlecht Gyburgs ehren. Er sei bereit, mit Terramer in Frieden zu leben, aber dieser dürfe nicht verlangen, dass er dem Christentum abschwöre oder Gyburg zurückgeben werde. Mit einem Geleit darf Matribleiz abziehen. Damit endet der überlieferte Wortlaut des Werkes.
Rollen und Funktionen Gyburgs — ein Zwischenfazit
Zu Gyburg lässt sich, was ihre Rollen bzw. Funktionen anbelangt, Folgendes zusammenfassen: Nur kurz wird erwähnt, dass Willehalm Arabel für sich gewann, weswegen viele Menschen sterben mussten. Die Stellung, die Arabel einnahm, bevor sie sich auf den Namen Gyburg taufen ließ und Willehalm heiratete, wird erst sehr viel später deutlich, sie war die Ehefrau von Tybald und dadurch Königin. Außerdem wird im Verlauf des Werkes dargestellt, dass sie mehrfache Mutter ist. Ihr Sohn Ehmereiz kämpft auf der Seite der Heiden. Gyburg ist der primäre Kriegsgrund, weshalb sie sich als Fluchbeladene sieht. Sie ist Geliebte im oben beschriebenen Sinn, als Ehefrau Willehalms Markgräfin und dessen Beraterin. Sie ist Kämpferin und verteidigt hauptsächlich mit den Hofdamen, aber auch durch die Anwendung einer List, erfolgreich Oransche. Sie wird, das darf formuliert werden, obwohl sie sich unhöfisch verhält, zur Gastgeberin der französischen Fürsten.
Eine ganz wesentliche Erweiterung und damit einhergehend Steigerung der Bedeutung erfährt die Gestalt aber dadurch, dass sie das Religionsgespräch mit ihrem Vater führt. Dass sie als Frau dieses Gespräch führt, ist allein schon eine Besonderheit, die allerdings dadurch, dass sie dies als konvertierte Heidin tut, noch gesteigert wird. Gyburg wird als konvertierte Heidin zur Verteidigerin des christlichen Glaubens. Den Gipfelpunkt, was ihre Bedeutung betrifft, erreicht Gyburg aber erst gegen Ende des Werkes, als sie, dies wurde schon angedeutet, – ungewöhnlich genug – nicht nur am Fürstenrat teilnimmt, sondern dort auch das Wort ergreift, eine Rede an die anwesenden Fürsten richtet, die von großer Brisanz ist und deren Inhalt – aus damaliger Sicht – zumindest als provokant zu bezeichnen ist. In der Forschung wird diese Rede oft als Toleranzrede bezeichnet.
Die herausragende Bedeutung Gyburgs wird dann zu Beginn des IX. Buches expressis verbis manifest, denn Gyburg wird nun direkt als Heilige tituliert. Das korrespondiert zu der Darstellung von Willehalm als Heiligem. Wie am Anfang des Werkes Willehalm so wird zu Beginn des IX. Buches Gyburg als Heilige angerufen, wobei ein Gebetstopos verwendet wird, in dem, auf den wesentlichen Aspekt reduziert, der Hoffnung Ausdruck verliehen wird, dass Gyburg dem Erzähler zur ewigen Seligkeit verhelfen möge. Es ließe sich formulieren, dass der Erzähler die Interpretation der Gestalt und die Wertschätzung, die ihr aus der Darstellung erwachsen soll, dieser Hinweis sei hier schon gestattet, verbalisieren und damit vorgegeben will. Eine Maßnahme, die ihm vielleicht auch deshalb angebracht schien, weil er Gyburg hat formulieren lassen, dass sie eine „törichte Frau“ sei. In diesem Zusammenhang könnte auch auf den thematisierten Gyburgexkurs verwiesen werden. Auch in diesem überließ der Erzähler die Bewertung nicht seinen Rezipienten.
Das Religionsgespräch
Während eines Waffenstillstandes kommt es zu einem ersten Treffen von Vater und Tochter, seit diese zum Christentum konvertierte. Willehalm ist auf dem Weg zum König, Gyburg ist bereit, Oransche zu verteidigen, sie will keinesfalls zulassen, dass ihrem Vater Terramer alles zufällt, er sie tötet und die Christen dem Heidentum zuführt. Außerdem berichtet der Erzähler davon, dass Terramer seiner Tochter massiv damit droht, dass sie getötet werden wird, wenn sie nicht zu ihrem alten Glauben und ihrem Ehemann zurückkehrt. Insgesamt werden drei Tötungsarten angesprochen. Erst nach dieser Schilderung der Situation spricht Gyburg ihren Vater direkt an und weist sein Ansinnen schroff zurück. Sie verweist darauf, dass sie fest davon überzeugt sei, dass der Sieg den Christen zufallen wird. Nach dieser direkten Rede übernimmt der Erzähler wieder die Schilderung der Handlung. In einer Prolepse weist er darauf hin, dass das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt eine Fortsetzung erfahren wird. Als Grund für die Unterbrechung nennt er den Tagesanbruch. Die Prolepse verweist auf das eigentliche Religionsgespräch, um dessen Analyse es im Kern gehen soll. Es erscheint aber sinnvoll, auf das erste, kurze Vater-Tochter-Gespräch einzugehen, weil es die eigentliche Auseinandersetzung um den wahren Glauben vorbereitet.
Auf der weltlichen Seite ihrer Argumentation gaukelt Gyburg ihrem Vater vor, dass die Niederlage Willehalm kaum beeindruckt hat, das gilt auch für die Verluste, die er hinnehmen musste. Statt sich Sorgen zu machen, nimmt Willehalm angeblich an einem Turnier teil. Gyburg beschimpft die „verdammten Sarazenen“ (W 110, 21), die sie aber auch als ihre Verwandten bezeichnet. Sie weist ihren Vater darauf hin, dass ihm und seinen Kämpfern der zweifache Tod unmittelbar bevorsteht. Sie kontrastiert diesen mit den drei Todesarten, die ihr ihr Vater angedroht hatte, offenkundig um diese als unbedeutend zu charakterisieren. Es handelt sich bei der Androhung des zweifachen Todes der Heiden um einen verbreiteten Gedanken. Der Tod der Heiden bedeutet, dass nicht nur der Leib stirbt, sondern auch die Seele, die bei gläubigen Christen das ewige Leben gewinnt. Selbst ihr Gott Tervigant, auf den später eingegangen werden wird, habe erkannt, dass die Heiden Narren seien (W 110, 29–30). Diese knappen Hinweise deuten schon an, dass Gyburg die Grundlagen und Dogmen ihres neuen Glaubens verinnerlicht hat.
Als Grundvoraussetzung für das Verständnis des Religionsgesprächs muss vorab erwähnt werden, dass die Muslime in der Literatur um 1200 grundsätzlich als Anhänger einer polytheistischen Religion betrachtet wurden. Diese irrige Auffassung ist insofern erstaunlich, als es schon seit Karl dem Großen immer wieder Kontakte zwischen Christen und Muslimen gab und bereits 1141 der Koran ins Lateinische übersetzt worden war. Die Namen der Götter stellen überwiegend ein Sammelsurium aus der griechischen und römischen Mythologie dar. Daneben gibt es aber auch Götternamen, deren Herkunft unbekannt ist. Mohammed wird in diesem Verstehenskontext nicht als Prophet, sondern als Gott eingestuft.
Gyburg versucht, ihrem Vater zu erklären, warum sie sich taufen ließ. Sie weist dabei auf zwei Aspekte hin, auf die sie sich im Verlauf des Gesprächs mehrfach beruft:
si sprach: „ich hân den touf genomen
durh den, der al die krêatiure
geschuof, daz wazzer und daz viure,
dar zuo den luft unt die erden.
der selbe hiez mich werden.
und al, daz lebehaftes ist.
solt ich Mahmeten Krist
unt den marcrâven verkiesen
unt mînen touf verliesen
(W 215, 10–18),sagte sie: „Ich hab die Taufe angenommen
um dessentwillen, der alle Kreatur
geschaffen hat, das Wasser und das Feuer,
dazu die Luft, die Erde.
Der hieß mich entstehen
und alles, was lebendig ist.
Sollt ich für Mohammed auf Christ
und den Markgrafen verzichten
und meine Taufe opfernʻ
Es geht Gyburg zunächst darum, den christlichen Gott als den überlegenen, allmächtigen Schöpfer darzustellen, der nicht nur die vier Elemente, die sie benennt, erschuf, sondern auch alle Kreaturen. Gyburg weist dabei auf einen Gesichtspunkt hin, der für ihre Argumentation auch später eine zentrale Rolle spielen wird, indem sie ausführt, dass der, der aller Kreatur das Leben gab, auch sie erschaffen hat. Gyburg baut eine Argumentation auf, der von kirchlicher Seite kaum widersprochen werden konnte. Damit macht sie, an dieser Stelle eher noch implizit, aber auch deutlich, dass selbst die Heiden Geschöpfe Gottes sind. Sie wendet sich außerdem mit der wohl rhetorisch aufzufassenden Frage an ihren Vater, ob sie für Mohammed diesen Gott, erstaunlicherweise nennt sie an dieser Stelle, gewissermaßen stellvertretend für die Trinität, Christus, den Markgrafen, ihren geliebten Ehemann, und die Taufe aufgeben solle. Mohammed wird an dieser Stelle mit Christus gleichgesetzt also als Gott aufgefasst (W 215, 16). Mohammed an der Seite von Christus, ein ungleiches Paar? Für die mittelalterlichen Rezipienten galt das eher nicht, denn in der mittelalterlichen Vorstellungswelt waren die Muslime, wie angesprochen wurde, Anhänger einer polytheistischen Religion, sie beteten dementsprechend viele Götter, häufig als Götzen bezeichnet, an, einer davon war Mohammed, der ja eigentlich nur der Prophet war, umgekehrt galt und gilt Christus den Muslimen nicht als Gott, sondern als Prophet.
Auch an der nächsten zitierten Stelle verbindet Gyburg ihre Liebe zu Willehalm mit der zum christlichen Gott, der nun als der Höchste tituliert wird:
ich was ein küniginne,
swie arm ich urbor nû sî.
ze Arâbîâ unt in Arâbî
gekroenet ich vor den vürsten gie,
ê mich ein vürste umbevie.
durh den hân ich mich bewegen,
daz ich wil armuot pflegen,
unt durh den, der der hoehste ist.
wâ vund ouch Tervagant den list,
den êrsten revant Altissimus?
(W 215, 26–216, 5),Ich war eine Königin,
wie arm an Ländern ich jetzt bin.
In Arabien und in Arabi
trug ich Krone vor den Fürsten,
eh ein Fürst mich nahm.
Für diesen hab ich mich entschlossen,
arm zu sein,
und für jenen, der der Höchste ist.
Woher auch nähme Tervagant die Kunst,
die Altissimus erfand?ʻ
Gyburg gab für ihre Liebe ihre mächtige Position als Königin auf. Sie bezeichnet sich selbst als arm. Die Betonung der Armut wird zu einem zentralen Aspekt. Diese Armut nimmt sie zwar, wie angesprochen, für Willehalm auf sich, aber eben auch für den christlichen Gott. Durch diesen Hinweis lässt sich ein Bezug zum religiösen Ideal der ʻimitatio Christiʻ, der Nachfolge des armen Christus, herstellen. Das Motiv der Armut gehört, wie angedeutet, zu den wiederkehrenden Aspekten, die Gyburg anspricht, es handelt sich um einen der wichtigsten Gedanken in ihren Ausführungen. Ob dieser Gedanke notwendigerweise, wie es in der Forschung geschah, als ein Reflex der franziskanischen Gesinnung zu sehen ist, lässt sich schwerlich nachweisen. Da ansonsten spezifisch franziskanische Züge in Gyburgs Ausführungen nicht zu erkennen sind, erscheint diese Zuordnung eher fraglich. Das Armutsideal darf als solches zu den Grundgedanken des christlichen Lebens gezählt werden, weshalb eine genauere Zuschreibung, zumal unter den dargelegten Voraussetzungen, nicht vorgenommen werden sollte.
Gyburg zieht zum Vergleich mit dem christlichen Gott Tervagant heran. Dieser Name, mit leicht schwankenden Graphien, ist auch aus anderen Zusammenhängen bekannt, ohne dass klar wäre, woher der Name kommt. Der Name darf in aller Regel als Bezeichnung für den höchsten heidnischen Gott aufgefasst werden, der christliche Gott wird also zum höchsten heidnischen in Beziehung gesetzt. Gyburg macht mehr als deutlich, dass Tervagant nicht annähernd die Machtfülle hat wie der christliche Schöpfergott. Unterstrichen wird dies formal, indem die Bezeichnungen für den christlichen Gott im Vers vor und im Vers nach der Nennung des heidnischen Gottes vorkommen und beide Male durch einen Superlativ zum Ausdruck gebracht werden. Dass mit dieser formalen Komponente eine inhaltliche Abwertung des heidnischen Gottes einhergeht, wurde bereits angedeutet, inhaltlich tatsächlich zum Ausdruck gebracht wird sie durch eine, nach Spott klingende, wieder nur als rhetorisch gemeint aufzufassende Frage, die das Bild vervollständigt (W 216, 4–5).
Im Folgenden betont Gyburg weiter die Allmacht Gottes, wobei sie jetzt auf das Firmament zu sprechen kommt. Zunächst erwähnt sie den „Pôlus antarticus“ (W 216, 6), eigentlich „Pôlus antarcticus“, ein Südpolarstern als Gegenstück zum tatsächlich existierenden Polarstern im Norden. Es handelt sich um einen fiktiven Stern, der in der mittelalterlichen Astronomie postuliert wurde. Die Erwähnung dieses Sterns dokumentiert zweifelsohne zusätzlich das Niveau der Argumentation Gyburgs, es zeigt aber schlussendlich auch die Bildung des Autors, der hinter den Ausführungen steht. Den soeben besprochenen, erfundenen Stern und die generisch angesprochenen sieben Planeten, tarierte Gott alle zu einem harmonischen Gebilde aus, das ewigen Bestand hat. Der Verweis auf die Erschaffung der Gestirne ist ebenso traditionell, wie dass darauf der Verweis auf die Winde und die Gewässer folgt. Eingeleitet wird dieser durch eine Frage, die sicher wieder als rhetorisch aufzufassen ist. Gyburg formuliert: Sind eure Götter dem gleich, der die Winde beherrscht, die Quellen sprudeln lässt, und der der Sonne „dreierlei Natur“ (W 216, 20) gab. Sie bringt die Wärme, das Leuchten zur Sprache, besonders aber scheint der Hinweis zu sein, dass die Sonne in Bewegung ist und dadurch den Wechsel von Tag und Nacht bringt. Traditionell findet als dritte Natur die Feurigkeit Erwähnung. Der Hinweis darauf, dass die Sonne das Licht nimmt und bringt (W 216, 23), rekurriert auf das damalige geozentrische Weltbild, bei dem die Erde als Mittelpunkt verstanden wird, um den die Sonne sich dreht. Sich für diesen allmächtigen Gott in die Waagschale zu werfen, scheint Gyburg ein Leichtes. Sie glaubt fest daran, dass er sie für allen Schaden entschädigen wird, er wird darüber hinaus aus der Armut des Leibes den Reichtum der Seele machen. Erneut ist damit von der bereits eingeführten und als wiederkehrendes Motiv angesprochenen Armut die Rede.
Der Rest ihrer Ausführungen bezieht sich auf die ungerechtfertigten Forderungen Tybalts und beinhaltet Vorwürfe, die Gyburg an ihren Vater richtet. Sicher ließen sich bei dem Zusammengefassten einige Aspekte vertiefen, aber es sollen nur die zentralen Argumente Gyburgs und die wichtigsten Gesichtspunkte der Erwiderungen ihres Vaters eine Rolle spielen.
Schon in Terramers erster Erwiderung wird der innere Zwiespalt des liebenden Vaters deutlich zum Ausdruck gebracht. Er beteuert seiner Tochter gegenüber, dass er sie liebt. Was ihn veranlasste, seinen Schwiegersohn zu unterstützen und Gyburg zu drohen, war kein Hass auf seine Tochter. Es war auch nicht die Bitte seines Schwiegersohns, es war vielmehr die Angst, sündenbeladen zu sterben. Terramer hat, so versichert er, Gyburg als Tochter nicht aufgegeben. Festzuhalten ist, dass Terramer seine Tochter im vorliegenden Zusammenhang tatsächlich mit ihrem christlichen Namen, Gyburg, anspricht, ansonsten nennt er sie nach ihrem heidnischen Namen Arabel. Dies ist zwar bemerkenswert, allerdings ist nicht greifbar, welche Intention, falls überhaupt eine, dahintersteht. Möglicherweise liegt schlicht ein Versehen des Schreibers der Leithandschrift vor? Die Mehrzahl der Handschriften zeigt den heidnischen Namen. Bei dem, was Terramer äußert, handelt es sich um einen der Kerngedanken der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Heiden. Einen Andersgläubigen zu töten, um damit die eigenen Sünden zu tilgen, gehört zu den immer wiederkehrenden Aussagen der Kreuzzugspropagandisten. Dieser Gedanke dürfte den Rezipienten demnach geläufig gewesen sein, allerdings aus einer anderen, der christlichen Perspektive. Die Generalabsolution für die Teilnahme an einem Kreuzzug beinhaltet auch, dass die Teilnehmer für die Befreiung des Heiligen Landes und damit einhergehend die Tötung von Muslimen, aller Sünden ledig sein werden.
Insgesamt ist bemerkenswert, dass Terramer in seiner ersten Antwort auf die Ausführungen Gyburgs im Grunde auf deren Argumente nicht eingeht, er schildert vielmehr seinen Zwiespalt, er ist liebender Vater aber eben auch ein Sünder, der sich durch die Verteidigung seines Glaubens reinwaschen will. Die Darstellung dieses inneren Konflikts gehört zu den herausragenden Leistungen des Autors.
Gyburg wendet sich nach der Erwiderung ihres Vaters dem Sündenfall zu. Eva bedeckte aus der von Gott verursachten Scham ihre Brust, in der die Ursache dafür wohnte, dass sie durch die Verlockungen des Teufels schwach wurde. Bei der Entdeckung der Nacktheit und der daraus resultierenden Scham handelt es sich um ein allseits bekanntes Motiv. Der Teufel stellt auf Grund der Verführbarkeit Evas den Menschen nach. Dies ist aber nur eine der möglichen Deutungen dafür, dass der Teufel den Menschen nachstellt. Um eine weitere anzuführen, sei darauf verwiesen, dass Luzifer, der anmaßende Vertreter des 10. Engelchors, der aus dem Himmel vertrieben und durch die Erschaffung des Menschen ersetzt wurde, die Menschen deshalb aus Neid verfolgt. Gyburg erwähnt an dieser Stelle auch Platon und Sibylle, die als Weissager angesprochen werden, ohne jedoch auf die folgende Argumentation zu verweisen. Möglicherweise handelt es sich um einen Reflex der weit verbreiteten Legende von der heiligen Katharina.
Eva wurde schuldig, aber auch Adam wurde bestraft! Hier greift Gyburg einen Aspekt auf, der in der zeitgenössischen theologischen Diskussion einen großen Stellenwert einnahm. Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang nicht die Entscheidung, wer die Schuld trug, die im Mittelalter zu Ungunsten Evas ausfiel, sondern die Tatsache, dass implizit die Frage, warum auch Adam bestraft wurde, angesprochen wird, denn dies verweist darauf, dass die einschlägige, scholastische Diskussion dem Autor bekannt war, und er sie der Heidin Gyburg in den Mund legte:
Eve al eine schuldic wart,
dar umbe die helleclîchen vart
Adâmes geslehte vuor iedoch.
(W 218, 15–17).,nur Eva wurde schuldig,
doch mußte dafür
das Geschlecht Adams in die Hölle fahren.ʻ
Ungeachtet der Tatsache, dass dies sicher auch im Bewusstsein des Autors und seiner Rezipienten gegenwärtig war, könnte auch ein anderer Gedanke eine Rolle gespielt haben. Vielleicht sieht Gyburg eine gewisse Parallele zwischen sich und Eva, auf die verwiesen werden könnte. Wie Eva die Schuld am Sündenfall und den Folgen trug, so ist Gyburg diejenige, die durch ihre Entscheidung den Krieg verursacht hat. Ähnlich wie Adam ist zwar auch Willehalm nicht frei von Schuld, aber Gyburg sieht sich wahrscheinlich als diejenige, der die Hauptschuld am Krieg und am Sterben zufällt.
Ihre weitere Argumentation führt zielgerichtet zur Erlösung aus der Hölle und zur Trinität. Gyburg erwähnt dabei, dass nur Elias und Henoch der Weg in die Hölle erspart blieb, beide wurden von Gott entrückt, das heißt, sie starben nicht, sondern wurden von Gott bei lebendigem Leib zu sich geholt. Alle anderen Menschen mussten bis zum Erlösungs- oder Opfertod Christi den Weg in die Hölle gehen. Mit dieser Aussage fußt Gyburg auf der Vorstellung, dass Christus nach seinem Kreuzestod in die Hölle hinabstieg und deren Pforten sprengte, wodurch er die Seelen der Gerechten befreite. Nicht einzigartig, aber doch eine besondere Variante liegt an dieser Stelle insofern vor, als nicht Christus allein die Pforten sprengte, sondern die Trinität insgesamt dies vollbrachte. Allerdings muss beachtet werden, dass Gyburg sehr nachdrücklich auf die Einheit der drei göttlichen Gestalten hinweist, sie insistiert geradezu auf dieser Einheit. Sie betont auch, dass der Sohn Gottes sich nur ein einziges Mal zur Erlösung der Menschen opfert, eine Wiederholung wird es nicht geben:
wer was, der si lôste dan
unt der die sigenunft gewan,
daz er die helleporten brach,
unt der Adâmes ungemach
erwante? daz tet diu Trînitât!
der sich einen selben dritten hât,
ebengelîch unt ebenhêr,
sich: der enstirbet nimmer mêr
durh man noch wîbes schulde.
nû wirp um dessen hulde!“
(W 218, 21 – 30).,Wer hat sie davon erlöst
und den Sieg errungen,
daß er die Höllenpforten brach,
und der Adams Leid
beendet? Das tat die Trinität!
Der Einer ist und dabei Drei,
ganz gleich und gleichermaßen heilig,
sieh: der stirbt nie wieder
für die Schuld der Menschen.
Bemüh dich drum um seine Huld!“ʻ
Wenngleich dies nicht thematisiert wird, sei als erklärender Hinweis angefügt, dass der Opfertod Christi heilsnotwendig war, weil die Sünden, die die Menschen begangen hatten, so immens waren, dass sie diese selbst nicht hätten tilgen bzw. durch Buße hätten vergelten können. Um diese Sünden zu tilgen, war es heilsnotwendig, dass Christus als Sohn Gottes starb. Diese Form der Sündentilgung, dies wurde bereits betont, ist ein einmaliger Akt.
Terramer begegnet den Ausführungen Gyburgs mit Spott. Er wirft die Frage auf, warum Christus durch die Trinität nicht gerettet wurde. Er zieht die jungfräuliche Geburt in Zweifel und weist die Aussage, dass Christus die Höllenpforten zerbrochen habe, mit dem Hinweis darauf zurück, dass dieser für eine solche Tat zu schwach gewesen wäre. Terramer schildert, um seine Ansicht zu untermauern, seine Kenntnisse von den Höllenqualen, die auf den Offenbarungen seiner Götter beruhen. Er schließt mit dem verzweifelt klingenden Resümee:
waz ist an mir gerochen
mit dem ungelouben dîn?
bekêre dich, liebiu tohter mîn!“
(W. 219, 20-22).,was wird an mir gestraft
mit deinem Aberglauben?
Bekehr dich, liebe Tochter!“ʻ
Gyburg erwidert, indem sie zunächst auf die zweifache Natur von Christus hinweist, der als Mensch den qualvollen Tod am Kreuz starb, dessen göttliche Natur jedoch davon unbeschadet weiterlebte, indem der Mensch Christus starb, konnte Christus als Gott leben:
„ich hoere wol, vater, ez ist dir leit.
dô Jêsus mennischeit
der tôt an dem kriuze müete,
innen des sîn leben blüete
ûz der gotlîchen sterke.
lieber vater, nû merke:
innen des unt diu mennischeit erstarp
diu gotheit ir daz leben erwarp.
(W 219, 23 – 30),„Ich hör, daß es dir leid ist, Vater.
Als Jesu menschliche Natur
der Tod am Kreuz gequält hat,
da blühte doch sein Leben auf
aus der Gottesstärke.
Lieber Vater, mach dir klar:
indem der Mensch gestorben ist,
errang der Gott das Leben.ʻ
Ein Reflex dieser Auffassung stellt die heute noch von den Christen gefeierte Himmelfahrt dar. Christus fährt in menschlicher Gestalt aber als Teil der Trinität zu seinem Vater auf in den Himmel.
Nach diesem Hinweis wendet sich Gyburg dem zweiten Grund zu, der sie davon abhält, zurückzukehren: die Liebe zu ihrem Ehemann Willehalm. Was nun geschildert wird, hat nur noch wenig mit einer Auseinandersetzung um den Glauben zu tun, es trägt aber erheblich zum Textverständnis bei, weshalb es in aller Kürze angedeutet werden soll. Die Rezipienten erfahren jetzt, wie und wodurch sich Gyburg und Willehalm kennen und lieben gelernt haben. Gyburg selbst hat den in Gefangenschaft geratenen Willehalm befreit und ist mit ihm in christliche Gefilde gezogen. Auch diesen Argumentationsfaden schließt Gyburg mit einer Hinwendung zum Glauben: ich diente im und der hoesten hant. (,Ihm dient ich und der Höchsten Hand.ʼ; W 220, 30), was sie tat, tat sie für Willehalm aber eben auch für Gott. Von ihrem christlichen Glauben wird sie sich nicht abbringen lassen, auch dann nicht, wenn sie dafür Verzicht üben muss. Sie äußert Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Ehemann, der ungerechtfertigte Forderungen hinsichtlich ihres und seines Erbes erhebt, auch ihren Vater bezieht sie in die Vorwürfe mit ein, schließlich bilanziert sie:
mahtû Todjerne, mîn erbeteil,
Tîbalde und Ehmereize geben,
und lâze mich mit armuot leben!“
(W 221, 24–26).,Gib doch Todjerne, das ich erbte,
dem Tibalt und dem Emereiß
und laß mich in Armut leben!“ʻ
Gyburg ist also sogar bereit, auf ihr zustehendes Erbe zu verzichten. Wieder spielt sie auf die Armut an, die sie bereit ist, für ihren Glauben auf sich zu nehmen.
Literaturgeschichtlich von Interesse sind innerhalb der angesprochenen Vorwürfe, dies nur als Hinweis, die Bezüge zum ,Rolandsliedʼ (W 221, 11–19). Diese Bezüge können hier nicht weiterverfolgt werden, es gilt aber dennoch zu betonen, dass Wolfram das angesprochene Werk nicht nur kannte, wodurch die Hinweise auf seine Bildung und seine Kenntnisse ergänzt werden, sondern bei seinen Rezipienten ein entsprechendes Wissen unterstellte, denn ohne ein solches würden Gyburgs Ausführungen ins Leere laufen. Solche intertextuellen Bezüge sind Mosaiksteinchen bei den Versuchen, zu verstehen, wie es einen „Literaturbetrieb“ geben konnte, und wie er funktionierte in Zeiten eines Analphabetentums von 90 bis 95%. Sie zeigen aber auch allgemein die Dynamik mittelalterlicher, literarischer Texte auch epischen Umfangs, deren Inhalt nicht allein durch das Medium der Schrift verbreitet wurden.
Fazit zum Religionsgespräch
Es konnte und sollte bei der Vorstellung des Inhalts des eigentlichen Religionsgesprächs, und diese Feststellung gilt auch für die Analyse der Rede Gyburgs im Fürstenrat, auf die noch eingegangen werden wird, nicht darum gehen, die Quellen der Aussagen im Einzelnen und systematisch zu erörtern, weil es in diesem Bereich immer noch kontroverse Ansichten gibt. Diese im Detail nachzuverfolgen, ist zwar denkbar, würde aber das Ziel, den Text zunächst möglichst durch eine an ihm selbst orientierte Analyse verstehen zu wollen, überfrachten. Summarisch kann festgehalten werden, dass Wolfram eine ganze Reihe wesentlicher Texte aus dem Bereich der theologischen und der apologetischen Tradition kannte. Ob seine Kenntnisse auf volkssprachliche Texte beschränkt waren, ist schon Teil der Kontroverse und soll, entsprechend dem Gesagten, nicht weiterverfolgt werden. Sollte es eindeutige Quellenzuweisungen geben, werden bzw. wurden diese angeführt. Dies gilt, um ein Beispiel zu nennen, für die Feststellung, dass Wolfram das ,Rolandsliedʻ sicher kannte und Bezüge dazu herstellte. Eher implizit lässt sich die Kenntnis der ,Kaiserchronikʻ nachweisen, die Wolfram benutzte, genauer ist damit der Disput innerhalb der ,Silvesterlegendeʻ gemeint.
Die Allmacht Gottes, das Armutsideal als ‚imitatio Christiʻ dürfen als Kernthemen bezeichnet werden. Es fällt besonders bei diesem Aspekt die Verbindung, das Nebeneinander von Christus und dem Markgrafen auf, die religiöse und die weltliche Liebessphäre werden fast ineinander verwoben. Dieses Miteinander sollte als Ausdruck der Lebenserfahrung Gyburgs gewertet werden. Wichtig sind aber auch die Auseinandersetzung mit der Trinität, die jungfräuliche Empfängnis und Geburt Christi sowie dessen Opfertod, der einmalig ist, die zwei Naturen Christi, dessen menschliche Natur stirbt, der aber als Gott weiterlebt und zum Vater in den Himmel auffährt. Das wirklich Besondere ist, dass die Argumente von einer Frau artikuliert werden, noch dazu von einer getauften Heidin. Es handelt sich um eine wesentliche Erweiterung der Frauenrolle!
Terramers Gegenargumente sind von einem latenten Spott getragen. Er macht sich lustig über die Dreieinigkeit, die Tatsache, dass es für Christus keine Rettung gab, er formuliert das Unverständnis dafür, dass ein Gott stirbt, moniert die jungfräuliche Empfängnis und Geburt, und betont die Schwäche Jesu. Es handelt sich bei den Äußerungen Terramers weitgehend um in der Zeit gängige Standardargumente, die gegen den christlichen Glauben artikuliert wurden. Das Unverständnis für die Mysterien der christlichen Dogmatik diskreditiert im Grunde schon Terramers Argumentation, er kann kaum angemessen auf Gyburgs Aussagen reagieren, deren überlegene Sichtweise mehr als deutlich zu Tage tritt.
Die Rede im Fürstenrat — die Toleranzrede
Wir machen einen Sprung. Nach dem Festmahl, vor dem Aufbruch zur zweiten Schlacht wird eine Fürstenversammlung einberufen. Zum Hintergrund ist anzumerken, dass Willehalm die französischen Fürsten geladen hatte. Er hält zu Beginn eine Rede, die die Heerführer zum Kampf anstacheln soll. Er berichtet von Greueltaten der Heiden. Es handelt sich, dies zu betonen ist wichtig, um eine Hassrede. Danach ergreifen andere Fürsten das Wort. Das Fazit des Erzählers lautet: „Rache stand wider Rache“ (W 305, 30). In dieser Stimmung ergreift Gyburg das Wort und hält eine der längsten Reden des gesamten Werkes (W 306, 3–310, 29). Sie ruft Gott als Zeugen, er möge es vergelten, wenn sie am großen Sterben schuldig sei.
Es scheint sich zunächst nichts zu ändern, Gyburg fordert von den französischen Fürsten den Kampf für das Ansehen des Christentums und Rache für den Tod von Vivianz, ihren Ziehsohn, an ihren Verwandten, vor deren Gegenwehr sie geradezu warnt. Der Tenor der vorangegangenen Reden scheint sich fortzusetzen:
die roemischen vürsten ich hie man,
daz ir *kristenlîch êret mêret.
ob iuch got sô verre *gêret,
daz ir mit strîte ûf Alischanz
rechet den jungen Vivianz
an mînen mâgen und an ir her
(die vindet ir mit grôzer wer),
(W 306, 18–24),Die römischen Fürsten hier ermahn ich:
mehrt das Ansehn des Christentums!
Erweist Gott die Ehre,
daß ihr im Kampf auf Alischanz
rächt den jungen Vivianz
an meinen Verwandten und ihrem Heer
(ihr werdet sie wehrhaft finden),ʻ
Dann aber die Wende:
und ob der heiden schumpfentiur ergê,
sô tuot, daz saelekeit wol stê:
hoeret eines tumben wîbes rât,
schônet der gotes hantgetât!
ein heiden was der êrste man,
den got machen began.
(W 306, 25–30),und wenn die Heiden unterliegen,
dann handelt so, wie es das Heil des Christentums
erfordert! Hört auf die Lehre einer ungelehrten Frau:
schont die Geschöpfe aus Gottes Hand!
Ein Heide war der erste Mensch,
den Gott erschuf.ʻ
Das zweite Zitat birgt bereits eine ganze Reihe wichtiger Gedanken, die in der Forschung für viel Diskussion sorgten. Gyburg geht von dem Fall aus, dass die Heiden im Kampf unterliegen. Was sie im Folgenden ausführt, steht also unter der Voraussetzung, dass die Christen als Sieger aus der Schlacht hervorgehen. Gyburg stellt das, was sie vorzutragen gedenkt, aber zusätzlich unter eine Maxime, denn sie unterstellt, dass das Befolgen ihrer Ausführungen das Heil des Christentums mit sich bringt. Den unterschiedlichen Interpretationen des angesprochenen Verses (W 306, 27) scheint gemeinsam, dass es bei dieser Aufforderung darum geht, dass die Christen sich als solche erweisen, sei es nun, um damit Gott zu ehren oder ihr eigenes Seelenheil nicht zu gefährden.
Bevor sie darauf eingeht, worin die entsprechende Handlungsweise besteht, kommt es zu einer viel beachteten Selbsteinschätzung Gyburgs: hoeret eines tumben wîbes rât (,hört auf die Lehre einer ungelehrten Frau:ʼ; W 306, 27). Die „ungelehrte“ Frau wird im Folgenden theologisch argumentieren, und zwar auf der Höhe des theologischen Diskurses der Zeit! Eine unterschiedlich beantwortete Frage ist, wie tump übersetzt werden sollte, „ungelehrt“ ist nur eine Möglichkeit, alternativ wurden vorgeschlagen „unerfahren, schlicht, schwach“, diese Übertragungen würden gut zum allgemein negativen Frauenbild der Zeit passen. Die Übersetzung „ungelehrt“ fokussiert dagegen deutlich den Kontrast zwischen der Aussage und dem, was an Ausführungen folgt. Ob darin auch ein Zeugnis laikalen Selbstbewusstseins gesehen werden muss, sei dahingestellt, wichtiger ist die Absicht, die Wolfram mit der Formulierung verband. Es ging Wolfram wohl darum, sich gegen theologische Kritik abzusichern. Das bedeutet, es handelt sich also um eine Form des Selbstschutzes. Was allerdings neben all diesen Erwägungen nicht außer Acht geraten sollte, ist die bereits formulierte Feststellung, dass sich das Nachfolgende auf der Höhe der theologischen Diskussion der Zeit bewegte. Damit kann auf die Bildung des Autors geschlossen werden, und es ergibt sich erneut ein Rückverweis auf die Ausführungen zu Wolfram und seiner Selbstdarstellung.
Unmittelbar an die Aussage zu ihrer Person schließt sich das berühmte „Schonungsgebot“ an: schônet der gotes hantgetât (,schont die Geschöpfe aus Gottes Handʼ; W 306, 28). Das Schonen angesichts der unmittelbar bevorstehenden, kriegerischen Auseinandersetzung darf nicht als Aufruf zum Pazifismus missverstanden werden. Dies belegen allein schon die davorliegenden Äußerungen. Was Gyburg jetzt formuliert, steht, wie bereits gesagt, unter der Voraussetzung, dass die Heiden im Kampf unterliegen! Es geht also um das Verhalten während, mehr noch aber nach dem Kampf. Gemäß der Kreuzzugsideologie galt es, die Heiden niederzumetzeln, abzuschlachten wie Vieh, ohne jegliche Rücksicht, wie es etwa im schon erwähnten ,Rolandsliedʼ dargestellt wird. Genau dies will Gyburg aber verhindern. Das Nachfolgende, dies gilt es unbedingt zu beachten, bezieht sich auf die Zeit nach der Schlacht. Es geht dementsprechend um die Vermeidung unnötiger Grausamkeiten und die Tötung von schon Besiegten, in anderen Worten um die Verhältnismäßigkeit. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Forderung eigentlich ein Teil des ritterlichen Verhaltenskodexes ist, der aber hier weder angesprochen wird noch für die Kämpfe gegen die Heiden zu gelten scheint. Daher verweist Gyburg darauf, dass auch die Heiden Geschöpfe aus der Hand Gottes sind. Da alle Wesen aus dessen Hand stammen, kann das auch durch die katholische Lehre nicht angezweifelt werden.
Gyburgs Hinweis will aber mehr besagen als diese Banalität, sie scheint mit ihrer Aussage auf die Sonderstellung der Menschen innerhalb der Schöpfung anzuspielen. Gott schuf den ersten Menschen mit seinen Händen. In der Forschung wurde darauf hingewiesen, dass dieses „mit seinen Händen“ einen Unterschied zum Rest der Schöpfung ausmacht, denn sonst schuf Gott durch Befehle: er sprach, es werde (…). Wird unterstellt, dass dies den Rezipienten bewusst war, könnte weiter argumentiert werden, dass das Töten eines Menschen ein gegen Gott gerichteter Frevel ist. Zumindest dieser Gedanke war, wenngleich die ihm zu Grunde liegende Feststellung bezüglich der Divergenz im Schöpfungsbericht eher nicht in der angenommenen Weise präsent gewesen sein dürfte, bei den Rezipienten durch die 10 Gebote sicher verankert, dass dieser Gedanke im Folgenden geschickt auf die Heiden ausgedehnt wird, darf und sollte durchaus als eine Erweiterung dieser Vorstellung gewertet werden. Die Aussage jedoch, dass der erste Mensch, Adam, den Gott schuf, ein Heide war, kann die Bedenken hinsichtlich der gedanklichen Präsenz der Unterscheidung durch Befehl erschaffen versus durch die Hände auf Seiten der Rezipienten, nicht aus dem Weg räumen. Die Anmerkung, dass das zu beobachtende Vorgehen als geschickt zu bezeichnen ist, bezieht sich darauf, dass die Argumentation Gyburgs so aufgebaut ist, dass sie zumindest zunächst keinen Widerspruch erlaubt. Mit der Feststellung, dass Adam Heide war, beginnt Gyburg eine Aufzählung alttestamentarischer Gestalten, die nach christlicher Auffassung Heiden waren.
Nach Adam werden genannt: Elias und Enoch, die, was sich als wichtig erweisen wird, stets zusammen Erwähnung finden, Noah, der Erbauer der Arche, Hiob und schließlich die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior, Balthasar. Im Text wird Balthasân (W 307, 9) verwendet, was auffällig aber durch die Überlieferung gesichert ist. Die Auswahl scheint sich bewusst an der im Mittelalter geläufigen Dreiteilung der Menschen in Heiden, Juden, Christen zu orientieren. Dies anzunehmen, erlauben die weiteren Ausführungen Gyburgs. Mit Abraham beginnt der ‚Alte Bund‘ zwischen Gott und dem von ihm erwählten Volk, signifikantes Merkmal für das mit Abraham beginnende Judentum ist die Beschneidung, auf die noch einzugehen sein wird. Einen kleinen Makel hat der Hinweis auf die Dreiteilung jedoch, denn Elias ist Jude. Dieser, wenn es so zu nennen ist, Fehler basiert höchstwahrscheinlich auf dem angesprochenen Usus, Elias und Enoch stets gemeinsam zu nennen, ein Reflex ihrer Funktion als Bekämpfer des Antichristen, sie sollen die Menschen auch vor ihm warnen. Eine Sonderstellung nehmen sicher auch Kaspar, Melchior und Balthasar ein, deren Gaben got (W 307, 12) an der Brust der Mutter empfing. All das, was sie anführte, kann, so schlussfolgert Gyburg, nur bedeuten, dass nicht alle Heiden verdammt sind:
got selb enpfie mit sîner hant
die êrsten gâbe ane muoter brust
von in. die heiden hin zer vluht
sint alle niht benennet.
(W 307 12–15).,Mit seiner Hand nahm Gott
noch an der Mutterbrust die ersten Gaben
an von ihnen. Nicht alle Heiden
sind verdammt.ʻ
Aber damit nicht genug, im nächsten Argumentationsschritt rückt Gyburg näher in das Umfeld der Rezipienten, denn sie fährt fort, indem sie auf die christlichen Mütter eingeht, die ungeachtet der Tatsache, dass sie Christinnen sind, seit Evas Zeiten ein heidnisches Kind gebären (W 307, 17–22). Ohne Taufe ist der Säugling ein Heide. Die Frage ist, sind diese Säuglinge verdammt? Aus dem Text ließe sich auf die Feststellung verweisen, dass nicht alle Heiden verdammt sind. Gilt diese Feststellung nur für die Gestalten, die vor dieser Aussage von ihr erwähnt wurden oder auch für die danach angesprochenen Säuglinge? Die zuletzt angeführte Auffassung erscheint überaus wahrscheinlich und würde auch der Lehrmeinung entsprechen, dass den ungetauften Säuglingen, obwohl sie Heiden sind, durch die christliche Mutter Gnade vermittelt wird. Es wurde bereits auf die Dreiteilung der Menschen (Heiden – Juden – Christen) hingewiesen, auf die Gyburg oben implizit rekurriert. Diese wird nun manifest. Gyburg thematisiert die „andere Taufe“ der Juden, die Beschneidung, die der verbreiteten theologischen Lehrmeinung gemäß als Parallele zur christlichen Taufe aufzufassen ist.
Was bisher an Aussagen angesprochen und analysiert wurde, ist aus theologischer Sicht durchaus anspruchsvoll und zeugt von gründlichen Kenntnissen seitens des Autors, aber es handelt sich gleichwohl um Ausführungen, die von Theologen im Grunde nicht angegriffen werden können, sie fußen auf den theologischen Lehrmeinungen der Zeit. Für die folgenden Verse gilt dies aber möglicherweise nicht. Die nachfolgend zitierte Textstelle wurde vielfach und vor allem auf unterschiedliche Weise analysiert bzw. interpretiert:
dem saeldehaften tuot vil wê,
ob von dem vater sîniu kint
hin zer vlust benennet sint:
er mac sich erbarmen über sie,
der rehte erbarmekeit truoc ie.
(W 307, 26–30),Wer im Heil ist, leidet
unter dem Gedanken, daß der Vater seine Kinder
zum Verlust der Seligkeit verdammt:
es steht in seiner Macht, sich ihrer zu erbarmen,
der zu allen Zeiten wahre Barmherzigkeit besaß.ʻ
Den Kern der wissenschaftlichen Auseinandersetzung liefert die Formulierung „der Vater seine Kinder“ (W 307, 27). Es gibt eine teilweise fast sophistisch zu nennende Forschungsdiskussion um zwei Wörter bzw. deren Interpretation: Vater und Kinder. In welchem Sinne ist von Vater die Rede, wer ist gemeint? Wer sind die Kinder, wie ist ihr Verhältnis zum – wie auch immer zu deutenden – Vater?
Die erste grundsätzliche Frage, die mit Bezug auf das Wort Vater aufgeworfen wurde, lautet: Handelt es sich um einen menschlichen Vater, sei er heidnisch, jüdisch oder christlich? Eine Erörterung dieser These erscheint aus theologischer Sicht kaum interessant. Anzunehmen, dass statt von Gott nun plötzlich von einem Menschen in der Position des Vaters gesprochen wird, darf als wenig plausibel eingestuft werden, weshalb diesem Gedanken auch keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Es sollte davon ausgegangen werden, dass mit Vater der christliche Gott gemeint ist. Vor dem Hintergrund dieser Grundannahme lassen sich hinsichtlich der Interpretation zwei gegensätzliche Ausrichtungen festlegen: Die erste versucht, Gyburgs Aussagen so zu interpretieren, dass sie vom theologischen Standpunkt aus betrachtet unbedenklich, unangreifbar, aus kirchlicher Sicht also korrekt sind; die zweite nimmt auf diesen Aspekt keine Rücksicht.
Eine Interpretation im Sinne der zuerst angesprochenen Position geht von der Annahme aus, dass gotes hantgetât (W 306, 28) und kint (W 308, 27) zwei verschiedene Personengruppen meinen. Während gotes hantgetât alle Menschen einschließt, soll es sich bei kint um einen engeren Kreis handeln. Mit kint seien nur die Kinder von Christen gemeint, die vor der Taufe starben. Wenn diese tatsächlich zur Verdammnis bestimmt sein sollten, wäre das für die Christen ein wahrhaft schmerzlicher Gedanke, wobei die folgenden Verse die grundsätzliche Möglichkeit der Rettung durch göttliches Erbarmen als Möglichkeit nennen. Auch der Interpretationsansatz, Gyburg würde mit ihren Ausführungen die Möglichkeit ins Spiel bringen, dass Gott durch die Macht seiner wahren Barmherzigkeit in der Lage ist, Heiden zu Einsicht und Bekehrung zu führen, kann angesichts des Endes des Werkes, das gerade nicht die Bekehrung der Heiden thematisiert, kaum überzeugen.
Eine geradezu sophistisch zu nennende Interpretation (siehe den obigen Hinweis), die jeglichen Sinn für die Rezipienten und die Rezeptionssituation vermissen lässt, unterstellt, dass Gyburg zwar unbedenklich vom Vater aller Menschen, sogar aller Dinge sprechen konnte, dies aber nur im Sinne des Schöpfers, wohingegen Vater im eigentlichen Wortsinn an der hier zu interpretierenden Textstelle ausschließlich auf die Vaterschaft für die Christen zu beziehen sei. Auch wenn sich diese Differenzierung biblisch und durch Texte zeitgenössischer Exegeten untermauern lässt, bleibt die Frage, um die es ja eigentlich gehen sollte, hat Wolfram diesen Gedankengang intendiert, und mehr noch, wurde er von seinen Rezipienten so verstanden? Die Antwort auf diese Fragen kann nur negativ ausfallen. Auch die auf dieser Interpretation aufbauende Aussage, dass der Wortlaut des Textes keinen Anhaltspunkt dafür bietet, dass statt einer Hoffnung auf Bekehrung eine Hoffnung auf Erlösung in den Raum gestellt wird, missachtet das Verhalten Willehalms am Ende des unvollendeten Werkes, denn es geht ganz offenkundig nicht um Bekehrung! Willehalm gestattet, dass die getöteten heidnischen Könige, dies wurde oben schon angesprochen, nach heidnischem Ritus bestattet werden, und er lässt darüber hinaus die noch lebenden Heiden abziehen, statt sie, wie es gemäß der Kreuzzugsideologie zu erwarten wäre, niederzumetzeln oder zu zwingen, den christlichen Glauben anzunehmen. Es geht im ,Willehalmʻ nicht um Missionierung oder um Bekehrung, ob Willehalm seinen heidnischen Verwandten und weitergehend den Heiden allgemein die Erlösung wünscht, diese für sie als Möglichkeit in Betracht zieht, ist damit allerdings nicht gesagt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch darauf, dass in der volkssprachigen Literatur, wenngleich etwas später, durchaus davon die Rede ist, dass Gott dreierlei Kinder hat: Christen, Juden und Heiden!
Der zweite angesprochene Interpretationsansatz geht davon aus, dass mit Vater Gott gemeint ist und mit den Kindern alle Menschen. Dementsprechend scheint Gyburg die Gotteskindschaft auch für die Heiden in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, dass auch für die Heiden zumindest eine potenzielle Erlösbarkeit unterstellt wird, das wäre eine Parallele zu ihren Ausführungen zu gotes hantgetât. Grundlage der Erlösbarkeit ist dabei die Menschwerdung Christi und die mit ihr verbundene Erlösung der Menschen. Dazu gehört auch die bereits angesprochene Macht der immerwährenden Barmherzigkeit. Die Unterscheidung, dies ist implizit schon angeklungen, zwischen gotes hantgetât und kint wird durch sie hinfällig. Wird diese Interpretation zu Grunde gelegt, dann verlässt Gyburg mit ihren Äußerungen den Boden der kirchlichen Lehre, was sie sagt, wird angreifbar. Die allgemein akzeptierte Auffassung, dass Wolfram Gyburg sagen lässt, dass das Nachfolgende der Rat einer ungelehrten oder törichten Frau sei, um sich vor Kritik vielleicht sogar Schlimmerem zu schützen, geht ins Leere, wenn Wolframs Darstellung sich auf theologisch, kirchlich abgesichertem Terrain bewegt, das er, wie mehrfach betont, kennt. Die mit dieser Festlegung verbundenen Ansätze sind zwar denkbar insgesamt aber wenig befriedigend. Das wird anders, wenn, wie gerade geschehen, davon ausgegangen wird, dass Gyburgs Aussagen nicht mehr auf dem Boden einer theologisch korrekten Darstellung fußen. Es sollte also davon ausgegangen werden, dass „Vater“ tatsächlich als Vater aller Menschen zu interpretieren ist.
Der folgende Aspekt, den Gyburg anspricht, fällt aus dem Rahmen, denn er hat keinerlei Beziehung zu den vorangehenden Ausführungen. Es geht um die Existenz und die Stellung des zehnten Engelschors, der durch die Anmaßung Luzifers, der Gott gleich sein wollte, gestürzt wurde. Der Fall der Engel war der Grund für die Erschaffung der Menschen, sie ersetzen den Engelschor. Die Darstellung entspricht einer langen Tradition, sie ist in der deutschsprachigen geistlichen Literatur und sogar in Predigten vor Wolframs Zeiten gut belegt. Einzig eine kleine Brücke lässt sich herstellen, die, wie es die Formulierung nahelegt, vielleicht gar nicht wirklich auffällt, weil es zwar um das Erbarmen Gottes geht, aber die Gedanken betreffen nicht die Möglichkeit der Erlösung von Heiden.
Die angedeutete Berührung mit dem zuvor Gesagten, mehr noch aber mit dem Folgenden ergibt sich durch den Hinweis auf das Erbarmen, genauer die Vergebung, auf die die Menschen hoffen dürfen:
beidiu in den gotes haz:
wie kumt, daz nû der mennisch baz
dan der Engel gedinget?
mîn munt daz maere bringet:
der mennisch wart durh rât verlorn,
der engel hât sich selb erkorn
zer êwigen vlüste
mit sîner âküste
und alle, die im gestuonden,
die selbe riuwe vunden.
(W 308, 15–24).,Mensch und Engel hatten sich
gleichermaßen Gottes Feindschaft zugezogen:
wie kommt es, dass der Mensch nun
auf Vergebung hoffen darf, der Engel nicht?
Ich will es sagen:
der Mensch ist einem bösen Rat erlegen,
der Engel hat sich selbst aus eignem Antrieb
in den ewigen Tod gegeben
mit seiner Hinterlist,
und allen, die es mit ihm hielten,
gingʼs genau so schlecht.ʻ
Auch an dieser Stelle spielt die Erlösbarkeit der Menschen die zentrale Rolle, denn es wird die Frage gestellt, warum die Menschen auf das Erbarmen Gottes hoffen dürfen, die Engel des zehnten Chores, der von Gott verbannt wurde, aber nicht. Der Unterschied, auf den hingewiesen wird, soll die Haltung Gottes verständlich machen. Er besteht darin, dass die Menschen sich verführen ließen, wohingegen die Engel des zehnten Chores aus eigenem Antrieb handelten, sie beschlossen von sich aus, sich gegen Gott aufzulehnen. Aus Eifersucht und Neid, umschleichen deshalb die gefallenen Engel des zehnten Chores die Menschen, um sie zu verführen, in Sünden zu verstricken. Genau diese Verführung ist es aber, weshalb die Menschen auf Vergebung hoffen dürfen. Um den Aspekt der Vergebung, wenngleich auf einer anderen Ebene, geht es dann in den weiteren Ausführungen Gyburgs.
Gyburg kehrt zum zentralen Gedanken ihrer Ausführungen zurück und widmet sich wieder der Auseinandersetzung zwischen den Christen und den Heiden sowie den Folgen, sollten die Heiden unterliegen:
swaz iu die heiden hânt getân,
ir sult si doch geniezen lân,
daz got selbe ûf die verkôs,
von den er den lîp verlôs.
ob iu got sigenunft dort gît,
*lât ez iu erbarmen ime strît!
sîn werdeclîchez leben bôt
vür die schuldehaften an den tôt
unser vater Tetragramatôn.
sus gap er sînen kinden lôn
ir vergezzenlîcher sinne.
sîn erbarmede rîchiu minne
elliu wunder gar besliuzet,
des triuwe niht verdriuzet,
sine trage die helfeclîche hant,
diu bêde wazzer unde lant
vil künsteclîch alrêst entwarf,
und des al diu krêatiure bedarf,
die der himel umbesweifet hât.
(W 309, 1–19).,Was euch die Heiden Schlimmes taten,
laßt ihnen doch zugute kommen,
daß Gott selbst bereit war,
seinen Mördern zu vergeben.
Wenn Gott euch dort den Sieg gewährt,
habt im Kampf Erbarmen!
Sein hohes Leben opferte
für die Schuldbeladenen
unser Vater Tetragramaton.
So hat er seinen Kindern
vergolten, daß sie ihn vergaßen.
Sein liebendes Erbarmen
kann jedes Wunder wirken,
in seiner treuen Liebe
hält er stets die Hand zur Hilfe hin,
die Wasser und Erde
kunstreich erschuf
und alles, was die Geschöpfe brauchen,
Die der Himmel umgibt,ʻ
Die Bibel besagt, dass Christus am Kreuz den Vater darum bat, seinen Mördern zu vergeben. Diese Mörder sind einerseits die Juden als Ankläger, aber auch Heiden, denn die Römer, die das Urteil vollstreckten waren Heiden. Das bedeutet, Christus bittet um Vergebung für Juden und Heiden. Das scheint ein weiteres Indiz dafür, dass oben mit kint auch die Heiden gemeint sind. Christus opfert sich, damit den Menschen ihre Sünden vergeben werden. Alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind erlösungsbedürftig und allen Menschen kann vergeben werden, weil Christus am Kreuz darum bittet.
Hinzuweisen ist noch auf die Bezeichnung Tetragramaton, griechisch für „das aus vier Buchstaben Bestehende“, ein Hinweis auf den Eigennamen Gottes, der im Hebräischen aus vier Buchstaben besteht: JHWH für „Jahweh“. Gott hat vergeben, obwohl die Menschen sündigten, ihn vergaßen, die Sünden ins Unermessliche wuchsen. Für den Gott, der, obwohl selbst ohne Schuld, für die Sünden der Menschen stirbt und dennoch um Vergebung für sie bittet, ist alles möglich und denkbar. Er reicht seine Hand, er kann durch seine Liebe jedes Wunder bewirken. Auch diese Textstelle legt die oben ausgeführte Interpretation nahe. Die Vergebung als Erlösung selbst für die Mörder kann doch eigentlich nur bedeuten, dass das liebende Erbarmen, die Erlösung der Heiden zumindest in Betracht zieht, sie also denkbar ist!
Da es in mittelalterlichen Texten keine Interpunktion gibt, stellt sich grundsätzlich die Frage, wo Satzzeichen in einen Text einzufügen sind und welche. Es wurde in der Forschung diese Frage in Bezug darauf aufgeworfen und unterschiedlich beantwortet, ob nach dem Vers: sine trage die helfeclîche hant, (,hält er stets die Hand zur Hilfe hin,ʻ; W 309, 15), wie es in der benutzten Ausgabe (siehe Literaturverzeichnis) geschieht, das Zitat zeigt es, ein Komma gesetzt werden soll. Daneben gibt es die Ansicht, dass nach dem Vers ein Punkt zu setzen ist. Analog dazu und im Zusammenhang damit wird dieselbe Frage für das Ende des Verses gestellt: die der himel umbesweifet hât (,die der Himmel umgibt.ʼ; W 309, 19). Diejenigen, die dafür plädieren, nach Vers W 309, 15 ein Komma einzufügen, wählen nach Vers W 309, 19 einen Punkt bzw. umgekehrt. Das hat zwar Konsequenzen für eine detaillierte Interpretation der Textstelle, für die vorliegende Studie ist eine Entscheidung in dieser Frage von eher untergeordneter Bedeutung, weshalb ein näheres Eingehen darauf nicht notwendig erscheint. Es genügt, die Quintessenz der Textstelle festzuhalten, die von der unterschiedlichen Zeichensetzung weitestgehend unberührt bleibt und darin besteht, dass es einmal mehr um die Darstellung der Allmacht Gottes geht.
Gegen Ende ihrer Rede betont Gyburg noch einmal, dass sie sich bewusst von Tervagant und Mohammed abwendete, und „der kunstreichen Hand“ (W 310, 1), dem christlichen Gott und dem christlichen Glauben zuwandte. Das trug ihr den Hass beider ein, der Christen wie der Heiden, weil sie alle fälschlicherweise glauben, dass sie aus Liebe zu einem Menschen den Krieg verursacht habe. Die von Gybrug gewählte Formulierung menneschlîcher minne (,für Sinnenlustʼ; W 310, 7) wird in der Ausgabe, wie die Übersetzung belegt, mit Sinnenlust übersetzt und entsprechend negativ ausgelegt. Gyburgs Aussage und damit ihre Beziehung zu Willehalm auf den sexuellen Aspekt zu reduzieren, gibt der Text nicht her, das dürfte auch den Rezipienten mehr als deutlich sein, dass sowohl die Christen als auch die Heiden Gyburg wegen ihrer Liebe zu Willehalm hassen, lässt sich an Hand des Wortlauts des Textes im Grunde ebenfalls nicht nachweisen. Es handelt sich um eine eklatante Herabwürdigung der Gestalt und es darf füglich bezweifelt werden, dass eine solche tatsächlich intendiert war. Das belegen der Exkurs, auf den oben eingegangen und in dem Gyburg als schuldlos bezeichnet wurde, weil sie, was sie tat, für Gott tat, und in eindeutiger Weise die folgenden Ausführungen Gyburgs.
Das sich anschließende Bekenntnis wirkt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Gyburg sich nach eigenem Bekunden von ihrem Glauben und von ihrer Familie lossagte, zunächst fast ein bisschen überraschend:
dêswâr, ich liez ouch minne dort
und grôzer rîcheit manegen hort
und schoeniu kint, bî einem man,
an dem ich niht geprüeven kan,
daz er kein untât ie begienc,
sît ich krône von im enpfienc.
(W 310, 9–14).,Wahr ist: ich ließ auch Liebe dort
und großen Reichtum,
schöne Kinder von einem Mann,
von dem ich nicht sehen kann,
daß er jemals Böses tat,
seit ich die Krone von ihm empfing.ʻ
Gyburg übernimmt die Verantwortung für die Trennung von ihrer Familie, die sie liebte, auch ihrem Ehemann kann sie, wie sie ausführlich darlegt, keinerlei Vorwürfe machen. All dies unterstreicht aber – bei genauerer Betrachtung – nur die Intensität der Liebe zu Willehalm und zum christlichen Gott:
Tîbalt von Arabî
ist von aller untaete vrî:
ich trag al eine die schulde
durh des hoehisten hulde,
ein teil ouch durh den markîs
(W 310, 15–19).,Tibalt von Arabi
ist ohne jeden Fehl:
ich trag allein die Schuld,
es ging mir um des Höchsten Huld
– und auch um den Marquis,ʻ
Gyburg wählte bewusst einen neuen Weg trotz der Gefühle, die sie für ihre Familie besaß. Das Bekenntnis spricht aber nicht nur, wie schon erwähnt, für die Intensität der Gefühle Gyburgs, es dokumentiert und unterstreicht – auch gegenüber den Ausführungen Gyburgs während des Religionsgesprächs – eine höher zu bewertende Haltung, denn sie bringt eine überlegene, bewusste Entscheidung zum Ausdruck, eben weil Gyburg eingesteht, dass sie durchaus vorhandene Gefühle zu überwinden hatte.
Es wurde beim Inhaltsabriss darauf hingewiesen, dass Gyburg am Beginn des IX., nicht mehr vollendeten, Buches als Heilige angesprochen wird. Dies geschieht in einer prologartigen Sequenz. Der Erzähler ruft Gyburg an:
Ei Giburc, heilic vrouwe,
dîn saelde mir die schouwe
noch vüege, daz ich dich gesehe,
aldâ mîn sêle ruowe jehe.
durh dînen prîs, den süezen,
wil ich noch vürbaz grüezen
dich selben und die dich werten,
(W 403, 1–7).,Heilige Giburg, Herrin,
deine Seligkeit erwirke mir
dereinst den Anblick: dich zu sehn,
wo meine Seele Ruhe findet.
Zum Ruhme deiner Heiligkeit
will ich dich weiter preisen
und die, die für dich kämpftenʻ
Es ist unbenommen, dass Gyburg realhistorisch gesehen keine Heilige ist, sie ist es textintern und durch die Aussage des Erzählers. Diese Feststellung bedarf keiner weiteren Diskussion, die Frage muss lauten, warum wird Gyburg zur fiktionalen Heiligen stilisiert. Am Anfang des Werkes wurde Willehalm als Heiliger eingeführt, allerdings stimmt dies mit der Realität überein, jedenfalls dann, woran im Grunde kein Zweifel besteht, wenn die historische Gestalt, die hinter der literarischen steht, als Guillaume d’Orange richtig identifiziert wird. Dieser galt tatsächlich als Heiliger. Als Erklärung heranzuziehen, dass dem Heiligen eine Heilige als Ehepartnerin zur Seite gestellt werden sollte, erscheint zu banal.
Es ist vielleicht ein gewagt anmutender Gedankensprung, aber es kommt doch die Erinnerung an die eigene Einschätzung Gyburgs in den Sinn, die sich als ungelehrte Frau bezeichnete. Sicher muss eine Heilige nicht gelehrt sein, aber erhält das, was Gyburg äußerte, dadurch, dass sie nun als Heilige angerufen wird, nicht einen anderen Stellenwert, wird nicht – gewissermaßen im Nachhinein – das, was sie im Verlauf der Rede im Fürstenrat sagte, letztlich doch aufgewertet. Das würde bedeuten, dass Wolfram die mit der Aussage verbundene Absicht, sich vor Kritik zu schützen, torpediert, sogar aufhebt. Sicher eine Kehrtwende – es wäre aber nicht die einzige in Wolframs dichterischem Schaffen, insofern ist der Hinweis darauf nicht wirklich dazu geeignet, den Gedanken zurückzuweisen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Wolfram die Absicht, Gyburg und damit auch ihre Aussagen im Nachhinein aufzuwerten, schon im Sinn hatte, als er Gyburg sagen ließ, sie sei eine ungelehrte Frau. Wie gesagt, ein Gedankensprung oder besser ein Gedankenspiel, dass es eine solche Intention bei Wolfram gab, lässt sich nicht belegen.
Fazit
Die vorangegangenen Ausführungen sollten die unterschiedlichen Rollen Gyburgs zumindest kurz anreißen, mehr noch aber ihren “Werdegang“. Sie wurde, um es noch einmal in Stichworte zu fassen und wenigstens einige zentrale Aspekte aufzugreifen, als konvertierte Heidin, zur liebevollen christlichen Ehepartnerin und Verteidigerin des christlichen Glaubens, handfest als Kämpferin für diesen, wichtiger aber, im Religionsgespräch mit ihrem Vater. Dies ist allein schon eine enorme Steigerung der Bedeutung der Gestalt, doch damit ist Gyburg längst nicht am Ende ihrer Wertsteigerung. Sie hält eine Rede im Fürstenrat, die vor dem Hintergrund ihrer Position als Frau aber auch inhaltlich mehr als nur bemerkenswert ist und, nach der vorgeschlagenen Interpretation, den Boden der von der Kirche sanktionierten Lehren verlässt. Als Gipfelpunkt wird sie schließlich als Heilige angerufen.
Losgelöst von der Figur Gyburg und ihrer Gestaltung gilt es als historischen Hintergrund des Werkes die Kreuzzugsbewegung und damit verbunden die Kreuzzugsideologie zu berücksichtigen. Es ist schon angeklungen, dass gemäß der einschlägigen Kreuzzugsideologie eine Schonung von Heiden, wie sie von Gyburg gefordert und von Willehalm im Grunde nach der zweiten Schlacht praktiziert wurde, nicht in Betracht kommt, eher galt es, die Heiden zu vernichten, auszumerzen, es sei denn, dass sie sich zum Christentum bekehrten. Es gab zwar an dieser Haltung, wie überhaupt an der Kreuzzugsbewegung, schon früh Kritik, aber diese wurde, wie die Geschichte belegt, von päpstlicher Seite nicht sonderlich ernst genommen. Schon die verheerende Niederlage des christlichen Heeres beim zweiten Kreuzzug ungefähr Mitte des 12. Jahrhunderts, aber auch der als sinnlos betrachtete Tod Friedrichs I., der zum Kreuzzug aufgebrochen war, aber das Heilige Land gar nicht erreichte, waren Auslöser die Sinnhaftigkeit der Kreuzzugsunternehmungen zu hinterfragen, besonders gilt dies auch für die geradezu programmatisch gewordene Aussage Papst Urbans II., mit der er zum ersten Kreuzzug aufrief: Deus lo vult! (Gott will es!)
Das Zusammenleben von Muslimen und den Christen, die im Heiligen Land bzw. den angrenzenden Grafschaften und Fürstentümern, die von Christen beherrscht wurden, blieben, bedarf keiner genaueren Betrachtung, da fraglich ist, ob dieses für das Denken im Reich eine Rolle gespielt hat. Immerhin sei erwähnt, dass es vielerorts eine friedliche Koexistenz gab, Christen und Muslime teilweise ein vertrauensvolles Miteinander pflegten.
Die Auseinandersetzungen zwischen Friedrich II. und den Päpsten Honorius III. später Gregor IX. wegen des Kreuzzugsversprechens Friedrichs II. dürften im Deutschen Reich weithin bekannt gewesen sein. Die Eskalation dieses Streits, die schließlich zur Exkommunizierung Friedrichs II. durch Papst Gregor IX. führte, kann, wie eingangs bereits ausgeführt, aus chronologischen Gründen keine Rolle spielen, denn sie fand erst 1227 statt. Es ist darüber hinaus in Erinnerung zu rufen, dass die Haltung Friedrichs II. zur Kreuzzugsbewegung schon sehr viel früher dadurch deutlich wurde, dass er das Kreuzzugsvorhaben immer wieder verschob, weil es ihm offenkundig kein wirkliches Anliegen war. Auch an Friedrichs Haltung gegenüber Muslimen, das als von Toleranz geprägt eingestuft werden darf, gilt es zu erinnern. An seinem Hof herrschte eine fruchtbringende Koexistenz von Christen und Muslimen. Dies dürfte allgemein bekannt gewesen sein. Um den Kreis zu Wolfram auch an dieser Stelle zu schließen, ist der Mäzen Wolframs, Hermann von Thüringen, zu erwähnen. Hermann von Thüringen war Parteigänger Friedrichs II., er unterstützte diesen schon 1211, indem er sich dafür entschied, dessen Wahl zum König zu fördern. Was Friedrich II. tat und dachte, dürfte am Hof Hermanns zu dem, wie erwähnt, auch Wolfram zählte, bekannt gewesen sein. Später zählte, darauf sei nur hingewiesen, um die offenkundig lebendig bleibende Verbindung der Ludowinger zu Friedrich II. zu dokumentieren, Ludwig IV., der Sohn Hermanns, zu den nicht eben zahlreichen Unterstützern des erwähnten Kreuzzuges Friedrichs II. im Deutschen Reich. Als These ließe sich formulieren, dass der geschilderte politische Hintergrund auf das literarische Schaffen Wolframs einwirkte und zu dem am Ende des Werkes greifbaren Gedanken an eine friedliche Koexistenz von Christen und Muslimen führte. Dieser Gedanke soll abschließend im Hinblick auf die Rolle Gyburgs und das Ende des Werkes ein wenig weiterverfolgt werden.
Bereits das Zwischenfazit zu Gyburg belegte, dass Gyburg die zentrale Gestalt des Werkes ist. Dies gilt trotz der das Werk umfangmäßig bestimmenden Schlachtenschilderungen. Durch das Religionsgespräch, mehr noch durch die Rede im Fürstenrat wird die Bedeutung Gyburgs auf markante, für die damalige Zeit exzeptionelle, Weise gesteigert. Gyburg erlebt eine ungeheure Aufwertung. Dass Gyburg gegen Ende des Werkes sogar als Heilige tituliert wird, erscheint fast wie eine folgerichtige Konsequenz.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ihre Äußerung dêswâr, ich liez ouch minne dort (,Wahr ist, ich ließ auch Liebe dortʼ; W 310, 9). Diesem Bekenntnis zu ihrer heidnischen Vergangenheit wurde in der Forschung bisher vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl Gyburg hier doch ihr Heidentum nicht nur nicht verleugnet, sondern offenbar als integralen Bestandteil ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren scheint. Dies offenbart eine reflektierte, überlegene Position, sogar gegenüber ihrer Haltung im Religionsgespräch, in dem Gyburg eine eher distanzierte Haltung einnimmt und sie ausschließlich die Überlegenheit des christlichen Glaubens aufzeigen will. Diese Position scheint überwunden. Wenn die zitierte Aussage in Verbindung mit der Aufforderung zur Schonung der Heiden gesehen wird, ließe sich formulieren, dass Gyburg das Heidentum, das sie hinter sich ließ, nun für sich toleriert und für sich Frieden damit geschlossen hat. Möglicherweise kann Gyburg als eine Art Manifestation der Möglichkeit der friedlichen Koexistenz gesehen werden. Die angesprochene Aufforderung zur Schonung der Heiden lässt sich so als Aufforderung zur friedlichen Koexistenz auch der Glaubensrichtungen werten. Ist Willehalms Verhalten am Ende des Werkes als Reflex dieses Gedankens zu interpretieren, handelt er unter dem Einfluss der Rede und der mit ihr verbundenen Intention? Fragen, die letztlich offen bleiben müssen, eine bejahende Beantwortung liegt jedoch sehr nahe.
Wolfram unterbreitet seinen Rezipienten eine – nicht nur zu seiner Lebenszeit, sondern auch aus der Sicht der Gegenwart – utopische Vorstellung der friedlichen Koexistenz von Religionen. Mit dieser Feststellung ließe sich eine Rückkoppelung zu der Tatsache verbinden, dass das Werk unvollendet blieb. Sicher ist das überlieferte Ende nicht in dem Sinne zu interpretieren, dass Wolfram an der Stelle nicht hätte weiterschreiben können, grundsätzlich aber stellt sich durchaus de Frage: Wie hätte Wolfram wohl sein Werk enden lassen. Hätte er es um 1220 wagen können, eine friedliche Koexistenz von Christen und Heiden darzustellen, eine Frage, deren Beantwortung auch den Mäzen betroffen hätte. Zu bedenken ist dabei, dass die dem Werk innewohnende, tolerante Haltung ein Spezifikum war, sie darf nicht als allgemein anzutreffende Position angesehen werden. Das zeigt schon der Blick auf die Fortsetzung, also den Text, den Ulrich von Türheim als Ergänzung und Ende zu Wolframs unvollendetem Werk hinzudichtete. In diesem Text findet sich die Haltung der Kreuzzugspropaganda, die die Heiden grundsätzlich und rigoros abwertet und negativ beurteilt. Die Heiden und mithin das Heidentum sind rücksichtslos zu behandeln, das Heidentum nach Möglichkeit auszurotten.
So hat sich, dies darf wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit formuliert werden, Wolfram das Ende seines ,Willehalmʼ bestimmt nicht vorgestellt. Dessen ungeachtet zeigt die Überlieferung, auf die noch kurz eingegangen werden wird, dass Wolfram seine Protagonistin eine Haltung formulieren lässt, die ebenso einzigartig und isoliert erscheint, wie das davon beeinflusste Handeln Willehalms am Ende des unvollendeten Werkes, denn das enorme und lang anhaltende Interesse am ,Willehalmʼ wurde nicht durch diese uns heute faszinierenden Aspekte ausgelöst. Diese Feststellung beruht nicht nur auf der Beobachtung, dass der Fortsetzer in alte Muster verfällt, sie wird auch dadurch gestützt, dass Wolframs Text, sofern er vollständig überliefert wurde, mit eben der Fortsetzung und der ihr innewohnenden, völlig anderen Haltung überliefert wurde. Auch sonst findet sich zu Wolframs Zeiten – gemäß der Überlieferung – kein literarischer Text, der eine ähnliche Haltung gegenüber den Heiden propagieren würde.
Textdynamik — ein Exkurs
Es dürfte durch die bisherigen Ausführungen deutlich geworden sein, dass der Text intern eine ungeheure Dynamik entwickelt, auf die nur kurz eingegangen werden soll. Im Wesentlichen soll aber ein grober Einblick in die Dynamik, die das Werk als solches entwickelte, gegeben werden.
Der Inhalt des Werkes zeigt eine ungewöhnlich ausgeprägte Dynamik, das gilt für die Handlungsebene ebenso wie für die Gestaltung des Protagonistenpaares. Aus einer Privatfehde wird ein Krieg auf Reichsebene. Der oberste Herrscher der Heiden kämpft gegen das Reichsheer, zu dessen Führer Willehalm durch den König erklärt wurde. Es geht um die Vorherrschaft auf Erden. Aus der Konversion einer Frau wird ein Glaubenskrieg, bei dem es schlicht um die Existenz des Christentums insgesamt geht, denn Terramer will bis nach Rom vordringen und es einnehmen.
Arabel eine heidnische Königin konvertiert für Willehalm aber auch, weil sie an die Überlegenheit des christlichen Gottes glaubt, zum Christentum. Sie ändert ihren Namen und nimmt eine Reduzierung ihrer sozialen Stellung in Kauf. Gyburg wird in vielen verschiedenen Rollen vorgestellt. Nach der Taufe wird sie zur Verteidigerin des Glaubens in einem religiösen Disput. Die damit erreichte Position ist schon außergewöhnlich. Diese exponierte Stellung erfährt eine weitere Steigerung, als Gyburg am Fürstenrat teilnimmt und dort eine Rede hält. Gyburg entwirft eine neue Sicht auf die Heiden und das Verhalten ihnen gegenüber. Den Zenit erreicht Gyburg schließlich als sie am Beginn des IX. Buches sogar als Heilige bezeichnet wird.
Der noch Hass und rücksichtslose Kampfbereitschaft schürende Willehalm der Fürstenversammlung wird augenscheinlich durch die Rede seiner Frau beeinflusst. Was Willehalm seinem Schwiegervater anbietet, kann nur dahingehend gedeutet werden, dass Willehalm, auf diesen Aspekt wurde bereits hingewiesen, eine friedliche Koexistenz anstrebt, ein zukünftiger Krieg wegen des unterschiedlichen Glaubens ausgeschlossen werden soll.
Der zweite angekündigte Aspekt beschäftigt sich mit dem Werk selbst. Es soll um die Überlieferung gehen und Aspekte wie die Illustration von Willehalmhandschriften und die Zyklusbildung.
Zur Überlieferung wurden bereits Andeutungen gemacht, diese sollen nun aufgegriffen und etwas vertieft werden. Die Entstehung des Werkes kann auf das zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts festgelegt werden. Am plausibelsten erscheint die Annahme, dass Wolfram seine Arbeit am ,Willehalmʻ wohl gegen Ende des Jahrzehnts beendete, aus welchen Gründen auch immer. Der ,Willehalmʻ weist, inklusive den bisher aufgefundenen Fragmenten, circa 80 Textzeugen auf. Die Zahlenangaben schwanken. Es soll hier nur auf einen besonderen Aspekt hingewiesen werden, der die Zählung gerade beim ,Willehalmʻ im Vergleich zu anderen Werken besonders schwierig macht. Der ,Willehalmʻ wurde oft im Zusammenhang mit einer Vorgeschichte und einer Fortsetzung überliefert. Er wurde zum Mittelteil eines Zyklusses, ein Aspekt auf den noch eingegangen werden soll. Fragen, die nicht geklärt werden können, lauten etwa, kann davon ausgegangen werden, dass Fragmente der Vorgeschichte respektive der Fortsetzung auch als Zeugnis für den ,Willehalmʻ selbst gezählt werden dürfen. Ungeachtet dieser Problematik kann festgehalten werden, dass der ,Willehalmʻ mit Abstand zu den am besten überlieferten Werken der mittelalterlichen Erzählliteratur gehört. Darüber hinaus gibt es Exzerpte etwa in der ,Weltchronikʻ Heinrichs von München, einer Kompilation aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Eine Beobachtung, die die Aussage untermauert, dass das, was im ,Willehalmʻ geschildert wird, als historischer Bericht aufgefasst wurde.
Auch der Überlieferungszeitraum ist überaus bemerkenswert. Aus dem 13. Jahrhundert stammen 20 Fragmente. Es gibt aber aus dem 13. Jahrhundert nur eine Handschrift von der angenommen werden kann, dass sie den Text Wolframs vollständig wiedergibt. Bei der Handschrift handelt es sich um einen Codex der Stiftsbibliothek St. Gallen, cod. 857, die – unter anderem – auch den ,Parzivalʻ enthält. Der Wortlaut dieser Handschrift dient den Ausgaben als Grundlage, sie gilt als Leithandschrift. Die Überlieferung reicht bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Im Jahr 1475 entstand eine frühneuhochdeutsche Prosaauflösung, die in drei Handschriften überliefert ist, die alle aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammen. Das bedeutet, die vorgeschlagene Datierung unterstellt, dass das Werk einen Überlieferungszeitraum von mehr als 250 Jahren aufweist. Allerdings wurde der ,Willehalmʻ nie gedruckt, wie dies etwa bei Wolframs ,Parzivalʻ der Fall ist.
Die größte Nachwirkung ging jedoch von Wolframs Prolog des Werkes aus, der losgelöst und unabhängig von diesem eine eigene Textgeschichte begründete. Er wurde vielfach paraphrasiert, ausgeschrieben und nachgeahmt. Er wurde als Paradigma des geistlichen Prologs bezeichnet und bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts ins Lateinische übersetzt. Spätere Dichter haben sich durchaus intensiv mit dem Textstück auseinandergesetzt, auf dieses zurückgegriffen.
Es entstand außerdem, wie schon angedeutet, ein Zyklus, in dessen Mitte Wolframs ,Willehalmʻ steht. Das Werk ist geradezu prädestiniert für eine solche Entwicklung. Ein Grund dafür wurde schon angesprochen: Wolfram hat seine Arbeit nicht vollendet, es fehlt das Ende der Geschichte. Dieses wurde um 1250 dazugedichtet. Der Verfasser war Ulrich von Türheim. Er benutzte zahlreiche Vorlagen. Diese Fortsetzung umfasst mehr als 36000 Verse und ist damit weit mehr als doppelt so umfangreich wie Wolframs Text! Die Lebensgeschichte von Willehalm und Rennewart wird zu Ende erzählt, dabei werden unter anderem Heidenkämpfe dargestellt. Die beiden treten in ein Kloster ein und sterben dort. Zentral ist das Schicksal Rennewarts, das am Ende von Wolframs Text offenbleibt. Diese Fortsetzung zeigt ebenfalls eine weite Verbreitung meist treten die Textzeugen allerdings im Zusammenhang mit dem ,Willehalmʻ auf. Die allgemein übliche Bezeichnung ist ,Rennewartʻ.
Ein weiterer Grund für die Zyklusbildung ist darin zu sehen, dass Wolfram seine Rezipienten im Grunde nicht darüber informiert, wie es zu der Situation kam, die er am Beginn des ,Willehalmʻ schildert. Es bestand also auch am Anfang des Werkes ein gewisser Erklärungsbedarf im Hinblick auf die Konstellation, mit der die Rezipienten konfrontiert wurden. Dem bereitete Ulrich von dem Türlin ein Ende, indem er eine ”Vorgeschichte“ verfasste. Das Werk wird als ,Arabelʻ oder auch einfach als ,Willehalmʻ bezeichnet. Es wird von Willehalms Jugend, seinen ersten Heidenkämpfen und der Gefangenschaft bei Tybalt erzählt. Es wird darüber hinaus von seiner Begegnung mit Arabel, der gemeinsamen, gefährlichen Flucht, von der Taufe Arabels auf den Namen Gyburg und von der Eheschließung von Willehalm und Gyburg berichtet. Dabei scheint der Autor keine Vorlage verwendet zu haben. Seine Erzählung basiert auf Andeutungen in Wolframs ,Willehalmʻ, die er ausbaut. Es entstehen circa 9600 Verse. Ulrich arbeitete wahrscheinlich im Auftrag von Ottokar II. von Böhmen, während dessen Regierungszeit, also zwischen 1253 und 1278.
Der Zyklus umfasst mehr als 60000 Verse. Die Zusammengehörigkeit der drei Teile war schon den mittelalterlichen Rezipienten bewusst, sie wurden als eine groß angelegte Geschichte von Willehalm aufgefasst. In acht der zwölf vollständigen ,Willehalmʻ-Handschriften steht Wolframs Werk zwischen der Vorgeschichte und der Fortsetzung. Bemerkenswert ist auch, dass zu neun ,Willehalmʻ-Fragmenten Fragmente aus der Vorgeschichte und der Fortsetzung aus derselben Handschrift überliefert sind. Daher der Hinweis auf besondere, werkspezifische Probleme bei der Zählung der Textzeugen des ,Willehalmʻ, denn die geschilderte Beobachtung führt zu der aufgeworfenen Frage, wie Fragmente nur der Vorgeschichte bzw. nur der Fortsetzung hinsichtlich der Überlieferung des ,Willehalmʻ Wolframs zu bewerten sind. Es muss grundsätzlich mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass diese Fragmente Bestandteile eines ursprünglich vollständigen Zyklusses waren, dementsprechend möglicherweise auch als Textzeugen für den ,Willehalmʻ gewertet werden müssten, wodurch sich die Anzahl der ,Willehalmʻ-Handschriften erhöhen würde. In der Einbindung in den Zyklus fand der ,Willehalmʻ die weiteste Verbreitung.
Inhaltlich muss unbedingt in Erinnerung gerufen werden, dass das bei Wolfram angelegte positive Heidenbild für die beiden anderen Bestandteile des Zyklusses keine Rolle spielt. Die Autoren kehren vielmehr zu der im Rahmen der Kreuzzugsideologie vertretenen absolut negativen Heidendarstellung zurück.
Der ,Willehalmʻ ist das am häufigsten illustrierte Epos des deutschen Hochmittelalters. Da die Herstellung von illustrierten Handschriften einen noch höheren Aufwand bedeutete, als das bei einer nur schriftlichen Textwiedergabe der Fall war, verweist diese Beobachtung zum einen auf die besondere Wertschätzung, die dem Werk entgegengebracht wurde, zum anderen aber – naheliegenderweise – auch auf mögliche Auftraggeber. Als Ursache für die offenkundige Wertschätzung lässt sich anführen, dass der Stoff ins Umfeld des im Mittelalter überaus verehrten Karl des Großen führt. Damit verbunden und wahrscheinlich wichtiger ist die angedeutete Nähe zur Historiographie. Die Feststellung, dass der Inhalt des Werkes als ein historischer Bericht aufgefasst wurde, könnte auch für die erwähnte Beliebtheit des Werkes und die Überlieferungsdauer verantwortlich sein. Eine andere, wenig plausibel erscheinende These, mit der versucht wurde, die Wertschätzung und Illustrationsfülle zu erklären, war der Hinweis darauf, dass die Darstellung des Lebens des Protagonisten als Heiligenvita aufgefasst wurde. Durch die einleitende Beurteilung dürfte verständlich sein, dass nicht weiter auf diesen Forschungsansatz eingegangen wird. Wie auch immer, der Stoff der Dichtung wurde als geschichtliches Geschehen betrachtet, er rückt dadurch in die Nähe von gereimten Chroniken, die häufiger als Epen oder Romane illustriert wurden. Einher mit der Bebilderung geht eine weitergehende buchkünstlerische Ausgestaltung durch reich geschmückte Initialen und anderen Buchdekor wie etwa Zierbänder. Es kann hier nicht ins Detail gegangen werden, festzuhalten ist aber noch, dass die Entstehung von illustrierten Handschriften des Werkes zurückreicht bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts.
Einen besonderen Status innerhalb dieses Teils der Überlieferung des ,Willehalmʻ nehmen die München-Nürnberger Fragmente ein, sie bilden einen Extremfall an üppiger Illustration. Sie werden deshalb auch als Große Bilderhandschrift bezeichnet. Auf der Basis der überlieferten Fragmente wurde in der Forschung errechnet, dass die vollständige Handschrift wahrscheinlich circa 500 Seiten, die mit etwa 1300 Bilder ausgestattet waren, umfasste. Diese Fragmente weisen, das dokumentieren im Grunde schon die angeführten Zahlen, auf einen außergewöhnlichen Illustrationsstil hin, der an die bebilderten ,Sachsenspiegelʻ-Handschriften erinnert, bei denen jede Seite in eine schmalere Text- und eine breitere Bildleiste unterteilt ist. Bei den München-Nürnberger Fragmenten ist der Seitenspiegel der elf, teilweise fragmentarisch überlieferten, Blätter ebenso eingeteilt, die Seiten weisen drei oder auch zwei Bilder auf. Der Text wird quasi Vers für Vers visualisiert, ein enorm aufwändiges Verfahren.
Abschließend soll noch kurz auf die angedeutete Frage nach den möglichen Auftraggebern eingegangen werden. Wer konnte derart kostspielige und kostbare Prachthandschriften, die im 13. besonders aber im 14. Jahrhundert die Überlieferung des ,Willehalmʻ geradezu dominieren und in der Hauptsache den gesamten Zyklus wiedergeben, in Auftrag geben? Die anfallenden, exorbitanten Kosten verweisen auf einen exklusiven Kreis von Auftraggebern, wie es etwa der Landgraf Heinrich II. von Hessen war. Die repräsentativen ,Willehalmʻ-Handschriften sind prädestiniert für Fürstenbibliotheken, in hohen Adelskreisen sind mithin die Auftraggeber zu suchen. Dennoch blieb ein hoher Anteil der Bilderhandschriften unvollendet. So blieb auch die von Landgraf Heinrich II. in Auftrag gegebene Handschrift letztlich ein Torso. Das ehrgeizige Projekt kam nicht zur Vollendung. Von den offensichtlich geplanten 479 Miniaturen wurden lediglich 39 tatsächlich vollendet.
Diese wenigen Anmerkungen sollten genügen, um aufzuzeigen, wie vielfältig und weitreichend die Wirkungs- und Überlieferungsgeschichte des ,Willehalmʻ ist.
Primärliteratur
- Pfaffe Konrad ,Das Rolandsliedʻ, Mittelhochdeutsch / Neuhochdeutsch, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Dieter Kartschoke, durchgesehene und bibliographisch aktualisierte Ausgabe, Stuttgart 2011 (Reclams Universal-Bibliothek; Nr. 2745).
- Ulrich von dem Türlin ,Arabelʻ. Die ursprüngliche Fassung und ihre Bearbeitung kritisch herausgegeben von Werner Schröder, Stuttgart, Leipzig 1999.
- Ulrich von Türheim ,Rennewartʻ. Aus der Berliner und Heidelberger Handschrift herausgegeben von Alfred Hübner, Berlin 1938 (DTM 39).
- Wolfram von Eschenbach ,Parzivalʻ, nach der Ausgabe Karl Lachmanns revidiert und kommentiert von Eberhard Nellmann, übertragen von Dieter Kühn, Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch, Band 7, Frankfurt a.M. 2006.
- Wolfram von Eschenbach ,Willehalmʻ, herausgegeben von Joachim Heinzle, Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch, Band 39, Frankfurt a.M. 1991. (Dieser Ausgabe sind alle Textzitate und die Übersetzungen entnommen.)
- Wirnt von Grafenberg ,Wigaloisʻ, nach dem Text von J. M. N. Kapteyn, übersetzt, erläutert und mit einem Nachwort versehen von Sabine Seelbach und Ulrich Seelbach, Berlin, New York 2005.
Sekundärliteratur
- Becker, Peter Jörg: Handschriften und Frühdrucke mittelhochdeutscher Epen. Eneide, Tristrant, Tristan, Erec, Iwein, Parzival, Willehalm, Jüngerer Titurel, Nibelungenlied und ihre Reproduktion und Rezeption im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1977.
- Bumke, Joachim: Wolfram von Eschenbach, 8., völlig neu bearbeitete Auflage, Stuttgart, Weimar 2004.
- Gerhardt, Christoph: Der ʻWillehalmʼ-Zyklus. Stationen der Überlieferung von Wolframs ʻOriginalʻ bis zur Prosafassung, Stuttgart 2010 (Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur; Beihefte; Beiheft 12).
- Greenfield, John; Lydia Miklautsch: Der ʻWillehalmʼ Wolframs von Eschenbach. Eine Einführung, Berlin, New York 1998.
- Heinzle, Joachim (Hg.): Wolfram von Eschenbach. Ein Handbuch – Studienausgabe, Berlin, Boston 2014.
- Hiestand, Rudolf: „Gott will es!” Will Gott es wirklich? Die Kreuzzugsidee in der Kritik ihrer Zeit, Stuttgart 1998.
- Jaspert, Nikolas: Die Kreuzzüge, 7., bibliographisch aktualisierte Auflage, Darmstadt 2020.
- Knefelkamp, Ulrich: Das Mittelalter. Geschichte im Überblick, 2., durchgesehene Auflage, Paderborn 2003.
- Kreft, Annelie: Perspektivenwechsel. Willehalm-Rezeption in historischem Kontext: Ulrichs von Türlin Arabel und Ulrichs von Türheim Rennewart, Heidelberg 2014 (Diss. Göttingen 2013 / Studien zur historischen Poetik; Band 16).
- Manuwald, Henrike: Medialer Dialog. Die ,Große Bilderhandschriftʻ des Willehalm Wolframs von Eschenbach und ihre Kontexte, Tübingen, Basel 2008 (Bibliotheca Germanica. Handbücher, Texte und Monographien aus dem Gebiete der Germanischen Philologie, 52).
- Runciman, Steven: Geschichte der Kreuzzüge, deutsch von Peter de Mendelssohn, München 1968 (Neudruck 1975).
- Saebel, Barbara: Toleranzdenken in mittelhochdeutscher Literatur, Wiesbaden 2003 (Imagines medii aevi 14).
Beitrag 6
Der mittelhochdeutschen Versnovelle ‚Aristoteles und Phyllis‘ liegt ein „in der Weltliteratur weit verbreitet[es] (AaTh1501)“ (Grubmüller 1996, S. 1188) Motiv des durch Frauenlist besiegten Weisen zugrunde. Im europäischen Hochmittelalter wurde es mit der Figur Aristoteles verbunden und fand rasch vielgestaltige Verbreitung: Die Geschichte vom überlisteten Aristoteles lässt sich in unterschiedlichen bildlichen Darstellungen (u. a. Elfenbeinkästchen, Steinskulpturen, Federzeichnungen) ebenso nachweisen wie in unterschiedlichen volkssprachlichen und lateinischen literarischen Zeugnissen (vgl. Herrmann 1991; Ott 1987).
Den Dynamiken des Begehrens (und des Wissens) in der mittelhochdeutschen Versnovelle möchte ich mich über einen Aspekt nähern, der auf den ersten Blick wenig zur Klärung ihrer Relationierung beitragen kann: Den Dimensionen des Sehens und damit dem menschlichen Auge.[^1 Der Beitrag ist eine geringfügig überarbeitete und um ausgewählte Literaturnachweise ergänzte Fassung meiner am 13.01.2022 im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft‚ Textdynamiken‘ (Universität Krakau / Universität Leipzig) gehaltenen Vorlesung.] Doch genau das Auge – und die mit ihm verbundene Aktivität des Sehens – ist zentral für zwei unterschiedliche Wissenstraditionen im Mittelalter: Zum einen steht das Anblicken, der visus, am Beginn der quinque linea amoris, der fünf Liebesstufen (vgl. Krause 2014). Zum anderen wächst dem Sehen zentrale Bedeutung für Erkenntnis- und Wissensprozesse zu. Sehen und Auge sind also sowohl für die Liebe (amor) als auch für die Wissensgenerierung (scientia) von zentraler Bedeutung.
Ich beginne jedoch zunächst (1) mit einer kurzen Einleitung, in der ich die mittelhochdeutschen Fassungen von ‚Aristoteles und Phyllis‘ vorstelle. Es folgt dann ein kleiner Exkurs (2) zum menschlichen Auge (und dem Sehen) am Schnittpunkt unterschiedlicher Wissenstraditionen. Im Anschluss (3) werde ich ein close-reading der jüngeren Fassung von ‚Aristoteles und Phyllis‘ vornehmen, das auf die Ausprägung und die Relationierung von Minne und Wissen fokussiert. Den Abschluss meines Beitrags (4) bilden Überlegungen, die das explorative Potential des Textes betreffen, das auf intrikate Weise mit jenen Dynamiken des Begehrens, mit jener Relationierung von Begehren und Wissen, verknüpft ist.
Einleitung
Die mittelhochdeutsche Versnovelle ‚Aristoteles und Phyllis‘ ist in zwei Fassungen erhalten, die jeweils ohne Verfassernamen überliefert sind. Die erste Fassung wird dabei eher an den Beginn des 13. Jahrhunderts, die zweite Fassung eher an das Ende des 13. Jahrhunderts datiert (vgl. Grubmüller 2011, S. 1187).
Die frühe, sogenannte Benediktbeurer Fassung (Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 5249/29b) von ‚Aristoteles und Phyllis‘ aus dem 13. Jahrhundert ist unikal und nur fragmentarisch überliefert. Bei Restaurierungsarbeiten an der Orgel der Klosterkirche von Benediktbeuern wurden 1964/65 mehrere Pergamentstücke in den Orgelpfeifen gefunden (vgl. Schneider 2005, S. 66f.).[^2 Abbildungen der Fragmente sind über die Bayerische Staatsbibliothek zugänglich: https://www.digitale-sammlungen.de/de/details/bsb00125597 (letzter Zugriff: 15.10.2022).] Die Fragmente sind einer Sammelhandschrift zugehörig, deren Format etwa 320 × 240 mm besaß.[^3 Vgl. Klein 2000, S. 186 (Nr. 6). Anders als die meisten Kleinepik Sammelhandschriften muss die Benediktbeurer Handschrift jedoch ursprünglich eine dreispaltige gewesen sein. (vgl. Klein 2000).] Erhalten haben sich auf den Fragmenten neben ‚Aristoteles und Phyllis‘, ebenfalls nur fragmentarisch: Freidank, Cato, ‚Die gute Frau‘ und ‚Der arme Heinrich‘ Hartmanns von Aue.[^4 Zur Überlieferung Hartmanns im Kontext der erhaltenen Fassung vgl.: Hammer / Kössinger 2012.]
Von der frühesten deutschen Fassung von ‚Aristoteles und Phyllis‘ haben sich nun in den Benediktbeurer Fragmenten zwei umfangreichere Passagen erhalten: zum einen die Verführungsszene der Phyllis und zum anderen eine Passage, die von der Auswahl des Sattels bis zum Textende reicht. Die erhaltenen Passagen erlauben es, eine grobe Handlungsführung zu rekonstruieren:
Am griechischen Hof ist Aristoteles beauftragt, den Königssohn Alexander – der später Alexander der Große genannt werden wird – zu unterrichten. Sein Schüler verliebt sich in die Kammerdame Phyllis. Der Philosoph erwirkt die Trennung der Liebenden. Die schöne Phyllis sinnt nun auf Rache und geht wohl gekleidet in die Nähe des kleinen Gartenhäuschens des Philosophen. Dort beginnt sie zu singen. Über das Ohr erreicht Phyllis die Augen des Meisters und es gelingt ihr, die Aufmerksamkeit zu gewinnen, die sie für ihr Vorhaben benötigt. Aristoteles beobachtet, wie Phyllis Blumen auf der Wiese pflückt und schließlich an einer Quelle aufreizend agiert. Nachdem Phyllis die Aufmerksamkeit des Philosophen erweckte und seinen Sehsinn aufreizend stimulierte, entschließt sie sich die Ebene des Anblickens zu verlassen und zu der des Gesprächs überzugehen. Das Geschehen verlagert sich in das Gartenhaus des Philosophen, der stark von der Schönheit der jungen Frau affiziert ist und nur zu gern mit ihr schlafen möchte. Phyllis stimmt dem zum Schein zu, äußert aber den Wunsch, zuvor mit einem Sattel auf Aristoteles reiten zu wollen. Dieser zögert jedoch, denn sollte der Ritt der Phyllis für die Öffentlichkeit sichtbar sein, so würde er sein Ansehen für immer verlieren. Aristoteles Bedenken erweisen sich als self-fulfilling prophecy, denn es kommt tatsächlich so, wie von ihm befürchtet: Phyllis reitet auf Aristoteles durch den Palastgarten und wird dabei von Mitgliedern des Hofes gesehen. Nach der öffentlichen Schande des Philosophen wird aus Alexander und Phyllis ein Paar – und Aristoteles ergreift beschämt die Flucht.
Für die Dynamiken des Begehrens konzentriere ich mich auf die jüngere Fassung, deren Entstehungszeit ins letzte Viertel des 13. Jahrhunderts fällt (Grubmüller 2011, S. 1186; Josephson 1934, S. 69). Wir wissen, dass sie in mindestens drei Handschriften überliefert wurde:[^5 Zur Überlieferung und Datierung vgl. die Angaben im Handschriftencensus und die zu den jeweiligen Überlieferungsträgern genannte weiterführende Literatur: https://handschriftencensus.de/werke/25 (letzter Zugriff: 15.10.2022).] Die Codices aus dem 14. Jahrhundert in Regensburg und in Straßburg sind durch Brände vernichtet worden. Einzig die späte Karlsruher Handschrift aus dem 15. Jahrhundert (vgl. Schmid 1974, S. 13) ist als Überlieferungsträger vollständig auf uns gekommen.
Die dort überlieferte Fassung von ‚Aristoteles und Phyllis‘ aus dem späten 13. Jahrhundert weist wörtliche Übereinstimmungen mit der frühen Fassung auf. Diese Übereinstimmungen weisen darauf hin, dass die spätere Fassung die frühere als Vorlage verwendet haben könnte (vgl. Rosenfeld 1970, S. 331). Dies lässt die begründete Vermutung eines generischen Verhältnisses beider Texte zu. Auch die Handlungsführung der jüngeren Fassung stimmt im Wesentlichen mit dem überein, was die Benediktbeurer Pergamentfragmente von der älteren Fassung preisgeben – bis auf den Schluss des Textes, der wesentlich erweitert wurde: Am Ende der Benediktbeurer Fassung stehen lediglich die kurze Erwähnung der Flucht von Aristoteles und das Happy End der Liebenden. In der jüngeren Fassung ist der Fokus am Ende ganz auf Aristoteles gerichtet: Ausführlich wird von seiner Abreise berichtet und davon, dass er auf der Insel Galicia ein Buch über die Frauenlist geschrieben habe. Darauf werde ich noch ausführlich zurückkommen.
Über diese Veränderung am Textende hinaus trägt zur erheblichen Erweiterung des Textumfanges der jüngeren Fassung die Inkorporation von vier Textpassagen aus dem ‚Tristan‘ Gottfrieds von Straßburg bei. Dem forschungsgeschichtlich breit ausgearbeiteten Aspekt der sog. ‚Tristan‘-Rezeption widme ich mich in diesem Beitrag jedoch nicht. Ich verweise lediglich auf die Beiträge von Burkhard Wachinger (vgl. Wachinger 1970) und Hedda Ragotzky (vgl. Ragotzky 1996) zum Thema.
Exkurs: Das Sehen, die Liebe und die menschliche Wahrnehmung
Seit der Antike fällt unter den menschlichen Sinnesorganen dem Auge – und damit dem Sehen – eine besondere, eine privilegierte Stellung zu. Dies zeigt sich u. a. an den Debatten, die beginnend in der Antike über die Funktionsweise des Sehens geführt wurden (vgl. Park 1997, S. 3–50; Lindberg 1976, S. 1–17). Das Hochmittelalter ist dabei von einem Übergang geprägt:
Bis etwa 1200 war die platonische Sehtheorie dominant. […] Es handelt sich um eine Extramissionstheorie, die davon ausgeht, daß dem Auge Licht oder Feuer eignet, das beim Sehen als Strahlung aus dem Auge austritt und sich mit dem Tageslicht zu einem Lichtkörper verbindet. (Kellner 1997, S. 42f.)
Diese Theorie (basierend auf Platons ‚Timaios‘), die u. a. auch für Augustinus Perspektive auf das Sehen zentral war, wird konfrontiert mit der Intramissionstheorie, die durch die Rezeption persischer und arabischer Gelehrter (etwa Al-Hazen, Avicenna und Averroes) Europa im 12. und 13. Jahrhundert erreichte (vgl. Lindberg 1976, S. 87–121).
Alhazen geht in seiner Intramissionstheorie von einer Strahlung von den Objekten aus. Diese erfolge jedoch nicht, wie die Atomisten angenommen hatten, als materielles simulacrum des ganzen Objektkörpers, sondern als immaterielle Strahlung, die von jedem Punkt auf der Oberfläche eines jeden farbigen, durch Licht beleuchteten Körpers ausgesandt wird und jeweils senkrecht auf die einzelnen Punkte der cornea trifft. (Kellner 1997, S. 43)
Die hohe Bedeutung, die optischen Theorien im Hochmittelalter zugesprochen wurde, lässt sich u. a. daran ablesen, welch großes Gewicht z. B. Albertus Magnus (um 1200–1280) der aktuellen Diskussion beimaß.[^6 Vgl. hierzu etwa Lindberg 1976, S. 105: „The problem that dominates the optical parts of Albert’s opera is vision. This occupies some sixty pages of De homine, nineteen of De anima, thirtytwo of De sensu, and nineteen of De animalibus (all in Borgnet’s edition).“] Albertus Magnus setzte sich u. a. in ‚De sensu et sensato‘ in der Mitte des 13. Jahrhunderts mit den tradierten Auffassungen zur menschlichen Wahrnehmung auseinander (vgl. Akdogan 1978). Die Arbeit ist von einem streng logischen Zugriff auf Fragen der visuellen Wahrnehmung geprägt. Die innerhalb des Traktats genannten Gelehrten (u. a. Platon, Aristoteles, Demokrit, Euklid, Empedokles, Avicenna, Averroes, Al-Hazen, Al-Kindi) zeugen nicht nur von der umfassenden Kenntnis des Verfassers, sondern sie zeichnen den Wissens- und Reflexionshorizont der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ab (vgl. Akdogan 1978, S. 5–22).
Auch das Grundprinzip menschlicher Wahrnehmung, das prägend für das 13. Jahrhundert ist, findet sich bei Albertus beschrieben. Ingrid Craemer-Ruegenberg hat es folgendermaßen zusammengefasst:
Nach Avicenna, sagt Albert in seiner Schrift Über Gedächtnis und Erinnerung, sind drei Teile im menschlichen Gehirn anzunehmen, die alle eine gewisse Organfunktion haben. Im vorderen Hirn sitzt das Quasi-Organ für die äußere Wahrnehmung und für die Verbindung der Einzelwahrnehmungen zu einer Gesamtwahrnehmung (sensus communis), für die Vorstellungskraft und die Einbildungskraft (imaginativa und phantasia); im mittleren Hirn befinden sich die physiologischen Instanzen für die animalische ‚Urteilskraft‘ (aestimativa), mit deren Hilfe Dinge voneinander unterschieden und auf ihren Überlebenswert hin eingeschätzt werden; im hinteren Hirn schließlich ist der Sitz des Gedächtnisses (memoria). Auf diese Lokalisation habe man deswegen geschlossen, weil bei unterschiedlichen Kopfverletzungen die entsprechenden Fähigkeiten ausfallen. (Craemer-Ruegenberg 2005, S. 154)
Dieses Zusammenspiel ist auch in der Buchmalerei dargestellt worden, etwa im ca. 1310 entstandenen MS Gg.1.1 der Cambridge University Library (vgl. Sudhoff 1913, S. 149–205, S. 184–189).[^7 Abbildung und Codex sind online verfügbar: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-GG-00001-00001/988 (letzter Zugriff: 15.10.2022).] Zu sehen ist dort der Kopf eines Mannes im Dreiviertelprofil als Illustration zu einem im Mittelalter Thomas von Aquin zugeschriebenen Traktat. Der Kopf und die Gehirnregion des Mannes sind beschriftet. Zwei Sehnerven leiten hier die Sinneseindrücke zum sensus communis vel sensatio und zu ymaginatio vel formalis. Darüber befindet sich die estimativa. In einem Kreis im Hinterkopf ist die vis memorativa dargestellt.[^8 Die Miniatur ist in den Text Qualiter caput hominis situatur eingefügt, der sich zu Beginn auf die 78. quaestio der Summa Theologica des Thomas von Aquin bezieht: De ista materia tractat Thomas in prima parte summae quaestione 78 articulo quarto […]. Zitiert nach der Transkription durch Sudhoff 1913, S. 184.]
Dass es sich hierbei nicht um ein abseitiges, ausschließlich den Eliten vorbehaltenes Wissen handelt, zeigt der weitverbreitete mittelhochdeutsche ‚Welsche Gast‘ – ein umfassendes Wissenskompendium des Klerikers Thomasin von Zerklaere (um 1186–1238). Auch hier findet sich jenes Grundprinzip erläutert:[^9 Text und Übersetzung zitiert nach: Willms 2004, S. 106f.]
Ein ieglîcher vier krefte hât,
von den er sol suochen rât.
die vier kreft sint sô getân,
daz in sint undertân
aller wîstuom und alle tugent
beidiu an alter und an jugent.
(V. 8789–94)
[…]
Einiu heizt imaginâtiô,
diu ander heizet râtiô,
diu drite memorjâ ist,
diu phleget der kamer zaller vrist,
die vierd ich intellectus heiz.
(V. 8799–8803)
[…]
imaginâtiô ir swester gît,
swaz vor den ougen lît.
memorjâ behalten kan
wol, swaz ir swester ê gewan.
intellectus und râtiô
hânt ane imaginâtiô
und an ir swester meisterschaft;
die dienent ir nâch eigenschaft.
Swaz imaginâtiô begrîft,
ez sî anders od mit gesiht,
ez sî wâzend ode rüerent,
ez sì smeckend ode hoerent,
daz sol si hin zir vrouwen bringen,
sô mag ir niht misselingen.
râtiô bescheiden sol,
waz stê übel ode wol,
und sol emphelhen, swaz ist guot
der memorjâ ze huot.
(V. 8813–8830)‚Jeder hat vier Kräfte, deren
Hilfe er in Anspruch nehmen kann.
Die vier Kräfte sind so beschaffen,
daß ihnen untertan sind
alle Weisheit und alle Tugend
im Alter wie in der Jugend.
[…]
Eine heißt imaginatio,
die zweite heißt ratio,
die dritte ist die memoria,
die hütet stets die Vorratskammer,
die vierte nenne ich intellectus.
[…]
imaginatio liefert ihrer Schwester,
was vor Augen liegt. Memoria
kann aufbewahren, was ihre
Schwester zuvor aufgenommen hat.
intellectus und ratio haben
die Herrschaft über imaginatio
und über ihre Schwester;
sie dienen ihr als Untergebene.
Was imaginatio aufnimmt,
sei es durch Sehen oder sonstwie,
sei es riechend oder tastend,
sei es schmeckend oder hörend,
das soll sie zu ihrer Herrin bringen,
dann kann sie nicht fehlgehen.
Ratio soll unterscheiden,
was gut und was böse ist,
und soll, was gut ist, der memoria
zur Aufbewahrung empfehlen.‘
Thomasin beschreibt in dieser Passage, wie durch das Zusammenwirken von imaginatio, ratio, memoria und intellectus die menschliche Wahrnehmung erfolgt und wie alle Weisheit und alle Tugend diesem Zusammenwirken ausgeliefert sind. Die imaginatio ist dabei die Kraft, die Dinge (insbesondere) über den Sehsinn wahrnimmt. Auge und Sehen sind damit auf einer ersten Stufe für das Erkennen von Dingen von elementarer Bedeutung. Die imaginatio leitet das Erfahrene dann zur ratio, die als Herrin über die Sinne agiert und zwischen Gutem und Bösem unterscheiden kann und das Gute schließlich der memoria zur Aufbewahrung überantwortet. Hier deutet sich an, wie zentral das Auge für die menschliche Wahrnehmung und das Denken ist.
Die Bedeutung, die das menschliche Auge für die Wahrnehmung besitzt, zeigt sich aber auch darin – darauf hat Horst Wenzel hingewiesen –, dass „seit Aristoteles“ bei der „Aufzählungen der fünf Sinne“ die Augen zumeist die erste Position einnehmen (Wenzel 1995, S. 48). Diese Tradition setzt sich im Mittelalter fort. So findet sich auch bei Thomasin von Zerklaere eine Reihenfolge, in der dem visus die erste Position eingeräumt wird:[^10 Text und Übersetzung zitiert nach: Willms 2004, S. 117.]
Jâ hât ieglîch man und wîp
vümf tür in sînem lîp:
ein ist gesiht, diu ander gehoerde,
diu dritte wâz, diu vierde gerüerde,
die vümften ich gesmac heiz.
swaz man in der werlde weiz,
daz muoz in uns immer vür
ze etlîcher der vümf tür.
(V. 9449–9456)‚Jeder Mann und jede Frau hat bekanntlich
fünf Pforten an seinem Leib: Die erste
ist das Sehen, die zweite das Gehör, die
dritte der Geruchs-, die vierte der Tastsinn,
die fünfte nenne ich den Geschmackssinn.
Was man von der Welt zur Kenntnis nimmt,
das muß in unser Inneres durch
eine oder mehrere der fünf Pforten.‘
Aufeinander folgen in der Aufzählung der fünf Sinnestüren also das Sehen (gesiht), das Hören (gehoerde), der Geruchssinn (wâz), Tastsinn (gerüerde) und schließlich der Geschmackssinn (gesmac).[^11 Katharina Philipowski hat wahrscheinlich machen können, dass Thomasin direkt auf die Alchers von Clairvaux zugeschriebene Abhandlung ‚De spiritu et anima‘ (um 1170) aufbaute. Vgl. Philipowski 2013, S. 60–66.]
Eine ähnliche Reihenfolge lässt sich nun aber auch bei den über die antiken Autoren ins Mittelalter überlieferten fünf Liebesstufen, den quinque lineae amoris, feststellen. Hier folgen ebenfalls aufeinander: visus, colloquium und tactus (vgl. Schnell 1985, S. 26–28; Bein 2003, S. 60). Auch diese Reihenfolge war wirkmächtig. Noch beim wohl wichtigsten Lautenisten des elisabethanischen Zeitalters – bei John Dowland (1563–1626) – heißt es im Lied ‚Come again‘: To ee, to heare, to touch, to kie, to die, With thee againe in weetet pathy.[^12 Lied XVII zitiert nach dem Erstdruck von 1597: The first booke of songes or ayres of fowre partes with tableture for the lute: so made that all the partes together, or either of them seuerally may be song to the lute, orpherian or viol de gambo. Composed by Iohn Dowland lutenist and Batcheler of musicke in both the vniversities. Also an inuention by the sayd author for two to playe vpon one lute, [London]: Printed by Peter Short, dwelling on Bredstreet hill at the sign of the Starre, 1597, o.S.]
Die hier aufgezeigten beiden Reihenfolgen (die Aufzählung der fünf Sinne und die Liebesstufen) entstammen unterschiedlichen Traditionen – aber dem Auge wächst in beiden mit der ersten Position entscheidende Bedeutung zu.
Wie wichtig etwa der visus für die Liebesstufen ist, lässt sich exemplarisch am ersten Buch von ‚De amore‘ (entstanden um 1180) des Andreas Capellanus zeigen. Dort stellt er fest, dass neben zu hohem oder zu jungem Alter auch die Blindheit dazu führen kann, nicht lieben zu können:[^13 Text und Übersetzung zitiert nach: Knapp 2006, hier S. 18–21.]
Caecitas impedit amorem, quia caecus videre non potest, unde suus possit animus immoderatum suscipere cogitationem, ergo in eo amor non potest oriri […]
[‚Die Blindheit verhindert die Liebe, weil ein Blinder das nicht sehen kann, wovon sein Gemüt die unmäßige gedankliche Beschäftigung empfangen könnte. Daher kann in ihm die Liebe nicht entstehen‘.]
Auch in meiner Lektüre der Versnovelle von ‚Aristoteles und Phyllis‘ wird auf den visus zurückzukommen sein.[^14 Zum begehrenden Blick in höfischer Erzählliteratur vgl. auch: Egidi 2011. Egidi betont dabei insbesondere die Asymmetrie innerhalb der Subjekt Objekt Relation. Vgl. ebd., S. 128.] Doch das Sehen – so habe ich hoffentlich zeigen können – ist nicht nur für die Entstehung der Liebe zentral. Auch im Mittelalter wird es als ebenso grundlegend für den Zugriff des Menschen auf die Welt betrachtet.
Close-Reading von ‚Aristoteles und Phyllis‘ (K 408)
Im folgenden close-reading fokussiere ich insbesondere das Sehen im Kontext der Liebesstufen sowie das Sehen im Kontext der Kulturtechnik des Lesens (und Schreibens).[^15 Zum Begriff ‚Kulturtechnik‘ vgl. Bredekamp / Krämer 2003, hier S. 18f.] Beides dient dazu, den Dynamiken des Begehrens in diesem Text auf die Spur zu kommen.
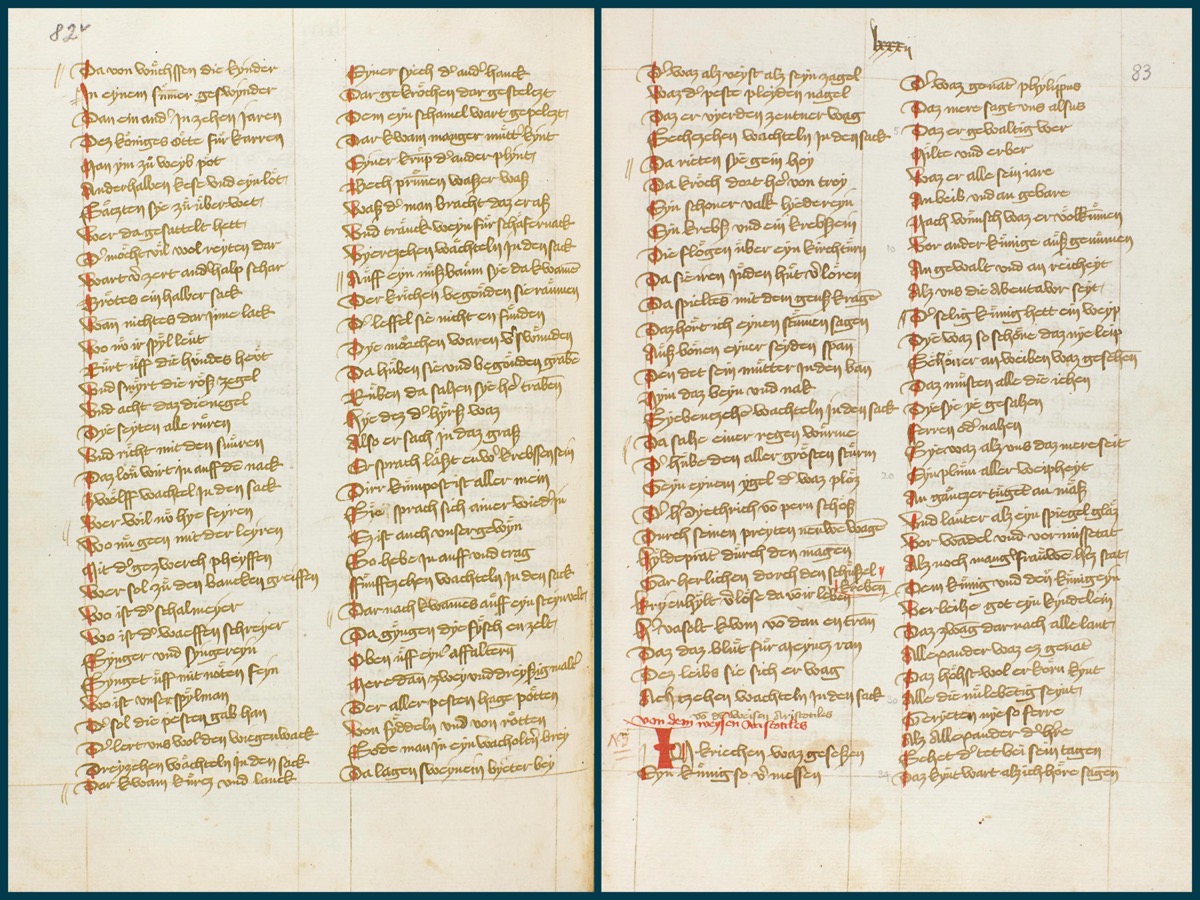
Abbildung 1: BLB Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Deutsche poetische Erzählungen – Cod. Karlsruhe 408, fol. 82v und 83r. Der Beginn von ‚Aristoteles und Phyllis‘ in K 408 (rubrum: von dem weisen aristotiles). (https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-1298)
Exposition
Die Versnovelle setzt mit einer ausführlichen Exposition ein, in der zunächst die Eltern Alexanders eingeführt werden. König Philipp lässt Aristoteles an seinen Hof kommen, damit er seinen Sohn, den noch jungen Alexander, unterrichte. Er lässt für den Meister ein kleines Haus im Palastgarten errichten, in dem der Unterricht mit dem begabten Schüler stattfindet. Aristoteles verpflichtet sich, Alexander zu erziehen und zu unterrichten, um ihn auf sein späteres Amt vorzubereiten. Von diesem Unterricht wird einzig das Erlernen des Alphabets im Text expliziert:[^16 ‚Aristoteles und Phyllis‘ zitiert nach: Schmid 1974, S. 348–362. Dabei gebe ich Schrägtrema als Trema, geschwänztes als reguläres z wieder]
Der meynster nam den jüngen knaben
Vnd lerte jn die püchstaben
A b c d e.
Daz tet ym an dem ersten we,
Alz ez noch tüt den jüngen,
So sye seint bezwüngen
Mit schülmeynster scheffte.
(V. 69–75)‚Der Meister nahm den jungen Knaben zu sich
und lehrte ihn die Buchstaben:
A b c d e.
Das bereitete ihm zunächst große Mühe,
wie noch heute den Kindern,
wenn sie bedrängt werden
mit dem Unterricht der Schule.‘
Alexander und Phyllis
Das Sinnen des Prinzen richtet sich nun aber nicht ausschließlich auf den Unterricht, sondern schon bald auf die junge Phyllis. Mit topischen Formulierungen wird das Verlieben im Text artikuliert und ebenso topisch wird der junge Mann seines Verstandes durch Phyllis beraubt. Die Inbesitznahme des Prinzen durch die strenge mynne (also durch die ‚gewaltige‘ oder ‚unerbittliche Frau Minne‘) wird im Text mit der Schönheit der jungen Frau begründet und wiederholt mit der Tätigkeit des Anblickens verknüpft
Doch wart er leyder gepfant
An wiczen vnd an synnen;
Daz det die strenge mynne.
Dye künigein het eyn magt,
Dye waz schön, alz man sagt,
An leyb vnd an varbe,
Daz man sich garbe
Völligklichen het ersehen.
Dye schöne an weyben spehen,
Sye sprach‹en›, daz sye were
Schöne vnd lobenbere
Sye waz von hohem kvnne,
Der werlt gar eyn wünne.
(V. 82–94)‚Doch wurde er leider
seines Verstandes und seiner Sinne beraubt.
Das tat die unerbittliche (Frau) Minne.
Die Königin hatte eine Kammerdame
die war schön – wie man erzählt –
an Gestalt und Aussehen,
dass man sich gar
völlig in ihrem Anblick verlieren konnte.
Diejenigen, die Schönheit von
Frauen erkennen,
sie sagten, dass sie schön und untadelig wäre.
Sie war von hoher Abkunft –
eine Freude für die Welt.‘
Wird die Verwirrung der Sinne für Alexander eingangs nur konstatiert, erklären die folgenden Verse die Ursache: Es ist die außergewöhnliche Schönheit der Phyllis, die innerhalb weniger Verse wiederholt mit Verben des Anblickens markiert wird.
Es folgt dann eine Darstellung der Minnekrankheit, gefolgt von einer nochmaligen Betonung des Blicks:
Allexander wart en prant
Jn ir mynne glüt;
Ver irret an seinem gemüt
Wart der jünge herre
Er ge dacht ym ferre,
Wye ym der sorgen pürde
Eyn teil geleicht würde.
Sein lern waz verirret gar,
Er name der jungfraüwen war;
Wenn er der nicht en sach
So sach man größ vngemach
An dem jüngelinge.
Wen nü die mynne zwynge,
Der merck wye ym were.
Allexander der marterere
En west wye er solt geparn.
(V. 98–113)‚Alexander wurde in glühender Liebe
zu ihr entzündet.
Verwirrt in seinem Gemüt
wurde der junge Mann.
Er dachte eifrig darüber nach,
wie ihm die Last des Kummers
etwas erleichtert würde.
Sein Lernen war völlig blockiert.
Er nahm nur noch die junge Frau wahr.
Wenn er sie nicht sehen konnte,
dann sah man den Jüngling
in großer Unzufriedenheit.
Wen nun selbst die Liebe bedrängt,
der sehe, wie es ihm erging:
Alexander, der Märtyrer,
wusste nicht, was er machen sollte.‘
Der junge Alexander wird zum Minnemärtyrer aufgrund der Qualen, die er erleiden muss. Dabei findet mit der Glut der Liebe klassische Minnetopik Verwendung. Sie führt zu einer Verwirrung der Sinne und des Verstandes, sodass auch das Lernen des Schülers beeinträchtigt ist. Explizit betont wird dabei abermals das Ansehen und Wahrnehmen: Wenn Alexander seine Geliebte nicht sehen kann, dann ist das daraus folgende große Leid an ihm ersichtlich. Sehen, Anblicken und Wahrnehmen besitzen für das Beschreiben der Liebe Alexanders somit elementare Bedeutung auf der Ebene der sprachlichen Realisierung. Die (auch) visuelle Trennung vom geliebten Objekt führt zu Minnequalen, die – auch das markiert der Text explizit – zur Störung der Lernfähigkeit des jungen Prinzen führt: Sein lern waz verirret gar (‚Sein Lernen war völlig blockiert‘, V. 105). Bereits hier zeigt sich damit eine Spannung zwischen amor und scientia, die für den Fortgang der Geschichte wesentlich ist. Es ist explizit die strenge mynne (V. 84), die am jungen Alexander wirkt und seine Sinne verwirrt. Bereits in der Ausgestaltung des Verliebens wird Alexander als Minnesklave inszeniert.
Zugleich findet eine erste Verschiebung von scientia zu amor statt. Beide Systeme operieren dabei mit der Optik: Das Erlernen ist gebunden an die Schrift und damit an die visuelle Wahrnehmung. Die Schönheit der Phyllis nimmt Alexander ebenfalls über den Sehsinn (visus) wahr.
Auffallend innerhalb der Minnedarstellung ist, dass im gesamten Text die Exklusivität und die Gegenseitigkeit der Minnebeziehung zwischen Alexander und Phyllis betont wird, sodass sye eyn müt gewunnen / Vnd nach einander prünnen (‚sodass sie eine Gesinnung gewannen / und füreinander entbrannten‘, V. 127f.). Diese Minnebindung unterläuft nun den Wunsch des Philosophen Alexander adäquat zu unterrichten. Mit slegen vnd mit wörten (‚Mit Schlägen und mit Worten/Zureden‘, V. 154f.) versucht der Lehrer seinen Schüler von der Störung abzubringen – doch erfolglos. Es bleibt schließlich nur die Option, den König vom aktuellen Geschehen zu unterrichten und ihn zur Intervention zu veranlassen. Dies führt zu einer ersten längeren Rede der Phyllis, in der sie ihre ehrenhaften Absichten und ihre Treue zum Ausdruck bringt. Eigenschaften, die auch später im Text, etwa durch den Erzähler, stets präsent bleiben. Durch die Trennung vom Geliebten bricht sich auch an ihr die Minnekrankheit Bahn, sodass ihr Körper aller Kraft und Freude beraubt ist. Im unmittelbaren Anschluss werden dann die Liebesqualen Alexanders beschrieben – und, dass Aristoteles mit seiner Maßnahme nur wenig Erfolg beschieden ist. Denn sein Schüler sitzt erzürnt in seinem Unterricht und prummend alz ein per (‚brummend wie ein Bär‘, V. 199).
Phyllis’ Rache
Phyllis will nicht in diesem Zustand verharren. Sie ist es, die auf Rache sinnt und die diese durchführen wird. Ausführlich berichtet der Text vom Aufputz der jungen Frau, in der abermals die optische Wahrnehmung betont wird. Aus der bereits schönen Kammerdame wird durch das Ankleiden mit edlen Stoffen und Accessoires Filis die liecht snne gläncz (‚Phyllis der leuchtende Glanz der Sonne‘, V. 293). Neben dieser Formulierung, finden sich noch weitere, die wiederholt den visuellen Sinn betonen. Mit dieser Hervorhebung des Sehsinns wird nicht nur an die Verse angeschlossen, mit denen Phyllis in den Text eingeführt wurde, sondern es wird nochmals ihr besonderer visueller Reiz betont, dem auch Aristoteles nur wenige Verse später erliegen wird. Und das setzt der Text wie folgt um:
Nü laßen wir diz rede stan
Vnd vahen wir daz wieder an,
Daz ez ‹icht› pleib in wan:
Filis die wol getan
Gieng spielent vnder die plüt.
Vil stölcz waz ir gemüt.
Sye sleich her vnd hyn;
Daz sahe er dürch ein vÿnsterlein,
Der alt meynster vnd plickt dar
Vnd nam ir geperde war.
Die daücht jn gar wonderleich,
Er sahe sie gar mynnekleich.
Wye schone vnd wie geheẅr,
Wie gar schöne creatür
Jst daz mynnecleich weip;
Der selig man, der seinen leip
Solt mit ir alten!
(V. 334–350)‚Nun belassen wir es damit und
wenden uns wieder der Geschichte zu,
damit nichts offenbleibt.
Phyllis, die Wunderschöne,
ging vergnügt zwischen den Blumen.
Hochgestimmt war ihr Sinn.
Sie streifte hin und her.
Das sah er durch ein kleines Fenster,
der alte Lehrer, und schaute dorthin,
und nahm ihr Verhalten wahr,
das ihm gar sonderbar vorkam.
Er betrachtet sie mit Liebreiz:
‚Was für eine schöne und reizende
und liebliche Gestalt
ist diese anmutige Frau.
Der ist ein glücklicher Mann,
der mit ihr alt werden kann.‘‘
Aristoteles erblickt durch ein Fenster die junge Frau und ist offenbar stark von ihrer Schönheit affiziert. Auf die visuelle Wahrnehmung folgt unmittelbar die Introspektion, in der Aristoteles über den glücklichen Mann nachsinnt, der mit dieser Frau alt werden darf. Diesen Gedanken folgen topische Zeichen der Minne wie der schnelle Wechsel von Hitze und Kälte.
Gerade im richtigen Moment kommt Phyllis auf das Haus des Philosophen zu und provoziert ein Gespräch. Ihr Aufputz und ihre Performance im Garten haben offensichtlich die gewünschte Wirkung erzielt. Aristoteles bittet die junge Frau in sein Haus und bringt sein Begehren schnell auf den Punkt:
Er sprach: „jch bin an wiczen
Vnd an synnen gepfant.
Jch han erfaren manig lant,
Jch gesach nye kynt so wol getan.
Laß mich dein hülde han.
Jch gib dir göldes zwenczig marck
Vnd füre dich jn mein arck,
Nym dar aüs wie vil dü wilt.“
(V. 383–390)‚Er sagte: „Ich bin meines Verstandes
und meiner Sinne beraubt.
Ich habe viele Länder gesehen,
doch noch nie ein so schönes Kind.
Schenke mir Deine Gunst!
Ich gebe Dir (dafür) zwanzig Mark Gold
und führe Dich zu meiner Truhe.
Nimm daraus, so viel Du willst!“‘
An der konkreten narrativen Ausgestaltung fällt auf, dass Aristoteles in direkter Rede mit gepfant (‚beraubt‘) ein Verb verwendet, das im Text zuvor (V. 82) für das Verlieben seines Schülers verwendet wurde. Damit werden die Begehren von Alexander und Aristoteles sprachlich miteinander verbunden. Doch es zeigt sich sehr deutlich, dass es Aristoteles nicht um höfische Minne geht. Er bietet Phyllis materielle Güter, um zu einem schnellen Ziel zu kommen. Damit dient die Parallelisierung der Affizierung beider Männer (über das Sehen und die Schönheit der jungen Frau, über das gleiche Verb) der Kontrastierung der Minnekonzepte: Alexanders Liebesqualen werden mittels höfischer Minnesprache erzählt und sind am literarischen Konzept der höfischen Minne (u. a. Exklusivität, Existenzialität und Gegenseitigkeit der Liebe) geschult. Aristoteles hingegen wird zwar ebenfalls von einem Begehren affiziert, aber es ist eindeutig ein triebhaftes Begehren. Anders als bei seinem Schüler zeigt sich ökonomische Sprache bei seinem Versuch, die Gunst der Phyllis zu gewinnen. Der greise Philosoph fällt so der List anheim und muss letztlich an seiner eigenen Existenz zeigen, dass die scientia der Minne nicht überlegen ist. Die Kontrastierung der Minnekonzepte erfolgt zum einen über die verwendete Sprache, zum anderen über die Handlungen der Protagonisten.
Aristoteles bittet Phyllis also, mit ihm zu schlafen. Sie weist die Bitte zunächst brüskiert ab, sieht dann aber einen Sattel im Raum liegen und bietet dem Philosophen einen Handel an: Lässt er sich von ihr wie ein Pferd mit einem Sattel reiten, wird sie tun, was ihm beliebt.
Der gerittene Aristoteles
Aristoteles willigt nun in den von Phyllis vorgeschlagenen Handel ein, lässt sich satteln und trägt Phyllis in den pamgarten(V. 494), jenen Garten, der zuvor den heimlichen Treffen von Alexander und Phyllis diente. Die Königin und einige ihrer Damen verfolgen das Schauspiel vom topischen Ort der höfischen Dame, von den zinnen der Burg. Damit wird die erfolgreiche Rache der Phyllis über den Philosophen auch raumsemantisch ins Bild gesetzt, denn sowohl Phyllis als auch die Königin befinden sich in erhöhter Position gegenüber dem Philosophen, der zuvor Phyllis bezichtigte und die Königin zur Intervention veranlasste.
Nachdem die Königin und ihre Damen das merkwürdige Schauspiel betrachteten, spricht Phyllis alles offen gegenüber Aristoteles aus – und entschwindet fröhlich in die Burg – und aus der Geschichte. Ihre Rache ist erfüllt, von nun an steht allein Aristoteles im Fokus der Handlung. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht über den Ritt der Phyllis am Königshof.
Aristotelesʼ Flucht und Exil
Anders als in der älteren Fassung weiß der jüngere Text nichts von einem Zusammenleben von Alexander und Phyllis zu berichten. Er lässt dies offen. Stattdessen folgt eine längere, besonders reizvolle Schlusspartie: Nachdem offensichtlich geworden ist, dass Aristoteles sein eingangs formuliertes Versprechen, den Königssohn in großem Ansehen zu erziehen und ihm Orientierung in der Welt zu vermitteln, nicht halten kann, verlässt er den Königshof:
Dar nach jn einer wochen
Nam der meynster zü hant
Sein pücher vnd sein gewant
Vnd alle sein habe
Vnd schickt ez bey nacht hyn abe
Heymlich jn eynem schifflein.
(V. 521–526)‚Eine Woche darauf
nahm der Meister sogleich
seine Bücher und seine Kleidung
und seine ganze Habe
und sandte alles in der Nacht hinab
heimlich auf ein kleines Schiff.‘
Anders als in anderen Überlieferungsträgern – wie etwa dem Straßburger Codex, in dem noch weiterer materieller Besitz des Philosophen mit Sin golt, in ilber […] (S, V. 522)[^17 Zitiert nach Sprague 2007.] erwähnt wird – fokussiert der Karlsruher Codex vor allem auf dessen Bücher. Diese Fokussierung auf die Codices in K greift die eingangs am Erlernen des Alphabets präsente Kulturtechnik des Lesens wieder auf.
Aristoteles bricht also heimlich in der Nacht auf, verlässt mit einem Schiff den Ort und gelangt schließlich auf eine Insel. Dort lässt er sich nieder, widmet sich wieder der scientia und schreibt ein Buch über die Listen der Frauen und wie sie so manchen Mann beschädigten.
Er kwam gevaren jn eyn stat,
Jn ein jnsel hieß Galicia.
‹Da› bleip er vnd machet da
Eyn michel püch vnd schreip daran,
Waz wünderliches kan
Daz schön vn getrew weip
Vnd wie ir leben vnd ir leip
Mangen hat verseret.
Der sich an sie keret,
Der wirt von jn gevangen
Alz der fysch an dem angel,
Alz der vögel an dem strick.
Jr lage, ir aügen plicke
Vahen alz der augsteyn.
Jch bin dez kümmen über eyn,
Daz da für nicht helffen kan,
Wan daz iegklich weiß man,
Der gern an freyse sey,
Der sey ir geselleschafft frey
Vnd fliehe ferre von jn hin dann,
Anders nicht gehelffen kan.
(V. 535–555)‚Er gelangte an einen Ort,
auf einer Insel, namens Galicia.
Dort blieb er und verfertigte
ein großes Buch und schrieb auf,
zu welchen außerordentlichen Dingen
die schöne, treulose Frau fähig ist;
und wie ihr Lebenswandel und ihr Körper
vielen geschadet hat.
Wer sich ihnen zuwendet,
der wird von ihnen gefangen,
wie der Fisch an der Angel,
wie der Vogel im Netz.
Ihr lauernder Hinterhalt, der Blick ihrer Augen,
ergreifen wie ein Magnet.
Ich bin zur Einsicht gelangt,
dass dagegen nichts zu helfen vermag,
außer, dass jeder kluge Mann,
der gern ohne Schrecken leben möchte,
ihre Gesellschaft meiden
und weit von ihnen fliehen solle.
Anderes vermag nicht zu helfen.‘
Abschließend setzt der Text den schreibenden Gelehrten ins Bild, in einer Art und Weise, in der – darauf hatte Burghart Wachinger bereits hingewiesen – „die Inhaltsangabe des Buchs, das Aristoteles schreibt, […] nahtlos ins Epimythion gleitet“ (Wachinger 1975, S. 77): Ein nicht näher bestimmtes Ich erklärt hierin, dass ein Mann sich vor den Listen der Frau nur schützen kann, wenn er sich von ihrer Gesellschaft fernhält. Letztlich erwächst daraus sogar die Möglichkeit, dass es sich um eine mise en abyme handelt: Dass also das Epimythion selbst aus dem Buch des Philosophen stammen könnte.[^18 In K 408 folgen noch einige weitere Verse. Hierauf bin ich im Rahmen der Vorlesung, die einführenden Charakter besaß, nicht eingegangen] Dasjenige, das sich im vermeintlichen Buch des Aristoteles findet, ist aus seiner Position sicherlich verständlich – aber es widerspricht doch eklatant dem, was im Text erzählt wird. Die Formulierung am Ende fügt sich damit nicht zum vorherigen Text. Die Folgerung im Epimythion, dass man(n) sich nur schützen kann, indem man den Frauen flieht, macht im heteronormativen Verständnis mittelalterlicher Erzählliteratur keinen Sinn (vgl. Rasmussen 2015, S. 207f.). Mit diesen offensichtlichen und gezielt im Text eingesetzten Diskrepanzen am Schluss (unlogisches Epimythion und Konflikt zwischen den ungetriuwen wîben und Phyllis) öffnet sich das explorative Potential der Versnovelle.
Exploration
Betrachtet man ausschließlich die Handlungslogik von ‚Aristoteles und Phyllis‘, so könnte man das zentrale Thema leicht mit amor vincit omnia benennen.[^19 Vergil: Ekloge 10, 69 eigentlich: omnia vincit amor. Zitiert nach: Holzberg 2016, hier S. 10. Zur weiten Verbreitung vgl. etwa die Präsenz als Teil eines Gürtelendbeschlags (ca. 1325–1350), heute Dauerausstellung Alte Synagoge Erfurt: vgl. https://thue.museum-digital.de/object/1544 (letzter Zugriff: 15.10.2022).] Der Text selbst, die Interaktion der unterschiedlichen Dimensionen des Sehens und auch die sprachliche Realisierung machen es allerdings keineswegs so einfach. Vielmehr markieren die Diskrepanzen zwischen dem Epimythion und der Geschichte ein exploratives Potential des Textes.
Ich komme hierfür zunächst nochmals auf den Schluss der Erzählung zurück. Dieses Ende ist in der Forschung ganz unterschiedlich interpretiert worden. Ich gebe nur zwei (hier stark verkürzte und dadurch) kontrastive Beispiele. Klaus Grubmüller konstatierte etwa:
Aristoteles […] verläßt den Hof mit all seiner Habe und zieht sich auf eine Insel zurück, in ein Leben als Gelehrter, wie es ihm nach dem Versagen als öffentliche Person wohl ansteht. Dort bewältigt er die traumatische Erfahrung als Schriftsteller: Er schreibt ein Buch über die Gefährlichkeit der Frauen. Auch dieser Rückzug in eine angemessene Existenz macht die Würde der deutschen Fassung aus. (Grubmüller 2006, S. 168)
Diese Lektüre ist durchaus denkbar – insbesondere wenn man etwa diese Fassung mit der Benediktbeurer Fassung oder aber mit dem ‚Lai d’Aristote‘ vergleicht. Ann Marie Rasmussen hat hingegen die Komik des Erzählausgangs betont:
Aristotle sitting alone and far from court on an island, angrily denouncing women for his own failings: surely this is intended not as tragedy but as comedy. (Rasmussen 2015, S. 208)
Beide Forschungspositionen zeigen denkbare und jeweils auch berechtigte Lesarten des Textendes an. Dass sie trotz ihrer Kontrastivität je berechtigt sind, ergibt sich über das explorative Potential von ‚Aristoteles und Phyllis‘, das dieser Text mit einer Reihe von Versnovellen teilt. So können durchaus gegensätzliche Lesarten des Textes entstehen: je nachdem, wessen Position man einnimmt und, ob man den Fokus für die eigene Interpretation auf Aristoteles oder aber auf Phyllis ausrichtet.[^20 Zum Text als „Vexierbild“ vgl. auch Cieslik 2006, S. 181.]
Das explorative Potential entfaltet sich auf diese Weise über das Textende, denn der Inhalt von Aristoteles’ Buch handelt von der Schlechtigkeit der Frauen: Waz wünderliches kan / Daz schön vn getrew weip (V. 539f.) und davon, wie sie die Männer beschädigen. Damit aktualisiert der Text am Ende einen Topos (daz übele wîp). Irritierend bleibt jedoch, dass der Text mit Phyllis gerade nicht von einer schönen und hinterlistigen Frau erzählte (vgl. Schallenberg 2012, S. 91–96). Im Text ist sie zwar diejenige, die Rache an Aristoteles übt, sie bleibt in den Zuschreibungen des Erzählers jedoch immer eine schöne und tugendhafte Frau: Er nennt sie die reyn, die güt (V. 119) oder die süße reyne / Gar alles wandels eyne (V. 356f.) und die süße, die reyne (V. 376f.). Der Text fordert dadurch seine wiederholte Lektüre geradezu ein.
Darüber hinaus aktualisiert das Textende nochmals den Aspekt des Sehens. Im Buch des Aristoteles finden explizit die schönen und gefährlichen Frauenaugen Erwähnung. Jene waren es, die in Aristoteles mit der ersten Liebesstufe (visus) die Liebe entzündeten. Nun wird diese erste Liebesstufe jedoch in Textualität überführt. Damit endet die Versnovelle mit dem Thema der scientia, das am Beginn mit dem königlichen Auftrag an den Philosophen stand. Das Erlernen der Kulturtechnik des Lesens wurde eingangs mit dem Erlernen des Alphabets durch Alexander explizit erwähnt.
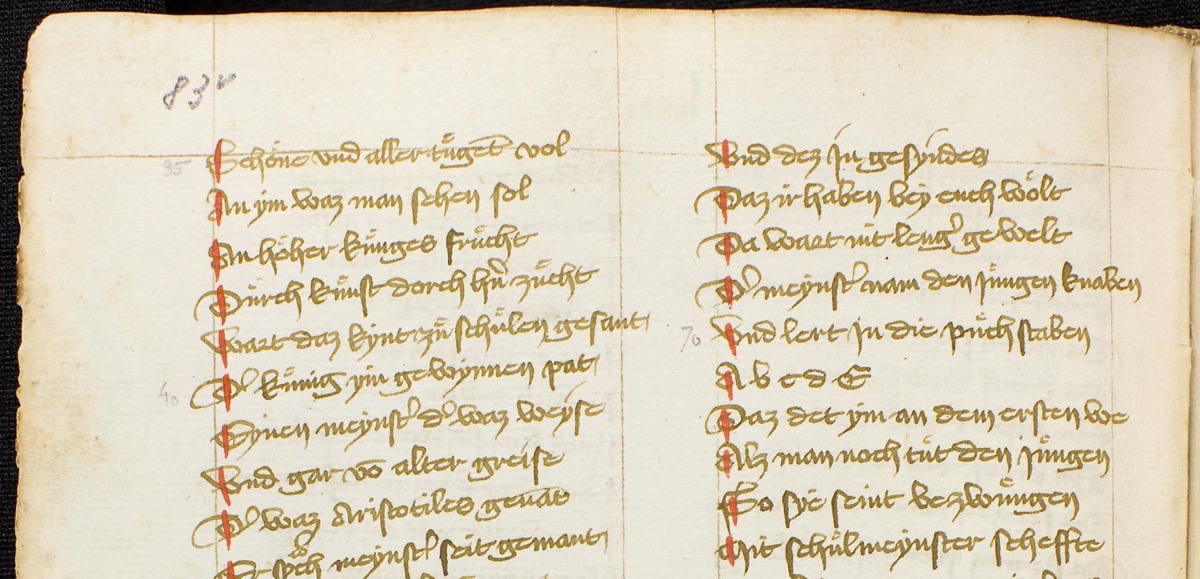
Abbildung 2: BLB Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Deutsche poetische Erzählungen - Cod. Karlsruhe 408, fol. 83v (Ausschnitt). In der rechten Spalte (fol. 83vb) ist der Beginn des Alphabets gut erkennbar. (https://digital.blb-karlsruhe.de/urn/urn:nbn:de:bsz:31-1298)
Am Ende rückt dann das Schreiben ins Zentrum, das mit Aristoteles auf der Insel inszeniert wird. Bezogen auf die intradiegetische Niederschrift des Aristoteles artikuliert sich in diesem Ende nochmals abschließend der Konflikt von amor und scientia, der dem Text nicht nur eingeschrieben ist, sondern der ihn geradezu ausmacht.
Die Kulturtechnik des Lesens ist aber nicht nur innerhalb der Geschichte zentral, sondern sie ist auch für die Faktur des Textes selbst offensichtlich, der merkbar textura, Gewebe ist. Die jüngere Fassung von ‚Aristoteles und Phyllis‘ zeichnet sich insbesondere durch die Inkorporation von vier Versatzstücken aus Gottfrieds von Straßburg ‚Tristan‘ aus und durch zahlreiche Anklänge an die literarische Sprache Konrads von Würzburg (vgl. bereits Josephson 1934, S. 51–61). Zudem verwendet sie mit dem erzähltechnischen Mittel des Exkurses gleich mehrfach Elemente genuin schriftliterarischen Erzählens: Einer von ihnen (V. 301–333) arbeitet mit den sogenannten ‚Tristan‘-Zitaten des Textes und enthält das Leimruten-Gleichnis. Ein späterer Exkurs widmet sich dann abermals den Frauenlisten. Er wurde vom Verfasser der Versnovelle selbständig gestaltet – und zeigt damit den komplexen und zugleich produktiven Umgang mit intertextuellen Referenzen in ‚Aristoteles und Phyllis‘ an.
Es offenbart sich so ein komplexes, Ebenen überspringendes Erzählen, in dem unterschiedliche Aspekte der mit dem Buch verbundenen Kulturtechnik präsent sind: der Lernprozess des Lesens (am Beispiel von Alexander), das Schreiben (im Bild des schreibenden Aristoteles), das Einfügen von intertextuellen Referenzen in den Text und das schriftliterarische Mittel der Exkurse. Zugleich wird das Lesen der Versnovelle, in welcher der Konflikt von amor und scientia zentral ist, reflektiert: Denn mittelalterliches Lesen ist ein Bildungsprivileg, das unmittelbar an scientia gebunden ist – und in ‚Aristoteles und Phyllis‘ an ein exploratives, lustvolles Erzählen über die Dynamiken des Begehrens und der Literatur gekoppelt wird.
Primärliteratur
- Akdogan, Cemil: Optics in Albert the Great’s De Sensu et sensato: An Edition, English Translation, and Analysis, University of Wisconsin-Madison 1978.
- Andreas aulae regiae capellanus: De amore libri tres. Andreas königlicher Hofkapellan: Drei Bücher von der Liebe. Text nach der Ausgabe von E. Trojel. Übersetzt und mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Fritz Peter Knapp, Berlin / New York 2006 (De Gruyter Texte).
- Codex Karlsruhe 408. Bearbeitet von Ursula Schmid, München 1974 (Deutsche Sammelhandschriften des späten Mittelalters; Bibliotheca Germanica 16).
- The first booke of songes or ayres of fowre partes with tableture for the lute: so made that all the partes together, or either of them seuerally may be song to the lute, orpherian or viol de gambo. Composed by Iohn Dowland lutenist and Batcheler of musicke in both the vniversities. Also an inuention by the sayd author for two to playe vpon one lute, [London]: Printed by Peter Short, dwelling on Bredstreet hill at the sign of the Starre, 1597, o.S.
- Sprague, W. Maurice: The Lost Strasbourg St. John’s Manuscript A 94 (Strassburger Johanniter-Handschrift A 94). Reconstruction and Historical Introduction, Göppingen 2007 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 742).
- Thomasin von Zerklaere: Der Welsche Gast. Ausgewählt, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Eva Willms. Berlin: de Gruyter, 2004 (De Gruyter Texte).
- Vergil: Hirtengedichte, Bucolica; Landwirtschaft, Georgica. Lateinisch-deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Niklas Holzberg, Berlin / Boston 2016 (Sammlung Tusculum).
Sekundärliteratur
- Bein, Thomas: Liebe und Erotik im Mittelalter, Graz 2003.
- Bredekamp, Horst und Krämer, Sybille: Kultur, Technik, Kulturtechnik: Wider die Diskursivierung der Kultur, in: Dies. (Hgg.): Bild, Schrift, Zahl. München 2003, S. 11–22.
- Cieslik, Karin: Sinnkonstitution und Wissenstradierung im spätmittelalterlichen Märe: ‚Aristoteles und Phyllis‘, in: Marci-Boehncke, Gudrun / Riecke, Jörg (Hgg.): Von Mythen und Mären. Mittelalterliche Kulturgeschichte im Spiegel einer Wissenschaftler-Biographie (FS Otfrid Ehrismann), Hildesheim 2006, S. 173–189.
- Egidi, Margreth: Blick und Objekt. Die Inszenierung des Blicks im höfischen Roman, in: Bauschke, Ricarda u.a. (Hgg.): Sehen und Sichtbarkeit in der Literatur des deutschen Mittelalters. XXI. Anglo-German Colloquium London 2009, Berlin 2011, S. 115–128.
- Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Albertus Magnus. Völlig überarbeitete, aktualisierte und mit Anmerkungen versehene Neuauflage der Originalausgabe, hg. v. Henryk Anzulewicz, Leipzig 2005 (Dominikanische Quellen und Zeugnisse 7).
- Grubmüller, Klaus: Die Ordnung, der Witz und das Chaos. Eine Geschichte der europäischen Novellistik im Mittelalter: Fabliau – Märe – Novelle, Tübingen 2006.
- Novellistik des Mittelalters. Märendichtung, hg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller, Berlin 2011 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 47) [= Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Hg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller, Frankfurt / M. 1996 (Bibliothek des Mittelalters 23; Bibliothek deutscher Klassiker 138)].
- Hammer, Andreas und Kössinger, Norbert: Die drei Erzählschlüsse des ‚Armen Heinrich‘ Hartmanns von Aue, in: ZfdA 141, 2012, S. 141–163.
- Herrmann, Cornelia: Der „Gerittene Aristoteles“. Das Bildmotiv des „Gerittenen Aristoteles“ und seine Bedeutung für die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung vom Beginn des 13. Jhs. bis um 1500, Pfaffenweiler 1991 (Kunstgeschichte 2).
- Josephson, Gisela: Die mittelhochdeutsche Versnovelle von Aristoteles und Phyllis, Heidelberg 1934.
- Kellner, Beate: Gewalt und Minne. Zu Wahrnehmung, Körperkonzept und Ich-Rolle im Liedercorpus Heinrichs von Morungen, in: PBB 119, 1997, S. 33–66.
- Klein, Klaus: Französische Mode? Dreispaltige Handschriften des deutschen Mittelalters, in: Becker, Peter Jörg u.a. (Hgg.): Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburtstag, Berlin 2000 (Beiträge aus der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz 10), Bd. I, S. 180–201.
- Krause, Miller: The Quinque Lineae Amoris, in: Classica et Mediaevalia 65, 2014, S. 55–85.
- Krämer, Sybille und Totzke, Rainer: Was bedeutet ‚Schriftbildlichkeit‘?, in: Krämer, Sybille u.a. (Hgg.): Schriftbildlichkeit. Über Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen, Berlin 2012, S. 13–38.
- Lindberg, David C.: Theories of vision from al-Kindi to Kepler, Chicago 1976.
- Ott, Norbert H.: Minne oder amor carnalis? Zur Funktion der Minnesklavendarstellungen in mittelalterlicher Kunst, in: Ashcroft, Jeffrey u.a. (Hgg.): Liebe in der deutschen Literatur des Mittelalters. St. Andrews-Colloquium 1985, Tübingen 1987, S. 107–125.
- Philipowski, Katharina: Die Gestalt des Unsichtbaren. Narrative Konzeptionen des Inneren in der höfischen Literatur, Berlin 2013 (Hermaea 131).
- Ragotzky, Hedda: Der weise Aristoteles als Opfer weiblicher Verführungskunst. Zur literarischen Rezeption eines verbreiteten Exempels ‚verkehrter Welt‘, in: Bachorski, Hans-Jürgen / Sciurie, Helga (Hgg.): Eros – Macht – Askese. Geschlechterspannungen als Dialogstruktur in Kunst und Literatur, Trier 1996 (Literatur, Imagination, Realität 14), S. 279–301.
- Rasmussen, Ann Marie: Problematizing Medieval Misogyny: Aristotle and Phyllis in the German Tradition, in: Meyer, Matthias / Sager, Alexander (Hgg.): Verstellung und Betrug im Mittelalter und in der mittelalterlichen Literatur, Göttingen 2015 (Aventiuren 7), S. 195–220.
- Rosenfeld, Hellmut: Aristoteles und Phillis. Eine neu aufgefundene Benediktbeurer Fassung um 1200, in: ZfdPh 89, 1970, S. 321–337.
- Rosenfeld, Hellmut: Art. ‚Aristoteles und Phyllis‘, in: VL 1 (1978), Sp. 434–436.
- Schallenberg, Andrea: Spiel mit Grenzen. Zur Geschlechterdifferenz in mittelhochdeutschen Verserzählungen, Berlin 2012 (Deutsche Literatur – Studien und Quellen 7).
- Schneider, Karin: Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die mittelalterlichen Fragmente Cgm 5249–5250, Wiesbaden 2005 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis V,8).
- Schnell, Rüdiger: Causa amoris. Liebeskonzeption und Liebesdarstellung in der mittelalterlichen Literatur, Bern / München 1985 (Bibliotheca Germanica 27).
- Sudhoff, Walther: Die Lehre von den Hirnventrikeln in textlicher und graphischer Tradition des Altertums und Mittelalters, in: Archiv für Geschichte der Medizin 7, 1913, S. 149–205.
- Wachinger, Burghart: Zur Rezeption Gottfrieds von Straßburg im 13. Jahrhundert, in: Harms, Wolfgang / Johnson, L. Peter (Hgg.): Deutsche Literatur des späten Mittelalters. Hamburger Colloquium 1973, Berlin 1975, S. 56–82.
- Wenzel, Horst: Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter, München 1995.
Online-Quellen
- https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-GG-00001-00001/988 (letzter Zugriff: 15.10.2022).
- https://www.digitale-sammlungen.de/de/details/bsb00125597 (letzter Zugriff: 15.10.2022).
- https://handschriftencensus.de/werke/25 (letzter Zugriff: 15.10.2022).
- https://thue.museum-digital.de/object/1544 (letzter Zugriff: 15.10.2022).
Beitrag 7
die frau der hönerei do lachet / das ers so hübschlich hett gemachet. Zu den Fassungen von Hans Rosenplüts Märe ‚Der fahrende Schüler‘
Deutschsprachige Dichtungen des Mittelalters sind oft in mehreren Fassungen erhalten (vgl. z. B. Henkel 1993, S. 40–42). Dabei hat sich im Rahmen von Arbeiten zu Überlieferungs- und Textgeschichten gezeigt, dass bei einzelnen Werken früh Parallelfassungen existierten, welche nicht auf eine sekundäre Bearbeitung hindeuten, sondern gleichberechtigt nebeneinanderstehen (vgl. Henkel 1993, S. 41f.; vgl. Bumke 1996). Ein solcher Fall liegt auch bei Hans Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘ vor. Rosenplüt lebte im 15. Jahrhundert in Nürnberg; er war ein Handwerksmeister, der neben seinem eigentlichen Beruf eine weitere Berufung fand, nämlich die Dichtung.[^1 Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und um Literaturnach- und -hinweise ergänzte Fassung der am 20.01.2022 im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft ‚Textdynamiken‘ (Universität Leipzig / Universität Krakau) gehaltenen Vorlesung.]
Im Hinblick auf das Stichwort der ‚Textdynamiken‘ wird es in diesem Beitrag darum gehen, welche Bedeutung Abweichungen verschiedener Fassungen haben, weshalb also die Überlieferungs- und Textgeschichte auch bei einer Interpretation zu prüfen ist. Dazu werden detaillierte Hinweise präsentiert, die einzelne Fassungen oder Unterschiede zwischen den Fassungen und den jeweiligen Textzeugen betreffen. Dies dient dazu, Zugriffe und Möglichkeiten einer Lektüre zu verdeutlichen; die Beispiele reichen von der Ersetzung einzelner Wörter bis hin zur Umarbeitung größerer Passagen.
Begonnen wird mit einigen Daten zu Autor und Werk, an die ein Überblick zur Überlieferung beider Fassungen des ‚Fahrenden Schülers‘ anschließt. Breiten Raum nimmt sodann ein intensiver Durchgang durch Fassung II ein, der verschiedene interpretatorische Details umfasst und Forschungsbeiträge integriert. Danach werden verschiedene Abweichungen der I. Fassung aufgezeigt, um deren Charakteristika zu beschreiben und – sofern dies im Einzelnen möglich ist – zu bewerten. Abschließend erfolgt eine kurze Rückkopplung an die Überlieferung. Es wird sich zeigen, dass beide Fassungen Details unterschiedlich akzentuieren, am Ende aber annähernd gleichberechtigte Versionen des ‚Fahrenden Schülers‘ darstellen, da sich nur ein einziger Hinweis zu einer möglichen Abhängigkeit der I. von der II. Fassung identifizieren lässt.
Ein Überblick zu Hans Rosenplüt
Zu Rosenplüts Biographie hat nach einem lange eher spekulativen Zustand in der jüngeren Forschung erstmals aufgrund archivalischer Quellen Hanns Fischer Neues beigetragen (vgl. Fischer ²1983, S. 157). Verdienstvoll sind daran anknüpfende Monographien zu Rosenplüts Leben und Werk, die 1984 von Hansjürgen Kiepe und 1985 von Jörn Reichel vorgelegt wurden (vgl. Kiepe 1984; vgl. Reichel 1985). Beide brachten eine Vielzahl archivalischer Zeugnisse ans Licht; die bei beiden z. T. etwas verstreuten Angaben fasst in einem 2019 veröffentlichten Aufsatz zu Rosenplüt Sabine Griese konzise zusammen (vgl. Griese 2019). Dort kann man neben den einschlägigen Artikeln von Ingeborg Glier (vgl. Glier 1992a; vgl. Glier 1992b; vgl. Glier 2004) nun für weitere Studien ansetzen.
Rosenplüts Herkunft ist ungewiss, er zog von außerhalb nach Nürnberg.[^2 Zum Folgenden vgl. Griese 2019, S. 64–66; Reichel 1985, S. 62–65; Reichel 1985, S. 125–153; Kiepe 1984, S. 274–292; Glier 1992a, Sp. 195–197. Einzelne Belege werden zugunsten des Leseflusses in diesem Absatz nicht separat ausgewiesen.] Im papiernen Neubürgerverzeichnis der Stadt wird Rosenplüt 1426 als Neubürger verzeichnet. Notiert wurde dort: „Hans Rosenplüt, t[agewerker beim Handwerk der] sarwürht“ (zit. nach Reichel 1985, S. 262) – Rosenplüt kam also als Kettenhemd- bzw. Harnischmacher[^3 Vgl. „sarwerker, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S02122, abgerufen am 01.11.2022.] in die Reichsstadt. Bereits 1427 erhielt er in diesem Berufszweig das Meisterrecht in Nürnberg, zu diesem Zeitpunkt muss er seine Lehr- und Gesellenzeit daher bereits absolviert haben. Anhand gängiger Zeiträume der Lehr-, Gesellen- und Wanderjahre macht Reichel plausibel, dass Rosenplüt zwischen 1396 und 1404 geboren worden sein dürfte (vgl. Reichel 1985, S. 127f.).
Ab dem Jahr 1429 gibt es eine entscheidende Neuerung in den Archivalien: Der Name ‚Rosenplüt‘ verschwindet, stattdessen wird er nun konsequent Hans Schnepper oder Schnepperer genannt (vgl. Kiepe 1984, S. 279–292;[^4 Kiepe spricht sich gegen eine Identität von Hans Rosenplüt und Hans Schnepper aus, worin ihm die Forschung aber nicht gefolgt ist.] vgl. Reichel 1985, S. 63–65). Dieser Zweitname findet sich u. a. im Kontext verschiedener Texte Rosenplüts als abschließende Autornennung, beispielsweise in Formulierung wie Hanns Rosenplüt der schnepperer (Reichel 1985, S. 93) oder auch Snepperer Hans Rosenplüt (Reichel 1985, S. 87). Der Namenswechsel wurde damit in Verbindung gebracht, dass Rosenplüt vermutlich ab 1427 dichterisch aktiv wurde (vgl. Griese 2019, S. 66; vgl. Reichel 1985, S. 70f.), Werner Williams-Krapp spricht in diesem Zusammenhang von „gehobene[r] Freizeitbeschäftigung“ (Williams-Krapp 2015, S. 17).
Der Name Schnepperer, kann im Sinne einer – für einen angehenden Literaten durchaus positiven – Geschwätzigkeit verstanden werden. Auf eine zweite denkbare Deutung weist Griese hin: ‚Schnepper‘ kann im Bairischen auch eine kleine Armbrust oder ein Aderlassinstrument bezeichnen (vgl. Griese 2019, S. 72, Anm. 61).
Kettenhemden wurden mit zunehmendem Gebrauch von Schusswaffen im 15. Jahrhundert immer weniger benötigt (vgl. Reichel 1985, S. 130f.); wohl aus diesem Grund wechselte Rosenplüt später seinen Beruf und wurde Rotschmied, also Messinggießer (vgl. Reichel 1985, S. 139–143). Ab 1444 ist er als einer von vielen Büchsenmeistern im Dienst der Stadt bezeugt, er kümmerte sich also um die Herstellung und Bedienung von (schwerer) Artillerie (vgl. Reichel 1985, S. 142f.). Dieses Amt bekleidete er bis 1460, da in diesem Jahr die letzte Soldauszahlung stattfand (vgl. Kiepe 1984, S. 290–292; vgl. Reichel 1985, S. 65), danach fehlen weitere Spuren des Handwerkerdichters.
Rosenplüts Werk lässt sich grob in drei literarische Bereiche untergliedern: Er dichtete Fastnachtspiele, Reimpaarsprüche und Lieder sowie Priamel (vgl. Glier 1992a, Sp. 197–210; vgl. Glier 1992b; vgl. Griese 2019, S. 66).
In der Neuedition der vorreformatorischen Fastnachtspiele Nürnbergs werden 80 Spiele Hans Rosenplüt bzw. seinem Umfeld zugewiesen (vgl. Ridder u. a. 2022), die tatsächliche Autorschaft ist aber in Ermangelung signierter Fastnachtspiele[^5 Die Ausnahme stellt ‚Das Fest des Königs von England‘ (Ridder u. a. 2022, F 44) dar, vgl. Ridder u. a. 2022, S. 10f.] nicht zweifelsfrei zu bestimmen, sondern v. a. aufgrund der Überlieferungskontexte zu vermuten (vgl. Ridder u. a. 2022, S. 10f.).
Die zweite Gruppe bilden die Priamel. Priamel sind kurze, üblicherweise 8 bis 14 Verse umfassende Sprüche, in denen meist Handlungen oder Begriffe nacheinander aufgezählt werden, die oberflächlich nichts miteinander zu tun haben; am Ende folgt dann eine pointierte Zuspitzung, die die Gemeinsamkeit des Vorangehenden benennt (vgl. Kiepe 1984, S. 32–44). Die Frage nach der Autorschaft ist hier ähnlich problematisch wie bei den Fastnachtspielen, da es keine signierten Priamel gibt (vgl. Kiepe 1984, S. 45f.). Rosenplüt gilt aber mit einigem Recht als derjenige, der die Gattung im Hinblick auf ihre Literarisierung maßgeblich vorangetrieben hat (vgl. Glier 1988, S. 140). Priamel liegen vielfach in Sammlungen vor, auch hier bieten u. a. die Kontexte Hinweise auf die Autorschaft Rosenplüts (vgl. Kiepe 1984, S. 45).
Insgesamt eindeutiger ist die Lage bei den Reimpaarsprüchen und Liedern. Ingeborg Glier nennt für diesen Teil des Œuvres insgesamt 31 Dichtungen, für die die Autorschaft Rosenplüts gesichert oder wahrscheinlich ist (vgl. Glier 1992a, Sp. 198; vgl. Griese 2019, S. 67), da regelmäßig am Textende Verfassersignaturen auftreten (vgl. Reichel 1985, S. 79–99). Eine Untergruppe der Reimpaarsprüche und Lieder sind die Mären[^6 Die Gattungsbezeichnung ist in der Forschung umstritten (vgl. die umfängliche Diskussion bei Eichenberger 2015, S. 12–22, bes. S. 19–22). Im vorliegenden Beitrag geht es allerdings nicht um eine Diskussion der Gattung, sondern um ein konkretes Beispiel, weshalb diese Problematik zurückgestellt wird.], zu denen auch Rosenplüts ‚Fahrender Schüler‘ gehört. Hier findet sich am Schluss bei neun der elf Rosenplüt zugewiesenen Mären eine Autorsignatur (vgl. Reichel 1985, S. 93–97; vgl. Glier 1992a, Sp. 203f.; vgl. Griese 2019, S. 69): so hat geticht Hanns Rosenplüt (Fassung II, V. 187)[^7 Der Text der II. Fassung wird nach der zweisprachigen Ausgabe Grubmüllers zitiert, da sich der Beitrag ursprünglich an Krakauer Studierende der Germanistik richtete. Die unten herangezogene Fassung I richtet sich nach Fischers Märenedition.] liest man dort.
Zur Überlieferung und den Fassungen des ‚Fahrenden Schülers‘
Rosenplüts Märe ist in acht Textzeugen erhalten, es handelt sich um sechs Handschriften und zwei Drucke.[^8 Die Datierung bezieht sich jeweils auf den Abschnitt, in dem der ‚Fahrende Schüler‘ notiert ist. Die Siglen decken sich bis auf jene von Druck E mit der Ausgabe von Fischer (Druck E war ihm unbekannt).] Zwei Fassungen des Textes setzt Fischer in seiner Ausgabe der Märendichtung an und ediert beide (Fischer 1966, S. 188–201), Klaus Grubmüller gab Fassung II mit einer Übersetzung heraus (Grubmüller 2011, S. 916–927). Die chronologische Einordnung der einzelnen Textzeugen zeigt das folgende Bild (s. Abb. 1)[^9 Die Abbildung dient lediglich einer groben zeitlichen Verortung der einzelnen Textzeugen in Schritten von fünf Jahren. Im Einzelnen sind die Datierungen jedoch nicht derart gesichert, wie anhand der nachfolgenden Übersicht deutlich wird.], an das knappe Beschreibungen zu den einzelnen Handschriften und Drucken anschließen.
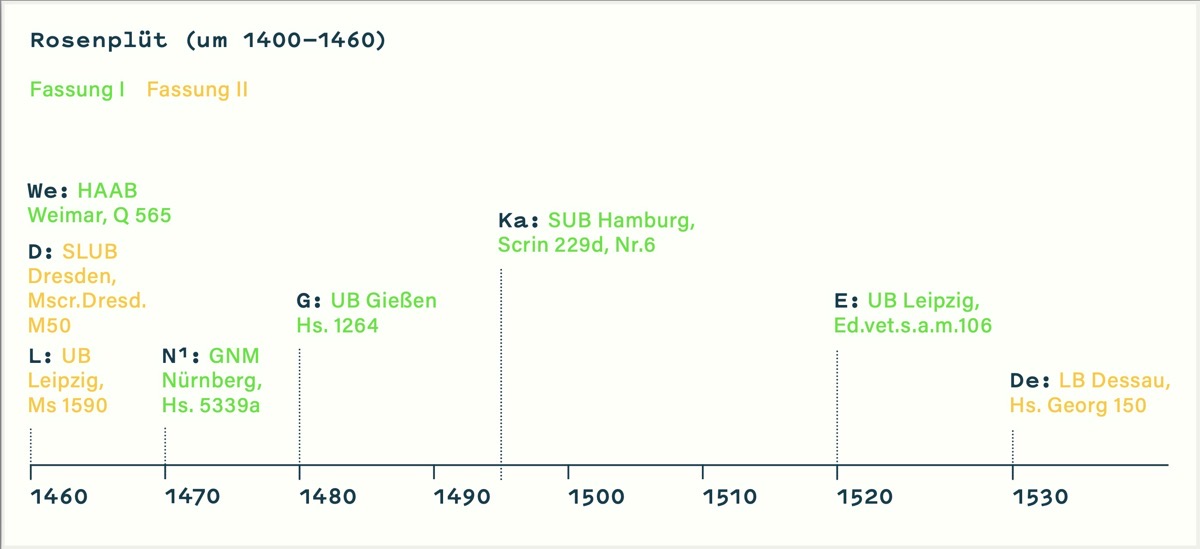
Abbildung 1: Zeitliche Verteilung der Fassungen und Textzeugen
Fassung I
We [Hs.]: Weimar, Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, Cod. Q 565 – Nürnberg(?), um 1460[^10 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/7155, abgerufen am 01.11.2022. Zur möglichen Lokalisierung nach Nürnberg vgl. Kully 1982, S. 18, zur hier genannten Datierung vgl. Kully 1982, S. 14. Die Handschrift selbst ist zwischen ca. 1460 und 1473 entstanden (vgl. Kully 1982, S. 14); das vorn eingebundene Fragment mit dem Ende des ‚Fahrenden Schülers‘ wurde auf jenem älteren Papier geschrieben, das um 1460 in Gebrauch gewesen sein dürfte. Diese Handschrift ist teilweise auf Rosenplüt-Texte konzentrierte, teilweise „hausbuchartig“ bunt gemischt.] – Anm.: Fragment, enthält nur V. 171–182 der I. Fassung
N1 [Hs.]: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Cod. 5339a – Nürnberg, 1471/73[^11 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/3687, abgerufen am 01.11.2022. Zur Lokalisierung nach Nürnberg vgl. Reichel 1985, S. 238 und Kiepe 1984, S. 330 und S. 332.]
G [Hs.]: Gießen, Universitätsbibliothek, Hs. 1264 – Nürnberg(?), um 1480(?)[^12 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/3681, abgerufen am 01.11.2022. Vgl. Seelbach 2007, Hs 1264, online unter: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/5002/, abgerufen am 01.11.2022.]
Ka [Druck]: Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Scrin. 229d, Nr. 6 – [Leipzig: Konrad Kachelofen, um 1495][^13 Der Druck ist im Gesamtkatalog der Wiegendrucke unter GW M38993 verzeichnet; s. zu diesem https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M38993.htm, abgerufen am 01.11.2022., Vgl. auch die Hinweise im Katalog der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg unter https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/266797857, abgerufen am 01.11.2022. Datierung, Lokalisierung und Zuweisung an die Werkstatt Konrad Kachelofens aufgrund der Mitüberlieferung, vgl. Horváth/Stork 2002, S. 124, Nr. 52. Vgl. Griese 2019, S. 83 inkl. Anm. 93.]
E [Druck]: Leipzig, Universitätsbibliothek, Ed.vet.s.a.m.106 – [Augsburg: Matthäus Elchinger, nach 1520][^14 Der Druck ist im Gesamtkatalog der Wiegendrucke unter GW M38994 verzeichnet; s. zu diesem https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/M38994.htm, abgerufen am 01.11.2022.] – Anm.: Blatt- und Textverlust im Mittelteil (vgl. Griese 2019, S. 87, Anm. 102).
Fassung II
D [Hs.]: Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, Mscr.Dresd.M.50 – Nürnberg, um 1460/62[^15 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/6795, abgerufen am 01.11.2022 und die ausführliche Beschreibung von Werner Hoffmann (Hoffmann 2022).]
L [Hs.]: Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms 1590 – Nürnberg, 1460/65[^16 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/5351, abgerufen am 01.11.2022, zur Lokalisierung vgl. Reichel 1985, S. 232; Kiepe 1984, S. 351f.]
De [Hs.]: Dessau, Stadtarchiv, Hs. Georg 150 – ostmitteldeutsch, um 1530[^17 Zur Handschrift vgl. die Angaben im Handschriftencensus unter https://handschriftencensus.de/6823, abgerufen am 01.11.2022.]
Die heute bekannte Überlieferung setzt um den Tod des Autors mit den beiden Sammelhandschriften aus Dresden und Leipzig (Fassung II) und dem Fragment der I. Fassung in der Weimarer Handschrift ein. Bis auf die Ausnahme am Ende der Überlieferung (s. u.) sind die anschließenden Textzeugen der I. Fassung zuzurechnen. Es folgen zwischen 1471 und 1473 der Nürnberger Cod. 5339a und um 1480 die Gießener Handschrift, beide sind Fassung I zuzuschlagen. Ca. 1495 druckt vermutlich Konrad Kachelofen den ‚Fahrenden Schüler‘ in Leipzig, bevor eine größere Lücke in der Überlieferung vorliegt. Erst nach 1520 gibt es weitere Zeugnisse, nämlich den wahrscheinlich von Matthäus Elchinger in Augsburg hergestellten Druck mit der I. und die Dessauer Handschrift mit der II. Fassung.
Räumlich konzentriert sich die handschriftliche Überlieferung auf Nürnberg. An den Druck aus Leipzig gegen Ende des 15. Jahrhunderts schließt derjenige von um 1520 aus Augsburg an, den Schlusspunkt bildet die heute in Dessau verwahrte ostmitteldeutsche Handschrift, die einige Jahre nach dem letzten bekannten Druck entstand.
‚Der fahrende Schüler‘ (Fassung II): Lektüre und Deutungsaspekte
Es geht nun zuerst um diejenige Fassung, die der Ausgabe von Grubmüller zugrunde liegt; in Fischers Edition handelt es sich um Fassung II. Es werden im Rahmen einer textnahen Lektüre einerseits an verschiedenen Stellen von der Forschung vorgelegte Deutungen und Hinweise diskutiert, andererseits aber auch Abweichungen einzelner Textzeugen der Fassung.
Nu horet einen klugen list,
wie einest einem widerfahren ist.
ein varender schüler ist er genant.
hübscheit ist mir von ihm bekant. (V. 1–4)[^18 Auf die Zitation der in der Ausgabe Grubmüllers vorliegenden Übersetzung wird verzichtet, da diese leicht zugänglich. Im späteren Vergleich mit Fassung I wird bei umfangreicheren Passagen eine Übersetzung notiert.]
Der Text beginnt mit einer knappen Bitte um Aufmerksamkeit: Nu horet einen klugen list (V. 1). Diese Form des Auftaktes fasst Fischer unter dem Begriff der ‚Audite-Eröffnung‘; es handle sich dabei um eine typische Form der Eröffnung eines Märenvortrages, die bereits im 13. Jahrhundert begegne (vgl. Fischer ²1983, S. 262f.). Der Rahmen ist also eine Vortragssituation, die in den schriftlichen Zeugnissen zwar fingiert ist, deswegen als denkbarer Rezeptionszusammenhang aber nicht ausgeschlossen werden muss.
Dasjenige, was man zu hören bekomme, ist ein[] kluge[r] list (V. 1). Mittelhochdeutsch list bezeichnet allgemein etwa ‚Klugheit‘ oder ‚Weisheit‘ und ist selten negativ konnotiert.[^19 Vgl. „LIST, stm.“, Mittelhochdeutsches Wörterbuch von Benecke, Müller, Zarncke, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=L01019, abgerufen am 01.11.2022.] Diese Bedeutung greift hier allerdings nicht, da auf etwas referiert wird, das man hört; es ist also eine Sache besonderer Qualität gemeint und nicht die Fähigkeit zu durchdachtem Handeln. In Anlehnung an das Lemma zu ‚list‘ im Deutschen Wörterbuch kann man den klugen list daher als ‚geschickten Kunstgriff‘ übersetzten.[^20 Vgl. „list, m. f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=L06279, abgerufen am 01.11.2022.] Da dieser dem schüler (V. 2), der durch einem (V. 2) im Dativ referenziert wird, widerfahren ist (V. 3), ist der erste Vers derart zu verstehen, dass der kluge Kniff der Figur des schüler[s] (V. 2) geschah. Folgt man dieser Lesart, so wäre der Auftakt als selbstbewusste Anspielung auf die besondere Qualität der Erzählung, die nun folgen wird, zu deuten.
Erzählt wird sodann von einem Reisenden, einem varende[n] schüler (V. 2). Als schüler werden im 15. Jahrhundert sowohl Lernende an Pfarr- oder Stadtschulen als auch an Universitäten bezeichnet (vgl. Grubmüller 2011, S. 1316 zu V. 3). Auf die heutige Zeit übertragen könnte man aufgrund von varender an jemanden im Erasmus-Aufenthalt denken, da das Verb varn im Mittelhochdeutschen allgemein die Fortbewegung von einem Ort zu einem anderen meint.[^21 S. „varn, stV. I, 4.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=V00261, abgerufen am 01.11.2022.]
Die Figur des Studenten ist eine der herausragenden innerhalb des in den Mären auftretenden Personals:
In der Nähe des Pfaffen steht als der angehende Kleriker, den wir in ihm oft (aber nicht immer) sehen müssen, der Student […]. Der schuolære – wegen seiner diesbezüglichen Fertigkeit auch gerne als schrîbære bezeichnet – ist entschieden eine Lieblingsgestalt des Märes; auf keine andere werden mit gleicher Ausschließlichkeit positive Züge gehäuft. Zweimal begegnet er als Liebhaber im höfischen Märe, seine eigentliche literarische Heimat jedoch ist der Schwank, dessen Intellektualismus keine bessere Verkörperung als den ebenso witzigen wie lebensklugen Scholaren finden konnte. Dort besetzt er in typischer Weise Ehebrecher- und Verführerrollen […], aus denen er im Falle des ‚Sperbers‘ einmal sogar den Ritter zu verdrängen vermag; ebenso wie jener wird er bei seinem Tun nur selten ertappt, niemals öffentlich bloßgestellt oder bestraft. Daneben finden wir ihn vereinzelt noch in den Rollen des schalkhaften Überlisters […] oder Überlistungshelfers […], für die er auf Grund seiner geistigen Gaben ebenfalls in besonderem Maße geeignet erscheinen mußte. (Fischer ²1983, S. 121f.)
Die von Fischer herausgestrichene Klugheit findet sich auch in Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘: Der Erzähler erwähnt unmittelbar am Textbeginn, ihm sei hübscheit (V. 4) vom schüler (V. 3) bekannt. Der Begriff hängt mit mittelhochdeutsch hövescheit zusammen, also ursprünglich der richtigen Art und Weise, sich am Hof zu verhalten, dient später jedoch auch als Bezeichnung für ‚Klugheit‘, wie es hier der Fall ist (vgl. Grubmüller 2011, S. 1316 zu V. 4). In dieser Bedeutung könnte der Begriff im 16. Jahrhundert nicht mehr geläufig gewesen sein, wie sich bei Handschrift De zeigt:
Nuon horet eynen kluogen list
Wie es diesem widerfharen ist
Ein farender Schülere ist ers[!] gnanth
Behentheyt ist mir von ym bekanth
(De, fol. 161r = V. 1–4)
In der um 1530 entstandenen ostmitteldeutschen Handschrift liest man anstelle von hübscheit im 4. Vers von Behentheyt. Behentheyt wird im Deutschen Wörterbuch mit der Bedeutung lateinisch habilitas, agilitas, calliditas[^22 Vgl. „behendigkeit, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B02780, abgerufen am 01.11.2022.] angesetzt, meint also so viel wie die Fähigkeit, sich rasch an andere Bedingungen anzupassen, und zwar sowohl körperlich als auch kognitiv[^23 Vgl. etwa „agilitas, f.“, Mittellateinisches Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/MLW?lemid=A02179, abgerufen am 01.11.2022. Vgl. das Lemma ‚agilitas‘, in: Georges 1869, Sp. 190; vgl. besonders: ‚calliditas‘, in: Georges 1869, Sp. 686f.; ‚habilitas‘, in: Georges 1869, Sp. 2183.] – für die folgende Erzählung eine durchaus treffende Änderung.
Zu einem pauern er eintrat.
die frauen er umb die herberg pat,
das sie in ließ liegen auf einer pank.
dorumb wolt er ir sagen großen dank.
die frau ob irem tische saß.
der pfaff im dorf mit ir aß.
den hett sie heimlich zu ir geheißen,
das er in irem vorst solt peißen.
dorumb er mit ir aß und trank.
der schüler hett ein bösen dank
und gedacht, was wirtschaft das mocht sein.
(V. 5–15)
Jener reisende Student erreicht ein Bauernhaus, dessen Hausherr abwesend ist, und möchte dort um Beherbergung bitten (V. 5–7). Er trifft auf die Ehefrau des abwesenden Bauern, welche gerade mit dem örtlichen Pfarrer zu Tisch sitzt (V. 9f.). Die Umstände und das Ziel des Treffens werden unmittelbar im Text benannt: den hett sie heimlich zu ihr geheißen, / das er in irem vorst solt peißen (V. 11f.). Die Zusammenkunft geschieht also im Verborgenen, und zwar, damit der Pfarrer ‚im Wald der Ehefrau jage‘. Diese Metapher zielt auf den Koitus und speist sich aus einem von Ralph Tanner als „Landschaftspflege-Motivik“ (Tanner 2005, S. 451) bezeichneten semantischen Wortfeld. Zugleich deutet sich im Begriff vorst (V. 12) eine Übertretung des Rechts an, da die historische Bedeutung im Kontrast zu derjenigen des von der Allgemeinheit nutzbaren Waldes steht.[^24 Vgl. „wald, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=W03296, abgerufen am 01.11.2022 (hier unter II.2); vgl. „walt, -des stm.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=W00357, abgerufen am 01.11.2022.] Die Nutzung des Forstes hingegen unterliegt rechtlichen Bestimmungen und ist bestimmten Personen oder Institutionen vorbehalten,[^25 Vgl. „Forst“, in: Deutsches Rechtswörterbuch III, 1935/38, Sp. 633f., Faksimile der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=forst&bd3_633=F, abgerufen am 01.11.2022.] was auf die Exklusivität der ehelichen Sexualität hinweist.
Das Wort vorst ist nicht über die gesamte Textgeschichte hinweg stabil. Erneut zeigt die jüngere ostmitteldeutsche Handschrift De eine Änderung, hier wurde notiert: Das er yn irem hage solt peyssen (De, fol. 161v = V. 12). Ein hac ist im Mittelhochdeutschen ein eingefriedeter Wald, Park oder auch allgemeiner ein (dichtes) Gebüsch,[^26 Vgl. „hac, -ges stmn.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=H00073, abgerufen am 01.11.2022.] in der Jägersprache zudem ein zur Hege des Wildes eingezäuntes Stück Wald[^27 Vgl. „hag, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=H00675, abgerufen am 01.11.2022 (s. unter II.2b).] – die sexuelle Semantik und die Allusion auf die Exklusivität des ehelichen Geschlechtsverkehrts bleiben von dieser kleinen Änderung also letztlich unberührt.
Noch etwas anderes ist an dieser Stelle aber auffällig: Es ist die Ehefrau, die das Treffen initiiert hat, sie lud den Pfarrer zu sich ein (V. 11f.). Dass es gerade ein Kleriker ist, der für den außerehelichen Koitus eingeladen wird, ist im Kontext der Mären nicht ungewöhnlich, wie erneut bereits Fischer bemerkt. Er hält fest, dass die Figur des Pfarrers typischerweise als Verführer und Ehebrecher auftrete (vgl. Fischer ²1983, S. 120f.), diese Rolle wird ihm auch hier zuteil. In einer Studie zu Geistlichen in mittelalterlichen deutschsprachigen Mären stellt Birgit Beine zusätzlich heraus, dass man Geistlichen auch wegen ihrer intellektuellen Fähigkeiten zuschrieb, herausragende Liebhaber zu sein, da sie Zugang zu antiken Werken wie den ‚Amores‘ oder der ‚Ars amatoria‘ Ovids, in denen es um das richtige Verhalten von Männern gegenüber Frauen in Liebesdingen geht, hatten (vgl. Beine 1999, S. 123f.).
Ein zweiter Aspekt ist, dass Geistliche aufgrund ihrer recht bequemen Lebensführung dazu fähig wären, leistungsfähige Liebhaber zu sein (vgl. Fischer 1966, S. 120) – wer seine Kräfte nicht auf dem Feld verbraucht, kann sie stattdessen eben für andere Tätigkeiten nutzen. Etwas anders begründet Wolfgang Beutin in einer Monographie über die Figur des Pfarrers in Mären diese Zuschreibung: Der geistliche „Zölibatär [verfügt] infolge‚ gestauter‘ Leidenschaft über die größere Potenz“ (Beutin 1990, S. 437; vgl. auch Beine 1999, S. 126).
Im sowohl wörtlichen als auch übertragenen Sinne riecht der Student den Braten, wobei im Text darauf abgehoben wird, dass er sich darüber wundere, was für eine Art von Bewirtung dies wohl sei (V. 14f.). Den pösen dank (V. 14), den man als ‚schlimme Vermutung‘ verstehen kann,[^28 Vgl. zum Adjektiv „bœse, adj.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=B03525, abgerufen am 01.11.2022.; zum Substantiv „dank, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=D00459, abgerufen am 01.11.2022.] teilt er mit den Rezipient:innen – wir wissen ja bereits, was auf die gemeinsame Mahlzeit folgen soll.[^29 Die Verbindung von Mahlzeiten und Sexualität dürfte auch zeitgenössischen Rezipient:innen geläufig gewesen sein, da z. B. in einem der Fastnachtspiele Rosenplüts auf diätische Regeln verwiesen wird, die zu einer Verminderung der Libido führen sollen. Im Spiel ‚Die Unersättlichen‘ (K 29; Edition bei Ridder u. a. 2022, F 70) wird einer Ehefrau, die sich über zu häufige sexuelle Begierden ihres Mannes beklagt, geraten, bei der Verpflegung des Gatten auf Eier und Fleisch (V. 50) sowie Wein (V. 57) zu verzichten, da diese Lebensmittel eine Steigerung der Lust bewirken. Vgl. dazu auch Grafetstätter 2013, S. 64f.]
Der unerwartete Besuch kommt für die beiden Anwesenden ungelegen. Die Bäuerin bietet zwar ein Getränk an, weist allerdings das Anliegen des Studenten zurück; sie würde ihn zwar gern aufnehmen, traue sich aber wegen ihres Ehemannes nicht (V. 18–20). Die Reaktion des Pfarrers ist nonverbal gehalten, er schaut den Studenten lediglich schief an (V. 21).
Der Student aber merket wol ir beider sin (V. 25), hat die Zeichen also wahrgenommen und richtig gedeutet, und verabschiedet sich. Dies ist freilich nur fingiert, er schleicht in den Stall und versteckt sich (V. 31–33). Er wird opportunistisch gezeichnet: Aus zahllosen Einfällen (V. 32) manifestiert sich die Idee, dem Pfarrer – sofern er wirklich zur Tat schreitet – einen gehörigen Schrecken einzujagen (V. 34) und von ihm eine gute schenk (V. 36), eine ‚ansehnliche Belohnung‘, einzustreichen.
Das Vorgehen des vagierenden Studenten ist konsequent gestaltet, wenn man an den Beginn des Märes zurückdenkt. Abgehoben wurde in den ersten Versen auf die Klugheit des schülers, in der jüngsten Handschrift sogar auf seine geistige Flexibilität.
Rosenplüt lenkt den Blick gleich in den ersten Versen auf einen Einzelnen und seine besonderen Gaben, einen fahrenden Schüler dazu, also jemanden, der außerhalb fester Bindungen steht und […] nichts weiter vertritt als sich selbst und den Anspruch losgelöster Intelligenz (Grubmüller 2006, S. 198).
Eine höhere gesellschaftliche Ordnung, die durch den Ehebruch gefährdet und deswegen restitutionsbedürftig ist, gerät im ‚Fahrenden Schüler‘ also nicht in den Blick. Aus diesem Grund ist es auch nicht notwendig, von einer Rache des Studenten zu sprechen (vgl. Grubmüller 2006, S. 198); Abschied, fingiertes Verlassen des Hauses und stilles Abwarten deuten nicht auf affektgesteuertes Verhalten, sondern kalkulierte Verzögerung zur Gewinnmaximierung.
Während der Student also auf eine günstige Gelegenheit wartet, erscheint unerwartet der Hausherr. Er klopft von außen an, seine Frau und der Pfarrer verriegeln den Eingang, bis sich der Pfarrer auf dem Dachboden versteckt hat (V. 38–43). Die Bäuerin verbirgt rasch Speis und Trank: Eine vom Pfarrer mitgebrachte Weinflasche landet gemeinsam mit einem Brathähnchen am Spieß in einem Futterkorb (V. 45–50),[^30 Zur Symbolik des mit Spieß durchbohrten Geflügels als Zeichen für den Ehebruch vgl. Reichlin 2009, S. 152 inkl. Anm. 15 und Anm. 16 mit weiteren Verweisen] eine Henne, die eben noch auf dem Herd köchelte, wird fortgeschoben oder getragen[^31 Vgl. „rücken, swv.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=R02236, abgerufen am 01.11.2022.] und verdeckt (V. 51–53). Danach eilt die Bäuerin zur Haustür und öffnet. Mit einer fadenscheinigen Ausrede besänftigt sie ihren Mann, der ungehalten ist, da er warten musste – sie habe eben geruht, daher habe es gedauert (V. 56–62).
Der Student schleicht aus dem Haus und wartet ein Weilchen, bevor er erneut anklopft (V. 58–60). Er spricht nun mit dem Bauern, der aus dem Fenster herausschaut. Erneut bittet er um eine Beherbergung, wobei er durch den Zusatz umb gotes er (V. 68) auf die christlich gebotene Nächstenliebe und Gastfreundschaft verweist. Der Bauer nimmt ihn daraufhin gern auf, wobei er frei heraus gesteht, die christlichen Gebote öfter einmal zu übertreten (V. 69f.).
Am Hals des Reisenden erkennt der Hausherr ein garn (V. 72), bei dem es sich um ein Erkennungszeichen reisender Scholaren handeln dürfte (vgl. Grubmüller 2011, S. 1317, Anm. zu V. 72)[^32 Im von Grubmüller referenzierten Handwörterbuch des Germanischen Aberglaubens erwähnt Lily Weiser-Aall genauer gelbe Bänder oder Mützen, die von dieser Personengruppe als Erkennungszeichen verwendet worden seien, vgl. Weiser-Aall 1929f., Sp. 1123.]. Der Bauer erkennt und bewertet dieses garn richtig, wie sich an seiner verbalen Reaktion zeigt: solch gesellen die erfarn vil / und seint all gern klug und subtil (V. 75f.). Er schätzt den Studenten also als in vielen Dingen bewandert und verständig ein, wie dies auch bei anderen Vertretern seiner (natürlich nicht im engen Sinne zu verstehenden) Zunft der Fall sei. Die Doppelform klug und subtil (V. 76) deutet an, dass es nicht nur um harmlose ‚Klugheit‘ geht, sondern im Sinne von subtil bzw. lateinisch subtilis um ‚Scharfsinnigkeit‘.[^33 Derart übersetzt auch Grubmüller 2011, S. 921, V. 76. Vgl. auch „subtil, adj.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S55798, abgerufen am 01.11.2022.] Die anschließende Frage des Bauern, ob der Gast nicht einen schimpf (V. 77) machen könne, ist daher nicht ungefährlich. schimpf bedeutet mittelhochdeutsch ‚Scherz, (ritterliches Kampf-)Spiel, Zeitvertreib‘, kann aber auch negativ eine Folge bezeichnen, wenn es ‚Spott, Verhöhnung, Schmach‘[^34 Vgl. „schimph, stm.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=S01996, abgerufen am 01.11.2022.] meint; auf diese Mehrdeutigkeit dürfte angespielt sein.
Gefragt wird vom Bauern nach einem vermeintlich harmlosen Zeitvertreib, den der Student als scharfsinniger Mensch machen kann. Das Ziel sei, das du uns die frauen machest lachen (V. 78). Der Student stimmt zu, das könne er gern tun, er werde sie alle fröhlich stimmen (V. 81f.) und kündigt Ungewöhnliches an: Den Teufel panne[] er zur Unterhaltung (V. 83f.). Das Verb pannen überträgt Grubmüller unmittelbar als „bannen“ (Grubmüller 2011, S. 921, V. 83), wobei es hier eigentlich nicht um die Abwehr einer Gefahr, sondern eher das Herbeizitieren des Teufels geht. Mittelhochdeutsch bannen entstammt dem juristischen Kontext[^35 Vgl. „bannen, stV“, Mittelhochdeutsches Wörterbuch Online unter http://www.mhdwb-online.de/wb/11217000, abgerufen am 01.11.2022; „BANNE“, Mittelhochdeutsches Wörterbuch von Benecke, Müller, Zarncke, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/BMZ?lemid=B00145, abgerufen am 01.11.2022.] und meint neben ‚gebieten, unter Strafe androhen‘ etc. auch das (magische) Beschwören etwa des Teufels[^36 S. „BANNEN, vb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm / Neubearbeitung (A–F), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB2?lemid=B00524, abgerufen am 01.11.2022, hier unter 2.a.].
Man trifft nun einige Vorbereitungen: Der Bauer trägt auf Geheiß des Studenten ein Schwert herein (V. 85f.), ein Bannkreis wird gezogen (V. 87f.), hinein stellen sich Bauer und Student, letzterer spricht sodann auf Latein für den Bauern Unverständliches. Der Student beschwichtigt den Bauern, der Teufel könne nichts ausrichten, sofern er nach seinen Anweisungen handle (V. 89–93). Nun werden die Verstecke des Essens und Trinkens offenbart (V. 94–101).
Der schüler erläutert im Anschluss, woher die Lebensmittel kommen. Diese wären durch den Teufel aus der Ferne herangeschafft worden und stammten von einem Pfarrer, der solt bei einem weib sein gelegen (V. 105). Grubmüllers Übersetzung „Der hatte vor, mit einer Frau zu schlafen“ (Grubmüller 2011, S. 923, V. 105) hebt den sexuellen Wunsch des Pfarrers hervor, übersetzen kann man hier allerdings auch: ‚Der einer Frau beiwohnen sollte‘ (und zwar auf ihren Wunsch hin), was die Libido der Frau stärker herausstellt. Diese Nuance ist im Hinblick auf den Ausgang des Textes wichtig, da in der hier verhandelten Fassung die Figur der Ehefrau stärker akzentuiert wird (s. u.). Deutlich wird anhand der Äußerung des reisenden Gastes jedenfalls, dass sein Ziel sich verschoben hat, nämlich durch die Anspielung auf sein Wissen über den vereitelten Ehebruch hin zur Vorführung des beinahe betrogenen und nach wie vor völlig ahnungslosen Bauern.
Jener findet die verschiedenen Lebensmittel (V. 107–109), ist aber durch seine Neugier angestachelt: Ob man denn nicht auch den Teufel selbst herbeizitieren könne, da dessen Aussehen ihn interessiere (V. 112–114). Diese neuerliche Gelegenheit lässt der Student nicht ungenutzt verstreichen. Sofern der Bauer mutig genug sei (V. 115), so wolt ich [d. i. der Student, F.B.] in zwingen mit wortes kraft (V. 116). Mittelhochdeutsch twingen kann u. a. ‚beherrschen, bändigen‘ oder auch ‚den Zaum anlegen‘ bedeuten,[^37 Vgl. „twingen, stV. I, 3.“, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/Lexer?lemid=T02891, abgerufen am 01.11.2022.] diese Semantik lässt sich sowohl auf den vermeintlichen Teufel selbst als auch auf den versteckten Pfarrer übertragen: Ihn werde er mit der Macht seiner Worte dazu bringen, sich zu zeigen.
Der Bauer kündigt an, tapfer zu sein (V. 118). Er und der Scholar gehen zur Tenne, also in einen großen Raum, auf dessen Boden man das Getreide drosch (V. 121).[^38 Vgl. „tenne, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=T02160, abgerufen am 01.11.2022.] Hier wird erneut ein Bannkreis gezogen und vorsorglich vom Studenten schon einmal die Haustür geöffnet (V. 121–127), bevor dieser nun den versteckten Geistlichen aufsucht und seine Hilfe anbietet: Er könne den Pfarrer derart davonkommen lassen, das euch [den Pfarrer, F.B.] niemant innen wird, / wann euch noch niemant hat gespürt (V. 135f.), also derart‚ dass niemand euch erkennt, da noch keiner von eurer Anwesenheit weiß‘. Die Bedingung dafür ist, dass der Geistliche sich entkleide (V. 132). Der Pfarrer willigt ein, nennt aber ebenfalls zwei Bedingungen: er will mit eren (V. 138) und on schaden (V. 139) davonkommen, also ohne Verlust seines öffentlichen Ansehens und körperlich unversehrt. Als Bezahlung überreicht er dem Studenten wie verlangt seine Kleidung (V. 140f.).
Diese Entkleidung lässt sich historisch kontextualisieren: Bernhard Schimmelpfennig weist in einem Aufsatz zur Degradation von Geistlichen im Spätmittelalter, also ihrer höchsten Bestrafung durch Ausstoßung aus dem geistlichen Stand für schwere Vergehen wie etwa Häresie oder Hexerei (vgl. Schimmelpfennig 1982, S. 307), darauf hin, dass dieser Akt gegenläufig gespiegelt zur Priesterweihe vorgenommen wurde. Statt der Erhebung in das Amt durch Handauflegen des Bischofs und Überreichung der Gewänder wird bei Degradationen zunächst die Kasel (das oberste Gewand) abgezogen, danach dann der Knauf des Bischofsstabes auf den Kopf des Bestraften gelegt (vgl. Schimmelpfennig 1982, S. 310f.).
Auf die Rechtsgeste der Amtsenthebung durch Entkleidung dürfte hier angespielt sein, auch wenn ein Bruch des Zölibates theoretisch milder durch Deposition (den Verlust von Ämtern und Pfründen) bestraft worden wäre (vgl. Schimmelpfennig 1982, S. 307).Der Pfarrer unterwirft sich, wenn man diesen Kontext einbezieht, im ‚Fahrenden Schüler‘ symbolisch dem eigentlich rangniederen Studenten, indem er der Forderung nach der Entkleidung nachkommt, was neben dem gegenständlichen Wert als Zahlungsmittel bzw. Tauschobjekt für das Davonkommen als Eingeständnis der eigenen Schuld gewertet werden kann. Die so herausgestrichene Unterwerfung wird dann auf die Spitze getrieben. Seine Unterhose behält der Geistliche zunächst an, dem Studenten ist dies aber nicht genug: Er sprach: „die bruch [d.i. die Unterhose, F.B.] muss auch herab […]“ (V. 142).
Nun kommt eine äußerliche Transformation ins Spiel: Mit Ruß wird der Pfarrer vollständig schwarz eingefärbt (V. 143f.). Das Einfärben wird durch das Verb bescheiß (V. 143) ausgedrückt, was zeitgenössisch allgemeiner das Beschmutzen von etwas oder jemandem oder häufig auch wörtlich das Beschmutzen mit Kot meint; derart sind auch Formulierung im Kontext des Betrügens der Menschen durch den Teufel zu verstehen.[^39 Vgl. „bescheiszen“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B04985, abgerufen am 01.11.2022.]
Der Betrügende ist hier der Student, der Betrogene der Geistliche, der dann swarcz als ie kein rab (V. 145) ist, also schwärzer als es jemals ein Rabe gewesen sei. Man kann dies als Anspielung auf Genesis 8,6f. lesen,[^40 Herangezogen wurde der Text der Vulgata, s. den ersten Eintrag in der Primärliteratur.] wo Noah von der Arche einen Raben fliegen lässt, welcher immer wieder zurückkehrt, da er kein rettendes Land findet. In der Allegorese werden der Rabe und seine Färbung üblicherweise negativ ausgelegt (vgl. Meier / Suntrup 2011, S. 770). Doch auch im Hinblick auf die folgende Rolle ist die Farbe prägnant:
Mit dem Schwarz und dem Dunkel verbindet sich im weitesten Sinn die Vorstellung
vom Teufel und seinem Bereich, von Sünde, Versuchung und Leid sowie den
daraus resultierenden Verhaltensweisen des Menschen. (Meier / Suntrup 2011, S. 512)
Es ist daher plausibel, dass der Bauer kurz darauf den Teufel zu erkennen glaubt, wenn der Pfarrer sein Versteck verlässt. Bedrohlich rumpelt der derart unkenntlich gemachte Geistliche eine Leiter nach unten (V. 146), begleitet von einer kleinen schauspielerischen Einlage, bei der er den verängstigten Bauern anfaucht: und pfuchzet gein dem bauern auß (V. 147).
Eine leichte Variation des Dargestellten findet sich in Handschrift De: Dort fehlt pfuchzet, stattdessen liest man platzett (Fischer 1966, S. 199, Anm. zu V. 147), was so viel wie ‚plötzlich auf etwas hinstürmen, hervorbrechen, hastig stürzen‘[^41 Vgl. „platzen, verb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=P05566, abgerufen am 01.11.2022.] bedeutet; hier ist die Bewegung des Pfarrers also tendenziell unkontrollierter. Im Folgevers ist noch ein behenth (‚schnell‘)[^42 Vgl. „behende, adv.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B02775, abgerufen am 01.11.2022.] ergänzt, wodurch die rasante Flucht unterstrichen wird. Diese minimale Variation in der späten Überlieferung plausibilisiert einerseits das Nichterkennen des vermeintlichen Teufels durch den Hausherrn, hat aber auch eine Auswirkung darauf, wie das Verhalten des Pfarrers bei der Flucht zu werten ist. Statt mit einer selbstbewussten Schauspieleinlage stolpert er hier nämlich unsicher aus dem Märe.
Der Bauer erbleicht und stürzt vor Schreck (V. 149–151), was der Student mit einigem Spott ob seiner Ängstlichkeit quittiert: Er habe doch gesagt, dass der Teufel ihm nichts antun könne (V. 152–154). Die Angst des Bauern rührt allerdings nicht nur vom Anblick und Verhalten des vermeintlichen Teufels her, sondern auch von einem besonders herausgestrichenen körperlichen Merkmal: Einen großen stecken (V. 156) habe er bei sich gehabt, an dem hinten ein gesleuder (V. 157) hing; um dieses Wort wird es später noch einmal gehen (s. u.). In dem gesleuder transportiere der vermeintliche Teufel zwei große Steine (V. 159), die ihm an die Beine schlugen (V. 160). Der Bauer fürchtet, der stecken (V. 156) solle dazu dienen, auf ihn zu zielen und ihn zu töten (161f.), sei also eine furchterregende Waffe. Der Schüler beschwichtigt: Bei diesem Teufel würde er sich sehr wohl trauen, den Bauern zu schützen, da er die Gewalt über ihn habe (V. 164–166).
Eigentümlicherweise fehlt sowohl bei Fischer als auch Grubmüller ein Zusatzvers im eigentlichen Abdruck, der in allen drei Textzeugen der II. Fassung auftritt. Nach der pauer sprach: „solt ich nicht erschrecken? / er trug an im ein großen stecken (V. 155f.) folgt in minimaler Variation: Recht als ein cleine zuber stangen (Fischer 1966, S. 199, Anm. nach V. 156), woran daran sach ich ein gesleuder hangen, / das glenckert hinden an der stangen (V. 157f.) anschließt. Die bedrohliche „Waffe“ wird hier als ‚Zuberstange‘ beschrieben. Ein Zuber ist ein großes hölzernes Gefäß, das man zum Transport von Wasser oder auch als Badewanne nutzte.[^43 Vgl. „zuber, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=Z08593, abgerufen am 01.11.2022.] Unter ‚Zuberstange‘ findet sich um Deutschen Wörterbuch der Hinweis, dass es sich dabei um einen ‚schweren Hebebaum‘ handelt, also eine sehr lange hölzerne Stange, die neben ihrer Funktion als Hilfsmittel für den Transport der Zuber[^44 S. dazu den zuletzt genannten Verweis auf „zuber, m.“.] durch zwei Personen auch als Waffe von Bauern verwendet worden sei.[^45 Vgl. „zuberstange, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=Z08606, abgerufen am 01.11.2022.]
Dieses Detail ist aus zwei Gründen relevant: Formal liegt ein auffälliger Dreierreim vor, der aufgrund der Doppelung von stangen (Reimwörter: stangen – hangen – stangen) zwar nicht sonderlich elegant ist, die besondere Bedeutung aber betont. Andererseits wird spätestens durch diesen Vergleich klar, dass die Beschreibung der Genitalien des Pfarrers weiter über die Grenze des Realistischen hinausgeht, was einen komischen Effekt hervorruft. Die Zuschreibung eines übermäßig opulenten Geschlechtsorgans an den Pfarrer ist keine genuine Besonderheit von Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘, sondern begegnet auch in anderen Mären:
Die Monstrosität der freigesetzten Libido der Geistlichen, die alle Grenzen und Naturgesetze zu sprengen scheinen, bringen die Märendichter auch in der Beschreibung [der, F.B.] körperlichen Beschaffenheit der klerikalen Kraftprotze zum Ausdruck. Der Schwankpfaffe ist nicht nur ein unermüdlicher, sondern auch ein von der Natur besonders großzügig ausgestatteter Liebhaber[.] […] Der riesige Pfaffenpenis im Märe ist die Inkarnation der Gefahr, die der geistliche Nebenbuhler darstellt, und evoziert gleichzeitig eine komische und damit von der Furcht befreiende Wirkung. Denn bei aller Bedrohung, die vom geistlichen Rivalen ausgeht, verdeutlicht der große Phallus auch, wie sehr sein Träger Sklave seiner Geschlechtlichkeit ist. (Beine 1999, S. 128)
Den von Beine konstatierten Aspekt der Gefahr des Nebenbuhlers klammere ich aus, da psychologisierende Übertragungen von an literarischen Texten erarbeiteten Beobachtungen auf die historische Lebenswelt in dieser allgemeingültigen Formulierung kritisch zu bewerten sind. Zu unterstreichen ist aber der komische Effekt, der sich durch die kaum zu übersehende Übertreibung einstellt, sowie die Engführung von übertriebener Ausstattung und sexueller Begierde für den Typus des Geistlichen innerhalb der Märendichtung.
Intendiert ist also, dass sich aufgrund der körperlichen Beschreibung des Pfarrers ein Lachen bei den Rezipient:innen einstellt. Dies ist aber nicht nur deswegen der Fall, weil ein absurdes körperliches Merkmal geschildert wird, sondern auch, da der Bauer das Gesehene völlig falsch deutet: Die von ihm gefürchtete Bedrohung seines Lebens ist eigentlich eine für die Exklusivität ehelicher Sexualität und das Ansehen in der Gesellschaft.
Im Text kommt nun auch die Ehefrau wieder ins Spiel, die die meiste Zeit über im Hintergrund verschwunden war:
die frau der hönerei do lachet,
das ers so hübschlich hett gemachet,
das er dem pfaffen half davon,
das sein nicht kennen kond ir man,
und sprach zu im: „du bist ein gesell.
sweig still und laß in varn in die hell.
du bist in guter schul gewesen
und hast die rechten bücher gelesen.
wir wollen uns hinein in die stuben setzen
und wollen uns unsers leids ergetzen.“
(V. 169–178)
Sie steht nun also als lachende Dritte bzw. eigentlich lachende Vierte plötzlich wieder im Mittelpunkt, ihr Lachen bezieht sich auf die hönerei (V. 169). Das Wort bedeutet so viel wie lat. cavillatio, ludibrium,[^46 Vgl. „höhnerei, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=H11417, abgerufen am 01.11.2022.] also entweder eine Art ‚Neckerei‘ oder ‚Spitzfindigkeit‘ oder in stärker negativer Semantik ‚Verhöhnung, Spott‘, was die vorsätzliche Täuschung stärker herausstellt. Allerdings steht nur in Handschrift De tatsächlich hönerey, in den älteren Textzeugen aus Dresden und Leipziger wurde humerey und pwberey (Fischer 1966, S. 201, Anm. zu V. 169) notiert. Ersterer Begriff ist bisher nicht nachgewiesen, seine genaue Bedeutung bleibt daher vorerst im Dunklen. pwberey ist im Frühneuhochdeutschen Wörterbuch belegt und ausschließlich negativ konnotiert: ‚Schurkerei, Betrügerei, Schandtat, Verbrechen‘[^47 Vgl. „büberei, die“, Frühneuhochdeutschen Wörterbuch, http://fwb-online.de/go/b%C3%BCberei.s.1f_1668631112, abgerufen am 01.11.2022.]. Diese Bedeutung erzeugt eine zusätzliche Spannung in Kombination mit dem Folgevers das ers so hübschlich hett gemachet (V. 170);[^48 Auch an dieser Stelle sind die Ausgaben recht großzügig, da der Vers sich derart in keiner der drei Handschriften findet. Stattdessen liest man dort:
Das ers ßo hofflich hett gemachet (De, fol. 166r)
Das erß so hubslich het wetracht (L, fol. 54r)
Das er es so hubschlich hette betrachtet (D, fol. 109v)
In der jüngsten Handschrift De wird darauf abgehoben, dass er es hofflich, das hier ‚klug‘ bedeutet, eingerichtet hat; es wird also das Vorgehen selbst fokussiert. Bei L und D liegt als Verb jeweils betrachten vor, in L mit typisch bairischem Wechsel von <w> und <b> (vgl. Paul ²⁵2007, S. 36). Dieses betrachten bedeutet ‚nachdenken über etwas‘, vgl. „betrachten“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B05867, abgerufen am 01.11.2022. Nun kann man noch das das einbeziehen, welches kausal übersetzt werden sollte: ‚weil er so klug darüber nachdachte‘ bzw. ‚weil er es derart klug eingerichtet hatte‘ – nämlich, dass der Liebhaber vom Ehemann unerkannt entkommen konnte (V. 171f.).] wie der Betrug funktionierte, ist für die Bäuerin also völlig durchsichtig.
Der Scholar löst am Ende des Märes sein Versprechen ein. Er brachte die Frau zum Lachen, wie es sich der Bauer ja anfangs gewünscht hatte; das Lachen der Ehefrau resultiert aus dem Durchschauen der vom schüler gelungen eingesetzten Inszenierung (vgl. Grubmüller 2005, S. 117 und S. 120). Dabei, so Grubmüller, habe der gewitzte Gast Ehemann und Pfarrer in Angst und Schrecken versetzt (vgl. Grubmüller 2005, S. 117). Ergänzen kann man: Den Mann durch die Pseudo-Beschwörung, den Pfarrer durch das (bedrohliche) Aufdecken der Speisen, das Wissen um das Versteck und die gewagte Art der Rettung.[^49 Grubmüllers Aussage greift bei Fassung II genaugenommen nur für die heute in Dessau verwahrte Handschrift, in der der Abgang des Pfarrers, wie gezeigt wurde, holpriger gestaltet ist; für die Handschriften aus Dresden und Leipzig ließe sich diese Feststellung aufgrund der dort stärker betonten Schauspieleinlage nicht derart final formulieren.]
Die kurze Ansprache der Bäuerin an den Studenten greift Philipp Reich auf; er argumentiert, dass die Sinnpluralität der entworfenen Welt und die Rolle des Studenten in jenen abschließenden Worten der Bäuerin hervortreten:
Dieser Sprechakt ist doppelt gerichtet. Primär bezieht sich die Aussage auf die Situation, dass der Student im Beisein ihres Ehemannes den vermeintlichen Teufel ausgetrieben hat: Die Bäuerin lobt die Kenntnisse des Studenten in schwarzer Magie. Sekundär aber erkennt sie auch die listige Klugheit des Studenten an, da er den Pfaffen so geschickt befreit hat. […] Zugleich unterwirft sie sich dem Intellekt des Studenten und bewirtet ihn fürstlich. (Reich 2021, S. 426f.)
Reichs Beobachtung zur Mehrdeutigkeit der Aussage der Bäuerin ist plausibel, von einer Unterwerfung muss man in diesem Zusammenhang aber nicht sprechen. Ihre doppelsinnige Aussage zur Ausbildung des Gastes deutet nicht nur an, dass sie das Geschehen richtig zu deuten versteht, sondern auch, dass sie selbst in der Lage ist, sich in kluger Weise in das Spiel mit der (Um-)Deutung der Ereignisse einzubringen. Dies zeigt sich auch im Anschluss bei ihrer Äußerung und wollen uns unsers leids ergetzen (V. 178). Auf den ersten Blick geht es um den Schrecken, den sich der Bauer beim Anblick des vermeintlichen Teufels holte, welchen man vergessen machen (ergetzen)[^50 Vgl. „ergetzen“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=E07551, abgerufen am 01.11.2022.] möchte. Das erfahrene leid gilt dabei zugleich der Hausherrin, da ihr Plan, sich mit dem Pfarrer zu vergnügen, nicht aufging; leid meint dann die verpasste Freude des Koitus‘.
Es schließt eine harmonisch-idyllische Szenerie an:
die nacht sie bei einander saßen.
die frau die trug in dar das pest,
was sie von essen und trinken west,
und lebten wol die ganzen nacht.
vil kurzweil er dem pauern macht.
(V. 180–185)
Alle drei werden letztlich in gewisser Weise entschädigt: Der Student erhält eine Unterkunft und (wie auch das Ehepaar) reiche Verpflegung. Die Bäuerin kommt ohne den Hauch eines Verdachtes als gute Gastgeberin davon, der Bauer wird hervorragend unterhalten.[^51 Diese Deutung kann primär für die Handschriften aus Dresden und Dessau angeführt werden. Im Leipziger Kodex ist die besonders gute Bewirtung als Lohn des Studenten betont, da in V. 181 jm (Fischer 1966, S. 201, Anm. zu V. 181) statt in, also ‚ihm‘ statt ‚ihnen‘, notiert wurde. Die Entschädigung des Gastes ist in diesem Fall entsprechend stärker gewichtet.]
Mit einem Dank für das Ehepaar verabschiedet sich der Student am Morgen (V. 186f.). Der Schlusspunkt des Märes ist die Verfassersignatur im letzten Vers: so hat geticht Hanns Rosenplüt (V. 183).
Vergleichende Analyse mit den Varianten von Fassung I
Nach dem intensiven Durchgang durch die II. Fassung des Märes widmet sich dieses Kapitel einer vergleichenden Lektüre, bei der verschiedene Abweichungen angesprochen werden. Das sind einerseits Umarbeitungen einzelner Verse, Verspaare oder kleinerer Abschnitte, andererseits aber auch Kürzungen der I. Fassung bzw. Erweiterungen der II. Fassung, die sich erst im direkten Vergleich offenbaren.[^52 Zu einer These bezüglich der Abhängigkeiten beider Fassungen s. u.] Es wird sich zeigen, dass insbesondere bei der Darstellung der Bäuerin und ihres Liebhabers Unterschiede feststellbar sind, die im Hinblick auf die übergreifende Interpretation zu einer Straffung des Dargestellten führen.
Einige allgemeine Beobachtungen zu den Unterschieden zwischen beiden Fassungen des ‚Fahrenden Schülers‘ formuliert Fischer (vgl. Fischer 1966, S. 540, Nr. 21a und 21b), Grubmüller greift diese im Kommentar seiner Ausgabe auf (vgl. Grubmüller 2011, S. 1313). Neben einigen geringfügigen Unterschieden gäbe es verschiedene Plus- und Minusverse[^53 Damit sind Verse gemeint, die im Vergleich zu anderen Fassungen zusätzlich auftreten (Plusvers) oder fehlen (Minusvers).] in beiden Fassungen sowie eine stark differierende Passage am Textbeginn. Für den Abdruck von Fassung II entschied sich Grubmüller, da diese nach seiner Ansicht „die in den zeitlich und örtlich autornahen Handschriften d* und l* besser überlieferte [ist, F.B.], die insgesamt – vor allem im Schlussabschnitt – auch den pointierteren Text bietet“ (Grubmüller 2011, S. 1314).
Beginnt man den Vergleich bei dem jeweiligen Titel, so lässt sich bereits ein erster Unterschied feststellen (S. Tabelle 1: Die Titel der Fassungen im Vergleich).[^54 Fassung II wird weiterhin nach Grubmüllers Ausgabe zitiert, Fassung I nach derjenigen Fischers. In den Fällen, bei denen mehrere Textzeugen der Fassung I zitiert werden, erfolgt die Wiedergabe jeweils nach den Textzeugen unter Angabe der Blätter und mit Verweis auf die Verse in Fischers Ausgabe nach einem ‚=‘. Die Transkriptionen sind diplomatisch angelegt. Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst; Superskripte werden auf den überschriebenen Buchstaben folgend hochgestellt abgebildet; fehlende Buchstaben in eckigen Klammern ergänzt.]
Titel
Fassung II
D, fol. 106v: Von eynem farenden
Schuler
L, fol. 50v: Vom farenden schuller
De, fol. 161r: Von eynem farenden
Schuler
Titel
Fassung I
G, fol. 18v: Ain schoner sproch
Von ainem farenden schuler
N1, fol. 31v: Ein spruch vom varnnden schuler
Ka, fol. 1: Von Einem Varnden Schuler
[+Holzschnitt]
E, Titelblatt: Ain hübscher spruch ainem
paurn vnd von seinem weib und von ainem
farenden schüler vnd von ainem pfafen
gar kurtzweilig zuo lesen[+Holzschnitt]
[We: fehlt, da nur das Textende erhalten ist]
Tabelle 1: Die Titel der Fassungen im Vergleich.
Bei Fassung II sind die Titel fast identisch und decken sich mit jenem des Drucks von Kachelofen (Ka). In den übrigen Überlieferungszeugen der I. Fassung wird zusätzlich darauf abgehoben, dass es sich bei dem Folgenden um einen spruch handle, also einen potentiell für den sprechenden Vortrag gedachten Text.[^55 Vgl. „spruch, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S37531, abgerufen am 01.11.2022, hier unter 2; vgl. „sprechen, verb.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S36780, abgerufen am 01.11.2022, hier unter 12.] Der ausführliche Titel und der Holzschnitt des Elchinger-Drucks aus Augsburg entsprechen der Tendenz im Druckwesen, Titelblätter zunehmend mit Illustrationen und (variablen) Angaben zu Drucker und Herstellungsort oder auch dem Inhalt auszustatten (vgl. Rautenberg 2004, S. 32f.; vgl. Rautenberg 2008; vgl. Schmitz 2018, S. 220–228).
Auch am Textbeginn lassen sich Unterschiede feststellen (s. Tabelle 2: Fassungsunterschiede bei V. 1–4):
Fassung II, V. 1–4
Nu horet einen klugen list,
wie einest einem widerfahren ist.
ein varender schüler ist er genant.
hübscheit ist mir von ihm bekant.
Fassung I, G, fol. 18v = V. 1–4
Hort hie ain clugen list
Wye ainsten aim geschehen ist
Ain farender schuler was er genant
Hubsch abentewr wurden Jm bekannt
Fassung I, N¹, fol. 31v = V. 1–4
Hört einen clugen list
Wie einest einem geschehen jst
—
Hübsch abenteür würden jm bekant
—
Fassung I, Ka, fol. 2
(und minimal abweichend: E, fol. 1) = V. 1–4[N]Un horet hie einen clugen list
Wie einest einem geschehen ist
—
Hubsch abentheur wurden im bekant
Alß ir hernach werdt horen zuhant
Tabelle 2: Fassungsunterschiede bei V. 1–4.
Alle vier Verse der II. Fassung begegnen bei Fassung I mit kleineren Varianten so nur in Handschrift G. Die ältere Handschrift N¹ sowie die Drucke Ka und E zeigen einen Minusvers nach dem ersten Verspaar, der aufgrund des fehlenden Reimwortes besonders auffällig ist. Dieser Ausfall von V. 3 könnte bei der oder den Vorlage(n) der Drucke bereits korrigiert worden sein, da sowohl in Kachelofens als auch Elchingers Ausgabe ein die Fehlstelle korrigierender und wahrscheinlich nachträglich hinzugefügter Vers nach V. 4 der II. Fassung folgt; dieser thematisiert erneut die hörende Rezeption (Alß ir hernach werdt horen zuhant). Trotz dieser kleinen Differenz stimmen die vier Zeugnisse der I. Fassung in V. 3 überein; statt hübscheit (Fassung II) wird hier ein Hubsch abenteür, ein unterhaltsames und doch ungewöhnliches Erlebnis,[^56 Vgl. „abenteuer“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=A00327, abgerufen am 01.11.2022.] versprochen.
Der eigentliche Einstieg in die Handlung ist die Ankunft des Studenten am BauernhauS. In Fassung II wird berichtet, dass der Pfarrer geladen wurde, um metaphorisch im Wald der Frau zu jagen (S. o.). In Fassung I hingegen liest man etwas anderes (s. Tabelle 3: Vergleich der V. 5–16 in beiden Fassungen):
Fassung II, V. 5–16
Zu einem pauern er eintrat.
die frauen er umb die herberg pat,
das sie in ließ liegen auf einer pank.
dorumb wolt er ir sagen großen dank.
die frau ob irem tische saß.
der pfaff im dorf mit ir aß.
den hett sie heimlich zu ir geheißen,
das er in irem vorst solt peißen.
dorumb er mit ir aß und trank.
der schüler hett ein bösen dank
und gedacht, was wirtschaft das mocht sein. pfeiten und pruch, was er hett,
die frau die pot im dar den wein
Fassung I, V. 5–16
Zu einem paurn er eindrat.
die frauen er umb die herberg pat,
das si in ließ ligen auf einer pank.
darumb wöllt er ir sagen dank.
die frau ob irem tisch saß.
der pfaff im dorf da mit ir aß.
den hett si heimlich geladen,
das er sollt kumen in ir gaden
und mit ir spilen in der taschen.
darumb wollt si jm waschen
und das er ir ein nachtdinst tet
Übersetzung der I. Fassung: Er betrat ein Bauernhaus und bat die Hausherrin um Beherbergung. Wenn sie ihn auf einer Bank schlafen lasse, wäre er ihr dafür dankbar. Die Hausherrin saß an ihrem Tisch und aß mit dem örtlichen Pfarrer. Diesen hatte sie heimlich eingeladen, damit er in ihr [Schlaf-]Zimmer käme, um sich mit ihr in der [gemeint ist: ihrer] „Tasche“ zu vergnügen. Wenn er ihr einen nächtlichen [Liebes-]Dienst leiste, würde sie ihm, was [auch immer] er an Hemden und Hosen hätte, waschen.
Tabelle 3: Vergleich der V. 5–16 für beide Fassungen.
Während man in Fassung II durch die Jagd-Metapher vom Plan des Ehebruchs erfährt, geht es in Fassung I direkter zu: Den Pfarrer habe die Bäuerin heimlich eingeladen, damit er in ihr (Schlaf-)Zimmer komme (V. 12),[^57 Vgl. „gadem, n. m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=G00124, abgerufen am 01.11.2022.] um sich mit ihr in der taschen zu vergnügen. Als tasche, teilweise auch untere tasche, bezeichnete man zunächst die Geschlechtsteile weiblicher Tiere, in spätmittelalterlichen Texten werden damit aber auch unverhohlen die Geschlechtsorgane von Frauen bezeichnet.[^58 Vgl. „tasche, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=T01162, abgerufen am 01.11.2022.] Doch nicht nur das: Angesprochen wird eine Art pragmatischer Tauschhandel. Für den Liebesdienst, der durch die genannte Metapher der tasche und den nachtdinst (V. 16) ausgedrückt ist, würde sich die Ehefrau um die Reinigung der Kleidung des Pfarrers kümmern – ein im Kontext des Geschlechtsverkehrs, der zur sündhaften Verunreinigung des Pfarrers führen würde (vgl. Angenendt 2009, S. 404–410), pikantes Detail.
Auch hier ist ein Blick auf die anderen Textzeugen der I. Fassung sinnvoll (s. Tabelle 4: Vergleich der Verse 13–16 in den Textzeugen von Fassung I).
Fassung I
N1, fol. 31v = V. 13–16
Vnd mit jr spilen jn der taschen
Darumb wollt sy jm waschen
Pfeyten vnd pruch was er hett
Vnd das er jr ein nachtdinst thett
Ka, fol. 2 = V. 13–16
Und mit ir spilen in der taschen
Darumb so wolt sie im waschen
Hembd und pruch und was er hett
Und das sie im ein nacht dinst thet
G, fol. 19r = V. 13–16
Vnd mit Jr spiln in der taschen
Darumb wolt sy Jm waschen
Hemde pruch vnd was er het
Vnd das er Jr ain nacht dienst thet
E, fol. 1 = V. 13–16
Vnd mit ir spillen in der taeschen
Darumb so wolt sy im waeschen
Hemet und pruoch was er het
Er sprach dz sy im ein nacht dienst det
Tabelle 4: Vergleich der Verse 13–16 in den Textzeugen von Fassung I.
Eine minimale Wortersetzung findet sich in der Gießener Handschrift, dort ist der Begriff pfeyten (N¹, V. 15) ersetzt. Pfeid ist ein V. a. im bairischen Sprachgebiet gebrauchtes Wort für ein Hemd;[^59 Vgl. „pfeid, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=P02967, abgerufen am 01.11.2022.] den überregional verständlicheren Terminus sieht man hingegen in den drei anderen Textzeugen.
Ein zweiter Unterschied besteht im Wechsel von Subjekt und Objekt in V. 16: In den Handschriften aus Nürnberg und Gießen ist es der Pfarrer, der der Bäuerin den Liebesdienst erbringen soll, dies ist als Ausgleichshandlung für die Dienstleistung des Wäschewaschens zu verstehen. In beiden Drucken hingegen erfüllt die Frau dem Mann den Gefallen, in Elchingers Druck wird dies durch die wörtliche Forderung des Geistlichen unterstrichen (‚er forderte, dass sie ihm einen nächtlichen [Liebes-]Dienst leiste‘). In den beiden Handschriften wird also das sexuelle Verlangen der Bäuerin stärker betont, in den Drucken hingegen die Lüsternheit des Geistlichen.
Diese Beobachtung lässt sich anhand eines in Fassung II nicht vorhandenen Doppelverses und durch einen variierten Folgevers stützen (S. Tabelle 5: Vergleich von V. 18–21 in Fassung II und 18–23 in Fassung I).
Fassung II, V. 18–21
und sprach: „mein man ist nicht daheimen.
vor im tar ich dich nicht geweren,
sust wolt ich dich herbergen geren.“
—
—
der pfaff der ward in krums ansehen.
Fassung I, V. 18–23
sie sprach: „mein man ist nit daheimen.
vor im tar jch dich nit gewern,
sust wölt jch dich behalten gern.“
der pfaff in seinem mut gedacht:
„hat dich der teufel hieher pracht,
der für dich wider außhin schir.“
Übersetzung der I. Fassung: Sie sagte: „Mein Ehemann ist nicht zu Hause. Seinetwegen kann ich es dir nicht gestatten, [auch wenn] ich dich sonst gern beherbergt hätte.“ Der Pfarrer dachte bei sich: „[Wenn] dich der Teufel hergeführt hat, so bringe er dich schnell wieder hinaus.“
Tabelle 5: Vergleich von V. 18–21 in Fassung II und 18–23 in Fassung I.
Als die Bäuerin den ungebetenen Besuch loszuwerden versucht, reagiert in Fassung II der Pfarrer nur mit einem schiefen Blick (Fassung II, V. 21). In Fassung I findet sich in allen Textzeugen ein kurzer innerer Monolog des Geistlichen (Fassung I, V. 21–23), in dem der Teufel, den der Pfarrer als Widersacher erfasst, thematisch eingeführt. Er droht dem Plan, mit der Bäuerin der körperlichen Liebe zu frönen, einen Strich durch die Rechnung zu machen – dies ist insofern überraschend, als der Teufel die angestrebte Sünde eher unterstützen als verhindern müsste. Sein Wunsch geht dennoch in Erfüllung: Der Student verlässt kurz darauf das Haus, zumindest vermeintlich.
Eine weitere Abweichung tritt auf, als der Scholar später die erste „Beschwörung“ des Teufels vornimmt, nachdem er den Bauern im Bannkreis platzierte (s. Tabelle 6: Vergleich von V. 89–93 in Fassung II und 91–93 in Fassung I.).
Fassung II, V. 89–93
und stund da mit dem pauern darein
und ward nu reden in latein.
„nicht vorcht dich!“, er zum pauern sprach,
„er mag uns tun kein ungemach.
und tu neur nach meinen worten eben
Fassung I, V. 91–93
und stellt sich und den paurn darein
und redt lang in der lappertein.
—
—
er sprach zum paurn: „merk mein wort eben
Tabelle 6: Vergleich von V. 89–93 in Fassung II und 91–93 in Fassung I.
Hier findet sich in allen Zeugen der I. Fassung eine Variante, die exemplarisch in N¹ zu lesen ist: Aus latein (Fassung II, V. 90) wurde lappertein (Fassung I, V. 92). Für dieses Wort sind bisher keine Belegstellen nachgewiesen, gewertet wurde der Begriff als eine Verballhornung von ‚Latein‘ (Fischer 1966, S. 540, Anm. zu V. 92 in Fassung I), die den Aspekt der fingierten Beschwörung stärker betone. Während Fischer auf lapp (eine Beschimpfung als ‚dummer Mensch‘)[^60 Vgl. „lappe, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=L01631, abgerufen am 01.11.2022.] verweist, könnte man hier auch eine Anspielung auf lapperei vermuten. Das Wort ist u. a. als Terminus zur Bezeichnung von ‚Dummheiten‘ oder ‚dummen Verhaltensweisen‘ nachgewiesen.[^61 Vgl. „lapperei, f.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=L01655, abgerufen am 01.11.2022.] Durch die Verballhornung wird unterstrichen, wie ungelehrt der Bauer ist, der den mit lappertein bezeichneten verbalen Unsinn des Studenten aufgrund der Sprachbarriere nicht als solchen entlarven kann. Für die Rezipient:innen wird an dieser Stelle in Fassung I deutlich, dass es sich nicht um eine tatsächliche Beschwörungsformel handelt.
Die in Fassung I fehlenden Verse zum Schutz vor dem Teufel (in Fassung II V. 91f.) sind im Hinblick auf das spätere Erschrecken des Bauern wichtig, da der explizite Hinweis über den Schutz sich in Fassung I sonst nicht findet, was die ängstliche Reaktion des Bauern beim Anblick des vermeintlichen Teufels plausibilisiert. Zugleich verspottet in der Folge auch hier der Student den Bauern derart, dass er doch gesagt habe, ihm könne nichts geschehen (V. 158–160). Es handelt sich daher um einen Hinweis darauf, dass Fassung I eine Bearbeitung von Fassung II darstellt, da andernfalls die inhaltliche Fehlstelle schwer zu begründen ist.
Die im Begriff lappertein anklingende Zurschaustellung der Naivität des beinahe betrogenen Ehemannes wird später in Fassung I weiter ausgeführt, indem in einer Äußerung des Scholaren der vereitelte Ehebruch noch einmal explizit gemacht wird (S. Tabelle 7: Vergleich von V. 102–105 in Fassung II und V. 102–107 in Fassung I).
Fassung II, V. 102–105
mit worten ich in gepannet han,
das er uns es ferr hat her gefürt
und hat es einem pfaffen abgespürt.
—
—
er solt bei einem weib sein gelegen.“
Fassung I, V. 102–107
mit worten ich in pannen kann,
das er uns das her gefurt hat,
das es dem pfaffen ab gat.
den hett ein weib zu ir geladen,
das er sollt sein kumen in ir gaden
und solt pei ir da sein gelegen.“
Übersetzung der I. Fassung: „[…] Mit Worten vermag ich ihn zwingen, dass er uns diese [die Lebensmittel] hergebracht hat, und zwar [so], dass sie dem Pfarrer [nun] fehlen. Den hatte eine Frau zu sich eingeladen, damit er in ihr [Schlaf-]Zimmer käme und ihr beiläge.“
Tabelle 7: Vergleich von V. 102–105 in Fassung II und V. 102–107 in Fassung I.
Während der Student in Fassung II lediglich die vermeintlich ferne Herkunft des Essens nennt, fehlt eine solche Entfernungsangabe in Fassung I. Er spricht dort in den beiden zusätzlichen Versen (Fassung I, V. 105f.) die Wahrheit, wenn er erwähnt, dass ein Pfarrer von einer Frau in ihr Gemach eingeladen worden sei, um ihr sexuell zu Diensten zu sein.
Zitiert wird, vom zusätzlichen sein abgesehen, im Vers das er sollt sein kumen jn jr gaden (Fassung I, V. 106) fast wörtlich der Textbeginn (vgl. Fassung I, V. 12); kurzzeitig Verschmelzen hier Erzähler und schüler. Wichtig ist außerdem, dass in Fassung I die Initiative der beteiligten Frau erneut betont wird (V. 105f.).
Auch der Pfarrer wird opportunistischer gezeichnet, als dies in Fassung II der Fall ist (S. Tabelle 8: Vergleich von V. 130–142 in Fassung II und V. 133–146 in Fassung I).
Fassung II, V. 130–142
der schüler steig auf unter das dach,
—
da er den pfaffen west und vand,
und sprach: „zicht bald ab euer gewant,
so hilf ich euch von diesem schimpf,
das ir davon kumpt mit gelimpf
und das euer niemant innen wirt,
wann euch noch niemant hat gespürt.“
der pfaff der sprach: „ich volg deiner leren.
hilfstu du mir hie darvon mit eren,
das ich on schaden kum davon,
so hab dir alls mein gewant zu Ion.
der pfaffe zog sich nacket ab.
er sprach: „die bruch muß auch herab.“
Fassung I, V. 133–146
der schuler steig unter das dach
(das selb der paur gar eben sach),
da er den pfaffen west vnd fant,
und sprach: „herr, zicht palt ab ewer gewant,
so hilf ich euch von disem schimpf,
das ir dauon kumbt mit gelimpf,
wann euer nimant innen wirt,
das euch die schant nicht angepirt.“
der pfaff sprach: „ich volg dir gern,
hilfstu mir hinauß mit ern
und hilfst mir mit dem leben davon,
ich gib dir mein gewant zu lon.“
der pfaff zoch sich nacket ab
die pruch er im auch darzu gab.
Übersetzung der I. Fassung: Der Student ging hinauf zum Dachboden (was der Bauer genau sah), [und zwar dorthin], wo er [vom Versteck] des Pfarrers wusste und [ihn] fand. Er sagte: „Mein Herr, zieht rasch eure Kleidung aus, dann helfe ich euch aus diesem Schlamassel, damit ihr glimpflich davonkommt, weil euch niemand erkennt; so bleibt die Schande nicht [an] euch kleben.“ Der Pfarrer sagte: „Ich höre gern auf dich, [wenn] du mir bei [Erhaltung meines] Ansehens und lebendig wegzukommen hilfst. Meine Kleidung gebe ich dir als Belohnung.“ Der Pfarrer zog sich vollständig aus, auch die Unterhose überreichte er ihm.
Tabelle 8: Vergleich von V. 130–142 in Fassung II und V. 133–146 in Fassung I.
In der Szene, in der der Student den versteckten Geistlichen aufsucht, schlägt er auch in Fassung I vor, dass der Pfarrer sich entkleiden soll. Diesmal ist die Anrede aber höflicher: Er spricht ihn als herr (Fassung I, V. 138), also als Höhergestellten (der er rein sachlich ja auch ist) an.
Ein alternativer Vers lässt sich dort feststellen, wo es darum geht, warum Nacktheit das Gebot der Stunde sei: Während in Fassung II darauf abgehoben wird, dass der Versteckte noch unentdeckt ist (V. 136), ist in Fassung I formuliert: Das euch die schant nicht angepirt (Fassung I, V. 140)[^62 Vgl. zu angebirt das Lemma zu ‚angebären‘ im Frühneuhochdeutschen Wörterbuch: http://fwb-online.de/go/angeb%C3%A4ren.s.3vu_1668653503, abgerufen am 01.11.2022.]; es geht also um das Vermeiden einer öffentlichen Schmach. Der Versteckte willigt ein, anders als in Fassung II will er aber nicht völlig schadlos davonkommen, sondern lediglich am Leben bleiben (Fassung I, V. 143), die Ansprüche sind also niedriger. Auch das Entkleiden ist schnell erledigt; eine separate Aufforderung, die Unterhose abzulegen, braucht es in Fassung I nicht, das erledigt der Geistliche gleich in einem Rutsch (Fassung I, V. 145f.).
Der Abgang des Pfarrers ist in Fassung I leicht variiert, auch hier begegnen zwei zusätzliche Verse (S. Tabelle 9: Vergleich von V. 143–148 in Fassung II und V. 147–154 in Fassung I.).
Fassung II, V. 143–148
da bescheiß er den pfaffen wol mit ruß
von oben herab biß auf den fuß
und macht in swarz als ie kein rab.
da rumpelt er die leitern herab
—
—
und pfuchzet gein dem bauern auß
und lief da zu der tür hinauß.
Fassung I, V. 147–154
er bescheiß den pfaffen wol mit ruß
von dem haubt piß auf den fuß.
er macht in schwarz als ie kein rab.
do rumpelt er die stigen ab.
er hub an grausamlich zu prumen.
der schüler sprach: „er wirt schir kumen.“
der pfaff sprang gen dem paurn auß
und lief zu der tür aus dem haus.
Übersetzung der I. Fassung: Er beschmierte den Pfarrer von Kopf bis Fuß völlig mit Ruß; er machte ihn schwärzer als [es] jemals ein Rabe [war]. Daraufhin polterte er [der Pfarrer] die Stiege hinunter. Er begann grässlich zu brüllen. Der Student sagte: „Er wird gleich erscheinen“. Der Pfarrer hechtete auf den Bauern zu und rannte [danach] durch die Tür nach draußen.
Tabelle 9: Vergleich von V. 143–148 in Fassung II und V. 147–154 in Fassung I.
Man sieht hier insgesamt eine ähnliche Gestaltung wie in Fassung II, wenn man die dortige Variante aus der Dessauer Handschrift, in der der Pfarrer unbeholfener dargestellt ist (S. o.), ausklammert. Seine Rolle ist dem Flüchtenden auch in Fassung I klar, sein gespieltes prumen (Fassung I, V. 151) entspricht freilich nicht jenem von Alexander, der missmutig und brummend wie ein Bär die erzwungene Trennung von Phyllis hinnimmt;[^63 Der Hinweis bezieht sich auf die von Markus Greulich am 13.01.2022 im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe gehaltene Vorlesung ‚Aristoteles und Phyllis‘ — Dynamiken des Begehrens.] stattdessen geht es in diesem Fall um eine bedrohliche akustische Ankündigung des folgenden (durchaus wörtlich zu verstehenden) Auftritts. Diese Bedeutung betont das Adverb grausamlich (Fassung I, V. 151) wodurch das Brummen die Bedeutung eines dem Brüllen ähnlichen Lautes[^64 Vgl. „brummen“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm,digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=B11948, abgerufen am 01.11.2022.] annimmt. Ein verängstigender Effekt stellt sich auch in Fassung I ein.
Ein kleines aber wichtiges Detail sei an dieser Stelle noch angesprochen (s. Tabelle 10: Vergleich von V. 155–159 in Fassung II und V. 161–164 in Fassung I).
Fassung II, V. 155–159
der pauer sprach: „solt ich nicht erschrecken?
er trug an im ein großen stecken.
Recht als ein cleine zuber stangen
daran sach ich ein gesleuder hangen,
das glenkert hinden an der stangen.
gesleuder ] D; L: schlewder; De, fol. 165v:
geschleuder
Fassung I, V. 161–164
der paur sprach: „solt ich nit erschrecken?
Er trug an im ein langen stecken.
—
Daran sach ich zwu schleudern hangen.
Die glunckerten an seiner stangen.
schleudern] N1; Ka; G, fol. 21r: schlewdern;
E, fol. 5: schlaudern
Übersetzung der I. Fassung: Der Bauer sagte: „Wie hätte ich nicht erschrecken können? Er trug einen langen Pfahl bei sich. An diesem sah ich zwei Schleudern hängen, die an seiner Stange baumelten. […]“
Tabelle 10: Vergleich von V. 155–159 in Fassung II und V. 161–164 in Fassung I.
Das an dem stecken (Fassung II, V. 156) hängende Gefäß der Steine wird in zwei Textzeugen der II. Fassung als geschleuder bezeichnet (D und De), in allen übrigen Zeugnissen als schleuder. Dieser Unterschied ist signifikant: gesleuder bedeutet nicht nur „Schleuder“ (Grubmüller 2011, S. 925, V. 157), sondern kann auch eine Ableitung von ‚Schleuder‘ darstellen. Diese bezeichnet eine „schleudertasche, bildlich von dem beutelförmigen kleidungstheil, der im 15. Jahrh[undert] das gemächt bedeckte“[^65 Vgl. „geschleuder, n.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=G10418, abgerufen am 01.11.2022.]. Es dürfte sich bei geschleuder also um einen Vorläufer der später als Schamkapsel bekannten Bedeckung des männlichen Geschlechts handeln.
Der Begriff gesleuder ist im Nürnberger Kontext noch in einem weiteren Fall belegt, nämlich in einer Reimpaarrede von Hans Folz, von der ein Nachdruck Peter Wagners im gleichen Sammelband überliefert ist wie der Druck des ‚Fahrenden Schülers‘ von Kachelofen.[^66 Es geht um den in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky verwahrten Band Scrin. 229d, in dem auch der Druck des ‚Fahrenden Schülers‘ von Konrad Kachelofen enthalten ist. Hier geht es um ‚Den Buhler‘, eine Reimpaarrede von Hans Folz, die 1488 von Folz selbst gedruckt worden ist (GW 10124, vgl. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10124.htmhttps://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10124.htm, abgerufen am 01.11.2022). Der Druck von Wagner ist im Gesamtkatalog der Wiegendrucke unter der Nummer GW 10125 verzeichnet, s. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW10125.htm, abgerufen am 01.11.2022. Der Text ist abgedruckt bei Fischer 1961, S. 243–248, Nr. 28, hier S. 247, V. 158.] Das ist aber nicht alles: Im 15. Jahrhundert gab es in Nürnberg offenbar einen modischen Trend, der darin bestand, dieses gesleuder besonders großzügig zu gestalten. Das ging so weit, dass in der Nürnberger Kleiderordnung von 1481 explizit jene künstliche Vergrößerung des dort „Latz“ genannten Utensils verboten wurde, wie man in Melanie Burgemeisters Studie zu Kleiderordnungen in Nürnberg, Regensburg und Landshut erfährt (vgl. Burgemeister 2019, S. 347, fol. 93r).[^67 In einer früheren Fassung der Nürnberger Ordnung von 1447 findet sich zwar der entsprechende Abschnitt noch nicht, die Ordnung von 1481 dürfte aber eine Fixierung verschiedener davor bereits erlassener weiterer Verbote darstellen (vgl. Burgemeister 2019, S. 254f.).] Das gesleuder des Pfarrers könnte man daher als subtilen Verweis auf einen ausufernden Modetrend verstehen. Der Witz ging später dann vielleicht verloren, da durch das Verbot das Ziel der Anspielung aus dem Alltag verschwand.
Folgt man dieser Annahme, dann lag dem spätesten Textzeugen des ‚Fahrenden Schülers‘ (der Handschrift De) möglicherweise eine Textstufe zugrunde, die auch in der Dresdner Handschrift ihren Niederschlag fand, da beide den auffälligen Begriff überliefern; dies deckt sich mit den Beobachtungen Reichels (vgl. Reichel 1985, S. 44–51).
Nun noch einige Worte zum Ende des Märes in Fassung I (S. Tabelle 11: Vergleich von V. 164–183 in Fassung II und V. 171–177 in Fassung I).
Fassung II, V. 164–183
„vor im getrau ich dich wol beschauern.
vorcht dich nimmer, er ist hin,
wann ich sein doch gewaltig bin,
und vach ein herz und bis ein man.
mein kunst ich wol beweret han.“
die frau der hönerei do lachet,
das ers so hübschlich hett gemachet,
das er dem pfaffen half davon,
das sein nicht kennen kond ir man,
und sprach zu im: „du bist ein gesell.
sweig still und laß in varn in die hell.
du bist in guter schul gewesen
und hast die rechten bücher gelesen.
wir wollen uns hinein in die stuben setzen
und wollen uns unsers leids ergetzen.“
sie gingen all drei in die stuben und aßen.
die nacht sie bei einander saßen.
die frau die trug in dar das pest,
was sie von essen und trinken west,
und lebten wol die ganzen nacht.
Fassung I, V. 171–177
vorcht dich nicht, er ist dahin
wann ich sein wol gewaltig pin.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
wir wollen uns zutisch setzen
und wollen uns unsers unmuts ergetzen.“
sie gingen in die stuben vnd aßen.
die nacht sie pei einander sassen
—
—
und lebten wol die ganzen nacht.
Übersetzung der I. Fassung: „[…] Fürchte dich nicht, er ist fort, da ich völlig die Gewalt über ihn habe. Wir sollten uns an den Tisch setzen und unseren Schrecken vergessen machen.“ Sie gingen in die Stube und aßen [gemeinsam]. Die ganze Nacht saßen sie beisammen und hatten eine wunderbare Zeit.
Tabelle 11: Vergleich von V. 164–183 in Fassung II und V. 171–177 in Fassung I.
Man erkennt unmittelbar, dass ein größeres Textstück in Fassung I fehlt. In Fassung II findet sich hier die für die Interpretation wichtige Szene, in der die Bäuerin den Studenten für sein gewieftes Vorgehen lobt und das gemeinsame Beisammensein einläutet. In Fassung I hingegen schließt die Aufforderung, das Geschehene gemeinsam ausklingen zu lassen (V. 173f.), unmittelbar an die Aussage des Studenten an, dass er die Macht über den Teufel habe (V. 172); hier spricht also der Student, nicht wie in Fassung II die Hausherrin. Doch nicht nur das: Es fehlt auch der Doppelvers, in dem angesprochen wird, dass die Hausherrin für eine besonders gute Verpflegung sorgt (in Fassung I V. 181f.).
Diese Änderungen wirken sich auf die Gesamtdeutung beider Fassungen aus: In Fassung I liegt, wie gezeigt wurde, eine etwas andere Akzentuierung der einzelnen Figuren im Märe vor. Die Libido von Bäuerin und Pfarrer sind stärker betont, durch das am Beginn thematisierte Tauschgeschäft sogar regelrecht abgelöst vom amourösen Charakter eines Liebesverhältnisses. Dem Geistlichen fehlt selbst die in Fassung II kurz gezeigte Scham, sich ohne Weiteres völlig zu entblößen, wenn dies der Sache dienlich ist, während er zugleich die Rolle des am Beginn in seinem inneren Monolog eingeführten Teufels ohne Skrupel spielt. Während Übernachtung und Bewirtung dem Studenten in Fassung II auf Veranlassung der Hausherrin zuteilwerden, da er durch Schlauheit die Situation für sie und sich selbst günstig zu wenden weiß, bringt er diese Form des Lohns in Fassung I selbst ins Gespräch. Die Bäuerin selbst spielt am Ende dieser Fassung eine untergeordnete Rolle, der Fokus liegt auf dem überlisteten Bauern und der Klugheit des Scholaren.[^68 Genaugenommen könnte man diese wahrscheinliche Schärfung und Reduktion der I. Fassung als die im wörtlichen Sinne pointiertere bezeichnen (vgl. die oben zitierte Aussage bei Grubmüller 2011, S. 1314) und damit gegen Grubmüllers Entscheidung für Fassung II argumentieren. Dass es sich bei Fassung II aber insgesamt um die – auch interpretatorisch – reizvollere handelt, soll damit nicht in Abrede gestellt werden.]
Diese Details kann man mit dem Hinweis darauf verbinden, dass Fassung I eine Bearbeitung der II. Fassung darstellt. Das dafür herangezogene Argument war, dass der Student den Bauern ob seines Erschreckens schilt, er habe ihm doch versichert, es drohe keine Gefahr, was in Fassung I aufgrund einer Tilgung aber nicht der Fall ist. Fassung I stellt sich damit insgesamt als gestraffte Variante des ‚Fahrenden Schülers‘ dar, in der verschiedene Details zugespitzter ausgestaltet sind.
Damit gerät noch einmal die Darstellung der Bäuerin in Fassung II in den Blick: Ihr Plan, ein Stelldichein mit dem Pfarrer zu erleben, scheitert zwar, doch ist im Hinblick auf ihre Position keine Kritik daran erkennbar, der (geplante) Ehebruch wird nicht bestraft. Im Gegenteil: Lachend steht sie in dieser Fassung am Ende da, während Ehemann und Liebhaber in der ein oder anderen Weise derangiert sind. Statt einer verbotenen sexuellen Ausschweifung bleibt ihr und dem Studenten immerhin ein intellektuelles Vergnügen.
Erneut: Zur Überlieferung von Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘
Nach den beiden Lektüren von Rosenplüts ‚Fahrendem Schüler‘, die einen intensiven Einblick in die Textgeschichte geboten haben, lohnt es sich, abschließend noch einmal auf die Überlieferung zu blicken (S. oben, Abb. 1).
Hans Rosenplüts Märe ‚Der fahrende Schüler‘ ist in zwei Fassung erhalten, die sich nicht nur im Hinblick auf ihren Versbestand unterscheiden, sondern insbesondere die Figuren der Ehefrau und des Pfarrers unterschiedlich akzentuieren. In Fassung II ist es die Bäuerin, die durch ihr Lachen als verständige Beobachterin des Geschehens neben den Studenten rückt; die von ihr veranlasste Belohnung des Gastes bedingt das versöhnliche Ende. In Fassung I hingegen bleibt der Scholar auch am Ende derjenige, der aktiv das Geschehen beeinflusst, er fordert seinen Lohn selbst ein.
Beide Fassungen sind über einen Zeitraum von etwa 60 Jahren hinweg bezeugt. Verbreiteter war die zuletzt besprochene I. Fassung, die durch das Fragment in der Weimarer Handschrift früh nachgewiesen ist. Wie auch die II. Fassung ist diese konsequent am Textende signiert (vgl. Fischer 1966, S. 200, V. 182 inkl. der Varianten; S. 201, V. 188 inkl. der Varianten), beide Fassungen kann man daher als wahrscheinlich „echte“ Rosenplüt-Dichtungen begreifen. Dennoch konnte eine Abhängigkeit der I. von der II. Fassung im Rahmen der Lektüre und Analyse nahegelegt werden, was die Bedeutung der intensiven Arbeit an und mit den Texten verdeutlicht.
Fassung I. ist insgesamt weiter verbreitet, was man als Hinweis darauf verstehen kann, dass diese von den Rezipient:innen bevorzugt wurde. Dagegen spricht freilich, dass man schlicht mögliche Wege der Überlieferung nicht ausklammern kann – eventuell war diese Fassung stärker im Umlauf (worauf die Überlieferung deutet) und wurde daher auch öfter handschriftlich vervielfältigt, bevor sie in der Offizin Konrad Kachelofens dann auch gedruckt wurde.
Die Überlieferungslücke nach dem Kachelofen-Druck könnte darauf hindeuten, dass die handschriftliche Überlieferung mit der Verbreitung im Druck nachgelassen hat; Elchingers Druck im 16. Jahrhundert könnte man als Versuch sehen, ein früher erfolgreiches Produkt neu aufzulegen und zu vertreiben. Umso erstaunlicher ist die späte ostmitteldeutsche Handschrift, insbesondere, wenn man der These folgt, dass das kleine Wörtchen geslauder auf eine frühe Textstufe der Vorlage hindeuten könnte. Denkbar ist, dass man bei dieser Handschrift auf eine ältere Vorlage zugriff, die nah bei Handschrift D stand.
Die Lücke vor Elchingers Druck muss allerdings nicht zwingend als Hinweis auf ein schwindendes Interesse verstanden werden, sondern könnte schlicht durch Überlieferungsverluste entstanden sein. Denn eines verdeutlicht der Augsburger Druck auf jeden Fall: Offenbar las man auch weiterhin das hier besprochene Märe, und zwar nicht nur für sich, sondern auch vor, wie eine nur in diesem Druck erhaltene Trinkheische (eine Aufforderung, dem Vortragenden ein Getränk zu spendieren) am Textende zeigt: vnd also ist es auß vnd ein / Het hans von Winßheim ein / Krausen mit wein (E, fol. 6).
Primärliteratur
- Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem. Hg. von Robert Weber, fünfte, verbesserte Auflage, hg. von Roger Gryson, Stuttgart 2007, online unter https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/VUL/ (1.11.2022).
- Die deutsche Märendichtung des 15. Jahrhunderts. Hg. von Hanns Fischer, München 1966 (Münchener Texte und Untersuchungen 12).
- Hans Folz. Die Reimpaarsprüche. Hg. von Hanns Fischer, München 1961 (Münchener Texte und Untersuchungen 1).
- Novellistik des Mittelalters, hg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller, Berlin 2011 (Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch 47) [= Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Hg., übersetzt und kommentiert von Klaus Grubmüller, Frankfurt / M. 1996 (Bibliothek des Mittelalters 23; Bibliothek deutscher Klassiker 138)].
- Rosenplütsche Fastnachtspiele. Edition und Kommentar von Nürnberger Spieltexten des 15. Jahrhunderts (einschließlich der Fastnachtspiele in der Handschrift Dresden, SLUB, Mscr.Dresd.M.183). Hg. von Klaus Ridder u. a. unter Mitarbeit von Martina Bezner u. a., Konzeption der Datenverarbeitung: Paul Sappler (†), fortgeführt von Thomas Ziegler, Berlin 2022.
Sekundärliteratur
- Angenendt, Arnold: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, 4. Auflage, Darmstadt 2009.
- Beine, Birgit: Der Wolf in der Kutte. Geistliche in den Mären des deutschen Mittelalters, Bielefeld 1999 (Braunschweiger Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur 2).
- Beutin, Wolfgang: Sexualität und Obszönität. Eine literatursoziologische Studie über epische Dichtungen des Mittelalters und der Renaissance, Würzburg 1990.
- Burgemeister, Melanie: Kleider – Kultur – Ordnung. Kulturelle Ordnungssysteme in Kleiderordnungen aus Nürnberg, Regensburg und Landshut zwischen 1470 und 1485, Münster / New York 2019 (Regensburger Schriften zur Volkskunde/Vergleichenden Kulturwissenschaft 37).
- Fischer, Hanns: Studien zur deutschen Märendichtung, 2., durchgesehene und erweiterte Auflage, besorgt von Johannes Janota, Tübingen 1983.
- Georges, Karl Ernst: Ausführliches lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Handwörterbuch. Aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der besten Hülfsmittel, Bd. 1: A–J, 6., fast gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage, Leipzig 1869.
- Glier, Ingeborg: Hans Rosenplüt als Märendichter, in: Grubmüller, Klaus u. a. (Hgg.): Kleinere Erzählformen im Mittelalter. Paderborner Kolloquium 1987, Paderborn u.a. 1988, (Schriften der Universität-Gesamthochschule-Paderborn, Reihe Sprach- und Literaturwissenschaft 10), S. 137–149.
- Glier, Ingeborg: Art. ‚Rosenplüt, Hans‘, in: Ruh, Kurt u. a. (Hgg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch, 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Redaktion: Christine Stöllinger-Löser, Bd. 8: ‚Revaler Rechtsbuch‘–Sittich, Erhard, Berlin / New York 2010 [unveränderte Neuausgabe der Originalausgabe von 1992], Sp. 195–211.
- Glier, Ingeborg: Art. ‚Rosenplütsche Fastnachtspiele‘, in: Ruh, Kurt u. a. (Hgg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch, 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Redaktion: Christine Stöllinger-Löser, Bd. 8: ‚Revaler Rechtsbuch‘–Sittich, Erhard, Berlin / New York 2010 [unveränderte Neuausgabe der Originalausgabe von 1992], Sp. 211–232.
- Glier, Ingeborg: Art. ‚Rosenplüt, Hans [Nachtr.]‘, in: Wachinger, Burghart u. a. (Hgg.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Begründet von Wolfgang Stammler, fortgeführt von Karl Langosch, 2., völlig neu bearbeitete Auflage, Redaktion: Christine Stöllinger-Löser, Bd. 11: Nachträge und Korrekturen, Berlin / New York 2010 [unveränderte Neuausgabe der Originalausgabe von 2004], Sp. 1333.
- Grafetstätter, Andrea: Vereitelte Mahlzeiten. Gescheiterte Ingestion in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Texten, in: Grafetstätter, Andrea (Hg.): Nahrung, Notdurft und Obszönität in Mittelalter und Früher Neuzeit. Akten der Tagung Bamberg 2011, Bamberg 2013 (Bamberger interdisziplinäre Mittelalterstudien 6), S. 57–75. DOI: https://doi.org/10.20378/irbo-51381.
- Griese, Sabine: Rosenplüt im Kontext, in: Plotke, Seraina und Seeber, Stefan (Hgg.): Schwanksammlungen im frühneuzeitlichen Medienumbruch. Transformationen eines sequentiellen Erzählparadigmas, Heidelberg 2019 (Germanisch-Romanische Monatsschrift, Beiheft 96), S. 61–90.
- Grubmüller, Klaus: Wer lacht im Märe und wozu?, in: Röcke, Werner / Velten, Hans Rudolf (Hgg.): Lachgemeinschaften. Kulturelle Inszenierungen und soziale Wirkungen von Gelächter im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Berlin / New York 2005 (Trends in Medieval Philology 4), S. 111–124.
- Grubmüller, Klaus: Die Ordnung, der Witz und das ChaoS. Eine Geschichte der europäischen Novellistik im Mittelalter: Fabliau – Märe – Novelle, Tübingen 2006.
- Henkel, Nikolaus: Kurzfassungen höfischer Erzähldichtung im 13./14. Jahrhundert. Überlegungen zum Verhältnis von Textgeschichte und literarischer Interessenbildung, in: Heinzle, Joachim (Hg.): Literarische Interessenbildung im Mittelalter. DFG-Symposion 1991, Stuttgart / Weimar 1993 (Germanistische Symposien-Berichtsbände 14), S. 39–59.
- Hoffmann, Werner J.: Die Mittelalterlichen Deutschen und Niederländischen Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek – Staats – und Universitätsbibliothek Dresden, Frankfurt am Main 2022 (Archivum Medii Aevi Digitale – Studies: Catalogues 1). DOI: https://doi.org/10.25716/amad-85248.
- Horváth, Eva / Stork, Hans-Walter (Hgg.): Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort. Volkssprachige Literatur in Handschriften und Drucken aus dem Besitz der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Ausstellungskatalog, Kiel 2002 (Schriften aus dem Antiquariat Dr. Jörn Günther, Hamburg 2).
- Kiepe, Hansjürgen: Die Nürnberger Priameldichtung. Untersuchungen zu Hans Rosenplüt und zum Schreib- und Druckwesen im 15. Jahrhundert, München / Zürich 1984 (Münchener Texte und Untersuchungen 74).
- Kully, Elisabeth: Codex Weimar Q 565, Bern / München 1982 (Deutsche Sammelhandschriften des späten Mittelalters).
- Meier, Christel / Suntrup, Rudolf: Handbuch der Farbenbedeutung im Mittelalter. 2. Teil: Lexikon der Farbenbedeutungen im Mittelalter, Köln 2011 [CD-Rom].
- Paul, Hermann: Mittelhochdeutsche Grammatik, 25. Auflage, neu bearbeitet von Thomas Klein u. a., mit einer Syntax von Ingeborg Schöber, neubearbeitet und erweitert von Heinz-Peter Prell, Tübingen 2007 (Sammlungen kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte, A. Hauptreihe 2).
- Rautenberg, Ursula: Das Titelblatt. Die Entstehung eines typographischen Dispositivs im frühen Buchdruck (Alles Buch. Studien der Erlanger Buchwissenschaft 10), Erlangen-Nürnberg 2004.
- Rautenberg, Ursula: Die Entstehung und Entwicklung des Buchtitelblatts in der Inkunabelzeit in Deutschland, den Niederlanden und Venedig. Quantitative und qualitative Studien, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 62, 2008, S. 1–105.
- Reich, Philip: Der fahrende Schüler als prekärer TypuS. Zur Genese literarischer Tradition zwischen Mittelalter und Neuzeit, Berlin / Boston 2021 (Deutsche Literatur. Studien und Quellen 39).
- Reichel, Jörn: Der Spruchdichter Hans Rosenplüt. Literatur und Leben im spätmittelalterlichen Nürnberg, Stuttgart 1985.
- Reichlin, Susanne: Ökonomien des Begehrens, Ökonomien des Erzählens. Zur poetologischen Dimension des Tauschens in Mären, Göttingen 2009 (Historische Semantik 12).
- Schimmelpfennig, Bernhard: Die Degradation von Klerikern im späten Mittelalter, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 34, 1982, S. 305–323.
- Schmitz, Wolfgang: Grundriss der Inkunabelkunde. Das gedruckte Buch im Zeitalter des Medienwechsels, Stuttgart 2018 (Bibliothek des Buchwesens 27).
- Seelbach, Ulrich: Katalog der deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Gießen, vorläufiger Abdruck (Stand: 30. August 2007), URN: urn:nbn:de:hebis:26-opus-48693.
- Tanner, Ralph: Sex, Sünde, Seelenheil. Die Figur des Pfaffen in der Märenliteratur und ihr historischer Hintergrund (1200–1600), Würzburg 2005.
- Weiser-Aall, Lily, Art. ‚fahrende Schüler‘, in: Hoffmann-Krayer, E[duard] / Bächtold-Stäubli, Hanns (Hgg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 2: C–Frautragen, Berlin/Leipzig 1929f. (Handwörterbücher zur deutschen Volkskunde, Abteilung 1: Aberglaube), Sp. 1123f.
- Williams-Krapp, Werner: Literatur und Standesgefüge in der Stadt. Nürnberg im 15. und frühen 16. Jahrhundert, in: Sahm, Heike / Schausten, Monika (Hgg.): Nürnberg. Zur Diversifikation städtischen Lebens in Texten und Bildern des 15. und 16. Jahrhunderts, Berlin 2015 (Zeitschrift für deutsche Philologie 134, 2015, Sonderheft), S. 9–23.
Online-Journal #3
Online-Journal #3 Download
Inhalt
Vorbemerkung
Einleitung
(Universität Leipzig)
Beiträge:
Sprachwissenschaft
Zu den Problemen der Reflexivität aus der
deutsch-polnischen
Perspektive
Nichtverstehen kurzgefasst –
Eine korpuslinguistische Untersuchung der Funktionen
des
Nichtverstehensmarkers hä in Interaktionen
Einfluss der bilingualen Erziehung auf den
deutsch-polnischen Spracherwerb
Rhetorische Figuren in der Werbesprache
Beiträge:
Literaturwissenschaft
Die unterschiedlichen Textbestände der
Historienbibel IIa
Überlegungen zur Poetik des Prosa-‚Tristrant‘ (1484)
Hierarchiedynamik im ‚Salomon und Markolf‘
Gellerts ‚Gedanken‘ und die ‚Freundschaftlichen
Briefe‘ Gleims
Epistemische Funktion des Briefes
Karl August Varnhagens von Ense mit Alexander von Humboldt
und Ignaz Paul Vital Troxler
Körperdarstellung in der Korrespondenz Rahel Varnhagens: Nerven, Schmerz und Krankheit
Dualistische Identität
Translatologische Biografie und übersetzerisches Werk von Lisa Palmes (geb. 1975)
Stille Perturbationen
Vorbemerkung
Vom 16. bis 22. Juli 2023 waren wir in Krakau auf einer Sommerschule; wir, das war das Projektteam der Germanistischen Institutspartnerschaft zwischen Krakau und Leipzig,[^1 Das Projektteam besteht aus den folgenden Personen in alphabetischer Reihenfolge: Prof. Dr. Zofia Berdychowska (Krakau), Dr. phil. habil. Magdalena Filar (Krakau), Prof. Dr. Sabine Griese (Leipzig), Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal (Krakau), Prof. Dr. Frank Liedtke (Leipzig), Dr. Robert Mroczynski (Leipzig), Dr. phil. habil. Paweł Zarychta (Krakau). Dr. Stephanie Bremerich (Leipzig), die ebenfalls zum Projektteam gehört, konnte leider nicht teilnehmen, da sie sich zu dem Zeitpunkt noch in Elternzeit befand.] und das waren insgesamt zwanzig Studierende und Promovierende beider germanistischer Institute.[^2 Teilgenommen haben aus Krakau: Katarzyna Giemza, Beata Gorycka, Wojciech Król, Aleksandra Porada, Olga Pruciak-Suska, Aleksander Szeląg, Joanna Szczukiewicz, Anna Wojciechowska-Pieszko, Maria Wyrostek und Wojciech Zając. Aus Leipzig haben Sebastian Franke, Anna Luise Klemm, Richard Krabi, Kaja Landmann, Gina Lawniczak, Jörn Mennicke, Franziska Merz, Julia Seibicke, Kinga Szczech und Raphael Toth teilgenommen.] Verstärkung bekamen wir aus dem Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek Leipzig durch Katrin Sturm und auf Krakauer Seite durch Herrn Dr. Michael Sobczak, der uns trotz anfänglichen Starkregens eine wunderbare Stadtführung geboten hat, und durch Frau Dr. Agnieszka Sowa, die an den Vorträgen teilnehmen konnte und die Diskussion bereicherte.
So leuchtend wie unser Plakat, das wie sämtliche Werbematerialien (Stifte, Schreibhefte, Flyer, Namensschilder) von dem Designerbüro GRUETZNER TRIEBE in Leipzig stammt, dem dafür ausdrücklich gedankt sei, war die gesamte Woche. Sie stand unter dem Thema „Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig“ und hat Studierende, Promovierende und Dozierende beider Institute miteinander ins Gespräch gebracht. Wir haben Einblicke in verschiedene Projekte, Arbeitsstände und Arbeitsvorhaben erhalten, wir haben uns in der Biblioteka Jagiellońska originale Handschriften verschiedener Jahrhunderte ansehen dürfen und sind über textlinguistische Phänomene ins Gespräch gekommen. Bei weitgehend wunderbarem Wetter und in sowohl anregender wie freundschaftlicher Atmosphäre haben wir im Collegium Paderevianum, dem Seminargebäude in Krakau gearbeitet und diskutiert und wurden in den Pausen mit Kaffeespezialitäten und kleineren Köstlichkeiten verwöhnt. Wir haben in den Präsentationen Einblicke in verschiedene Arbeitsvorhaben bekommen: Bachelorarbeiten, die gerade entstanden, Masterarbeiten, die abgeschlossen waren oder die sich in der Endphase des Schreibprozesses befanden, auch Kapitel aus Dissertationen oder bereits abgeschlossene Dissertationsprojekte wurden vorgestellt, sogar Hausarbeitsthemen aus vergangenen Semestern wurden als Vortrag neu aufgelegt, um Ideen und Forschungsergebnisse zu artikulieren und vor allem um den Spaß an der philologischen, methodischen und analytischen Arbeit zu beweisen.
Es gab kein verbindendes Thema für die Vorträge, da jeder sein eigenes Arbeitsvorhaben vorgestellt hat; dadurch haben wir jedoch einen anregenden Überblick über die in Leipzig und Krakau aktuell bearbeiteten Themen und Forschungsprojekte erhalten.
Verschiedene Anforderungen waren für die Präsentationen vorgegeben: ein strenges Zeitgerüst, das einzuhalten war, Moderationsaufgaben, die Präsentation des eigenen Vorhabens vor einem Publikum, das aus Germanist:innen bestand, aus Literatur- und Sprachwissenschaftler:innen, die mit unterschiedlichem Methodeninventar hantieren, dazu kam die Aufgabe, in der Diskussion zu bestehen, auch Fragen an die Referent:innen zu stellen oder (moderate) Kritik zu äußern – alles Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens, die geübt werden müssen. Die Sommerschule bot dafür einen sehr gelungenen Rahmen.
Aufgrund des großen Erfolgs der Sommerschule und vor allem aufgrund der Qualität der Vorträge entschieden wir uns am Ende der Präsentationen noch in Krakau dazu, die Beiträge der Nachwuchswissenschaftler:innen im dritten Online-Journal zu publizieren, damit die Ergebnisse des Nachdenkens und des wissenschaftlichen Arbeitens sichtbar und zitierbar sein würden. Die Herausgeberschaft sollte ebenfalls in der Hand der Studierenden und Promovierenden liegen, die dadurch zugleich Erfahrungen in der Redaktionsarbeit sammeln konnten.
Dieses Online-Journal #3 liegt nun vor und ich freue mich sehr, dass damit der Höhepunkt der ersten Projektphase der Germanistischen Institutspartnerschaft (2021–2023), der in der wunderbaren Sommerschule in Krakau bestand, in eine Publikation überführt worden ist, die für alle Erinnerung ist, aber auch Nachhaltigkeit bedeutet.[^3 Leider konnten nicht alle Vorträge in Beiträge überführt werden; diejenigen von Anna Wojciechowska-Pieszko, Wojciech Król, Maria Wyrostek und Wojciech Zając fehlen leider in diesem Online-Journal.]
Am Ende möchte ich mich stellvertretend für alle Teilnehmer:innen aus Leipzig für die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Krakauer Kolleg:innen bedanken, die uns Stadt und Institut erschlossen und wunderbare Gesprächsrunden in herrlichen Sommeratmosphären boten. Dabei erkannten wir immer wieder, wie fruchtbar das Sprechen über Textdynamiken ist, wie anregend und freundschaftlich unsere Gespräche sind. Dieses so glücklich gewählte Label der „Textdynamiken“ ermöglichte den Austausch zwischen Fächern und Teilfächern, verband die germanistische Mediävistik mit dem 19. Jahrhundert und deren materielle Kulturen, vor allem die Reiseerinnerungen der Dorothea von Sagan waren ein Beispiel dafür, wie mittelalterliche Traditionen der Text-Bild-Synopsen aufgegriffen und adaptiert wurden, dies zeigte uns Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal eindrücklich.
Ein herzlicher Dank gilt der Biblioteka Jagiellońska, vor allem Frau Dr. Monika Michalska, die uns den Blick auf Fragmente des ‚Nibelungenlieds‘ aus dem 13. und 14. Jahrhundert sowie auf einen berühmten Kleist-Brief gewährte und uns bereits am frühen Morgen, vor Öffnung des Handschriftenlesesaals für das Publikum, so freundlich Auskunft erteilte.
Auch Frau Univ.-Prof. Dr. habil. Anna Klimkiewicz, Prodekanin der Philologischen Fakultät der Jagiellonen-Universität, und Frau Univ.-Prof. Dr. habil. Agnieszka Palej, Vize-Direktorin des Instituts für Germanische Philologie möchte ich herzlich danken, die unsere Sommerschule im prächtigen Bobrzyński-Saal des Collegium Maius mit ihren Grußworten eröffneten.
Insgesamt sahen wir, wie anschlussfähig das Nachdenken über Bewegungen von Texten und Textprozessen ist und deswegen ist es umso erfreulicher, dass der DAAD, dem an dieser Stelle für die Finanzierung der gesamten Sommerschule und der ersten Förderphase 2021–2023 ausdrücklich gedankt sei, auch die zweite Phase unserer Germanistischen Institutspartnerschaft (2024–2026) genehmigt hat. Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre der Zusammenarbeit zwischen Leipzig und Krakau, eine Sommerschule wird dabei erneut einer der Meilensteine sein, diesmal wird sie in Leipzig stattfinden!

© 2023 Textdynamiken
Plakat: Internationale Sommerschule 2023
- Griese, Sabine. 2024. Vorbemerkung. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 4–5. Leipzig (textdynamiken 3).
Einleitung
Einleitung
Das Textdynamiken-Projekt
Das Textdynamiken-Projekt ist eine vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) geförderte germanistische Institutspartnerschaft zwischen den Instituten für Germanistik der Universität Leipzig und der Jagiellonen-Universität Krakau. Es startete im Januar 2021, die Ursprünge liegen jedoch noch weiter in der Vergangenheit. Bereits seit geraumer Zeit besteht eine Partnerschaft zwischen den beiden Instituten und damit eine intensive Zusammenarbeit zwischen einzelnen Forschenden. Im Jahr 2019 keimte die Idee, daraus ein offizielles Projekt zu machen. Im Sommer 2020 wurde ein Projektantrag gestellt, der erfreulicherweise durch den DAAD bewilligt wurde. Unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Griese (Ältere deutsche Literatur), Dr. Stephanie Bremerich (Neuere deutsche Literatur), Prof. em. Dr. Frank Liedtke (Sprachwissenschaft) und Dr. Robert Mroczynski (Sprachwissenschaft) von Leipziger Seite und Prof. Dr. Zofia Berdychowska (Sprachwissenschaft), Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal (Neuere deutsche Literatur), Dr. phil. habil. Magdalena Filar (Sprachwissenschaft) sowie Dr. phil. habil. Pawel Zarychta (Neuere deutsche Literatur) von der Krakauer Universität umfasst die Partnerschaft gemeinsame Lehr- und Forschungsprojekte, darunter Tutorien, Ringvorlesungen, Team-Teachings, Gastvorträge und nicht zuletzt die Sommerschule. Diese fand im Juli in Krakau statt, woraus auch dieses bereits dritte Online-Journal hervorgeht.
Durch die Vielzahl an Kooperationen haben Studierende, Promovierende und Lehrende die Möglichkeit, in direkten Austausch miteinander zu treten. Während der Sommerschule wurden unter anderem Projekte der Älteren deutschen Literatur, der Neueren deutschen Literatur und der germanistischen Sprachwissenschaft vorgestellt.
Der Begriff Textdynamiken wurde als Titel gewählt, weil das Phänomen der Dynamik sowohl in der Literatur- als auch in der Sprachwissenschaft und damit über die germanistischen Teilbereiche hinweg wahrgenommen werden kann. Textdynamiken bedeuten Veränderungen von Texten, aber auch Bewegungen, Fortschritt oder Wechsel innerhalb der Textstruktur. In den vielfältigen Beiträgen dieses Journals sind die verschiedenen Facetten des Begriffs besonders gut zu erkennen. Durch den Begriff Textdynamiken wird ein Raum geschaffen, in dem sich die zwei Bereiche treffen und gegenseitig durch Diskussion und Austausch bereichern können. Verschiedenste Texte von mittelalterlichen Historienbibeln über Briefe bis hin zu Werbetexten werden betrachtet und diskutiert, wobei der Fokus immer auf dynamischen Prozessen liegt. Dazu werden unterschiedliche Dimensionen untersucht, unter anderem die historische, die materielle, wie auch die kommunikative und ästhetische (es gab wohl kaum Teilnehmende, die nicht von den wunderschönen Zeichnungen und der makellosen Handschrift in dem Reisebericht der Herzogin Dorothea von Sagan begeistert waren).
Wie passt das Konzept der Textdynamiken in die Fachbereiche der Germanistik? In der Mediävistik kommen besonders viele textinterne Bewegungen und das Feld der medialen Übertragung vor. Vor der Erfindung des Buchdrucks mussten Texte handschriftlich vervielfältigt werden, wobei die Schreibenden die Texte häufig änderten und somit bei jeder Abschrift Varianten des ursprünglichen Textes entstanden. Gründe dafür sind beispielsweise, dass ein Schreibender die Handschrift des vorherigen Schreibenden nicht mehr gut lesen konnte, da sich über die Jahre auch die Art, bestimmte Buchstaben zu schreiben, wandeln konnte, oder dass schlicht Fehler beim Abschreiben passierten. Bevor die Texte zum ersten Mal niedergeschrieben wurden, waren sie meist nur mündlich überliefert, wobei sie mit jeder Überlieferung weiter verändert wurden. Durch die vielzähligen Veränderungen sind die Texte äußerst dynamisch, da jede Abschrift ein eigenes Werk darstellt.
Weiterhin wurde im Zusammenhang der Textdynamik über Thomas Manns Figurenkonzeption in seinem Frühwerk referiert. Die Protagonisten zeigen innerhalb ihrer Entwicklung im Rahmen der Novellen Bewegungs- sowie Stagnationsmotive auf. Auch in Briefen zeigt sich eine besondere Form der Textdynamik, denn Briefe verbinden Elemente der Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Außerdem erkennt ein geübtes Auge bei Briefen meist auf den ersten Blick, wie die Beziehung zwischen Sender und Empfänger aussah, denn die Art des gewählten Papiers, die Sauberkeit der Schrift sowie das Layout und die Breite des Randes zeigen an, ob Sender und Empfänger sich nahestehen oder eine Beziehung des Respekts zueinander haben.
Wie reiht sich jetzt die Sprachwissenschaft in die Textdynamiken ein? Man könnte denken, dass sich die Sprachwissenschaft nur mit gesprochener Sprache befasst, aber hier läge man falsch. Zum einen können Texte aus linguistischer Perspektive untersucht werden, zum anderen sind in der Gesprächslinguistik Transkripte aus der Arbeit nicht wegzudenken. Transkripte dienen dazu, ein Gespräch in allen Einzelheiten untersuchen zu können, woraus man zum Beispiel Erkenntnisse über die Funktionen bestimmter Partikeln gewinnen kann. Die Untersuchung von geschriebenen Texten hingegen beschäftigt sich unter anderem mit den Mechanismen, die die Lesenden einen Text überhaupt erst verstehen lassen und mit der Frage, was einen Text zu einem Text macht. Dabei stehen die gesprochene und geschriebene Sprache immer wieder miteinander im Wechselspiel, denn, wie bereits bei den Briefen erwähnt, gibt es Fälle, in denen Mündlichkeit und Schriftlichkeit aufeinandertreffen und nicht klar abzugrenzen sind.
Die Sommerschule
Das Konzept einer Sommerschule mag nicht jeder und jedem geläufig sein, weswegen es für viele Teilnehmende regelrecht aufregend war, die Reise nach Krakau anzutreten. Waren zu Beginn noch nicht alle untereinander bekannt, gab es zum Ende der Woche ein starkes Gemeinschaftsgefühl, schließlich wurden die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen, teilweise das Zimmer, ein Teller oder die Vorliebe für den ein oder anderen Absacker miteinander geteilt. Auf Tagungen bilden sich Menschen vom Fach in ihrem oder einem anderen Fachgebiet durch Vorträge und Diskussionsrunden weiter. So auch in Krakau. Der Auftakt fand in einem wunderschönen Saal des Collegium Maius, dem ältesten Universitätsgebäude Krakaus, statt. Dabei bestand die Möglichkeit in großer Runde die verschiedenen Teilnehmenden kennenzulernen. In den folgenden Tagen bekamen wir dann auch inhaltliche Einblicke in die Arbeit verschiedener Dozierender, Promovierender und Studierender aus allen Fachbereichen der Germanistik. Hierbei wurde der Bogen von mittelalterlicher Handschriftenkunde über die Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts bis hin zu Textverstehen in der Gegenwart gespannt. Denn die große Gemeinsamkeit aller Fachbereiche der Germanistik ist die Arbeit an und mit Texten.
Wie wichtig die Materialität für die Auseinandersetzung mit Texten ist und welche Faszination von den originalen Handschriften ausgeht, zeigte der Besuch der Jagiellonen-Bibliothek. Fragmente des ‚Nibelungenlieds‘ aus dem 13. Jahrhundert, die sich Gelehrte im 19. Jahrhundert für ihre Sammlung schenkten, begeisterten dabei genauso wie die schon zuvor erwähnten Reiseerinnerungen einer Gräfin. Es wurde intensiv über das Material, den Zustand, den Fundort, das Schriftbild, den Einband und vieles mehr diskutiert. Aber auch die Auseinandersetzung mit Literatur aus der sprachwissenschaftlichen Perspektive kam nicht zu kurz. Dabei ging es immer wieder um Verstehensprozesse und wie diese in die Dynamik von Texten hineinspielen. Die Kaffeepausen mit Gebäck und Obst boten dann die Möglichkeit, sich mit anderen über das eben Gehörte auszutauschen oder bestimmte Rückfragen zu stellen. Die Vielfältigkeit an Themen, mit denen sich die Teilnehmenden der Sommerschule beschäftigen, zeigte sich dann auch in den Projektvorstellungen der Promovierenden und Studierenden. Besonders spannend wurde es, wenn Verbindungen zwischen verschiedenen Projekten festgestellt und gegenseitig von dem Wissen und den Gedanken profitiert werden konnte. Die Untersuchungen illustrierter Historienbibeln einer Schreiberwerkstatt des 15. Jahrhunderts warfen ebenso wie die Werke Judith Hermanns Fragen der Textdynamik auf. Die Untersuchung, wie junge Erwachsene in ihrer Freizeit Filme, Lieder und Eigenproduktionen synchronisieren (das sogenannte Fandubbing), wodurch eine andere, ungewohnte Textform entsteht, ließ sich ebenso gut diskutieren wie die Untersuchungen von Briefwechseln bekannter Wissenschaftler:innen und Literat:innen. Die letzten beiden Tage der Sommerschule bestanden dann weiterhin aus Vorträgen mit anschließender Diskussion – nun aber zum größten Teil von Studierenden in verschiedenen Phasen ihres Studiums. Mit den Beiträgen dieses Online-Journals erhalten die Studierenden und Promovierenden die Möglichkeit, ihre Forschungsarbeiten vorzustellen. Es lässt sich gut illustrieren, wie so eine Diskussionsrunde mit Vortrag aussieht. Die vortragende Person sitzt vor den in U-Form sitzenden Teilnehmenden und Interessierten aus Leipzig und Krakau. Anschließend folgt eine Frage- und Diskussionsrunde, die von wechselnden Teilnehmenden moderiert wird. Aufgabe der Moderation ist es, die Zeit und die Redebeiträge im Blick zu behalten, damit jede / r Vortragende die Möglichkeit bekommt, auf Rückfragen zu reagieren. Dabei steht der wissenschaftliche Austausch im Vordergrund. Es handelt sich nicht um eine Prüfungssituation, sondern um ein Gespräch, in dem alle Beteiligten von den Gedanken und dem Wissen der anderen profitieren sollen. Der konzentrierte und interessierte Austausch in einem solchen Rahmen ist ein wunderbarer Nährboden für neue Ideen, Methoden, Forschungsthemen oder Wissensbereiche. An die Referate schloss sich eine Gesprächsrunde an, in der die Lehrenden der verschiedenen Universitäten bereit waren, auf Fragen aller Art zu Studium, Promotion, wissenschaftlichem Arbeiten, aber auch Erfahrungen im Fach und dem Umgang mit Zweifeln, Schreibblockaden oder Sorgen einzugehen. Dass ein Austausch über Länder-, Sprach-, Fach-, Berufs- und Altersgrenzen hinweg stattfinden kann, war der Kerngedanke dieser Sommerschule.
Die Stadt Krakau und die Freizeitgestaltung
Krakau - eine Stadt voller Geschichte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die einstige Hauptstadt des Königreichs Polen zu einem aufblühenden Kultur- und Wissenschaftszentrum. Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Stadt war die Gründung der Krakauer Akademie im Jahr 1364, des Vorläufers der heutigen Jagiellonen-Universität, in deren Räumen die Teilnehmenden der Sommerschule beider Städte sich erstmals trafen. Dem Kennenlernen aller an der Sommerschule beteiligten Dozierenden, Promovierenden und Studierenden folgte ein Stadtrundgang. Unser Stadtführer Herr Dr. Michael Sobczak glänzte mit seinem Wissen über die Geschichte Krakaus und steckte uns mit seiner Liebe zu dieser Stadt an. Besonders in Erinnerung ist die Gründungslegende um Stammesfürst Krak geblieben, der die Stadt auf dem Wawelhügel und der darunterliegenden Drachenhöhle gründete, nachdem er den dort lebenden Drachen getötet hatte. Eine feuerspeiende Drachenstatue zeugt eindrucksvoll von diesem Mythos. Weitere Aspekte des Stadtrundgangs betrafen die zahlreichen Kunstepochen, von denen das Stadtbild Krakaus zeugt und die glücklichen Umstände auf Grund derer große Teile des historischen Baubestandes über die beiden Weltkriege hinaus erhalten geblieben sind.
Die Abende verbrachten wir oftmals in kleineren Gruppen, um gemeinsam zu essen, uns zu unterhalten und die Freizeit mit den neu kennengelernten Freunden zu genießen. Schnell haben wir in dieser Woche eine Gruppendynamik entwickelt. Gefördert wurde diese durch eine erste Mahlzeit zusammen mit den polnischen Studierenden in einem tollen Restaurant mit studentischen Preisen sowie durch das Kennenlernessen im Restaurant Kawaleria. Beide Essen waren geprägt von regen Gesprächen über das Leben und Studieren in Krakau und Leipzig. Neben den im Voraus geplanten Programmpunkten haben wir uns in manchmal größeren, manchmal kleineren Gruppen aufgemacht, die Kulturstadt Krakau zu entdecken. Dazu gehörte beispielsweise die Besichtigung der Marienkirche. Diese Basilica minor ist ein beeindruckendes Zeugnis gotischer Architektur und mit ihren zahlreichen Ausschmückungen sowie dem imponierenden Hochaltar besonders erstaunlich. Wir schätzten uns glücklich, pünktlich zur Mittagsstunde die Öffnung des prächtigen Altars miterleben zu dürfen. Zusätzlich zum Besuch anderer Kirchen und des jüdischen Viertels mit der alten Synagoge nutzten wir den letzten Tag der Reise, um die Fabrik des Oskar Schindler zu besuchen und das bedrückende Bild der damaligen Zeit und der Geschehnisse vor Ort wahrzunehmen. Als Abschluss der Woche verbrachten wir den letzten Abend als Leipziger Gruppe in einem Restaurant und anschließend in einer Bar, in der wir begleitet von Kartenspielen und Gesprächen die Woche ausklingen ließen. Zuvor haben wir uns mit unseren polnischen Kolleg:innen bei einem vorerst letzten gemeinsamen Essen über die Erlebnisse der vergangenen Woche ausgetauscht. Nach intensiven und erfahrungsreichen Tagen fuhren wir wieder zurück nach Leipzig. An dieser Stelle möchten wir voller Freude an die verschiedenen Referent:innen der Krakauer Sommerschule 2023 abgeben, die ihre Projekte und Forschungsergebnisse im Folgenden präsentieren werden.
- Landmann, Kaja; Merz, Franziska; Mennicke, Jörn. 2024. Einleitung. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Zu den Problemen der Reflexivität aus der deutsch-polnischen Perspektive
Zu den Problemen der Reflexivität aus der deutsch-polnischen Perspektive[^* Dieser Beitrag entstand im Zusammenhang der 2023 abgegebenen Bachelorarbeit, die sich dem Thema der Reflexivität im Deutschen und im Polnischen widmet.]
Das Thema Reflexivität ist ein äußerst interessantes Phänomen in germanischen Sprachen, insbesondere im Deutschen, auf das ich mich in meiner Bachelorarbeit konzentrierte. Diese Relation zwischen dem Reflexivpronomen und dem Reflexivverb wird von einigen Philologen und Sprachwissenschaftlern ganz unterschiedlich ausgelegt. In meinem Forschungsvorhaben verwendete ich unter anderem zwei Publikationen, von denen ich den Gedankengang, die Argumentation und die Nomenklatur übernahm: Das ist einerseits die ‚Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht‘ von Gerhard Helbig und Joachim Buscha (Helbig / Buscha 1987a), andererseits bediente ich mich ebenfalls der ‚Übungsgrammatik Deutsch‘ derselben Autoren (Helbig / Buscha 1987b).
Mein Beitrag ist folgendermaßen gegliedert, die Abschnitte entsprechen denjenigen des Vortrags:
- die Zielsetzung,
- die Grundzüge der reflexiven und reziproken Relation in der Theorie von Gerhard Helbig und Joachim Buscha,
- die Fragen, mit denen ich mich befasste,
- die Ergebnisse der von mir konzipierten und konstruierten Umfrage,
- Schlussfolgerungen.
Die Zielsetzung
Ich habe mir als Ziel für meine Bachelorarbeit vorgenommen, die Fehlerquelle beim Einsatz des Reflexivpronomens im Deutschen und im Polnischen durch angehende Germanisten zu bestimmen und zu analysieren. Ich wollte ergründen, warum meinen polnischen Mitstudenten so viele Fehler im Bereich reflexiver Verben unterlaufen.
Ich wollte untersuchen, warum die Verbindung des Reflexivpronomens mit dem Verb so viele Probleme in beiden Sprachen bereitet. Einerseits gibt es zahlreiche Beispiele für Verben, die sowohl im Deutschen als auch im Polnischen immer reflexiv verwendet werden (z. B. sich schämen ,wstydzić się’ oder sich beeilen ,spieszyć się’). Dann findet man ebenfalls deutsche Verben, die reflexiv gebraucht werden, deren polnische Entsprechungen aber kein Reflexivpronomen zulassen (z. B. sich räuspern ,chrząknąć’ oder sich erholen ,odpoczywać’). Letztendlich sieht es jedoch umgekehrt aus: Den deutschen Verben, die niemals reflexiv zu gebrauchen sind, werden polnische Verben gegenübergestellt, die stets ein Reflexivpronomen bei sich haben müssen (z. B. lernen ,uczyć się‘ oder heißen ,nazywać się’).
Die Grundzüge der reflexiven und reziproken Relation in der Theorie von Gerhard Helbig und Joachim Buscha
Meine Forschungsmethodik basiert auf zwei Diagrammen, die ich selbst zeichnete. Hier ist das erste Diagramm zu sehen, das uns reflexive Verben im weiteren Sinne (nach der Auffassung von Helbig und Buscha) näherbringt:

Abbildung 1: Aufbau der Gruppe reflexiver Verben bei Helbig / Buscha [eigene Abbildung].
In dem Diagramm lässt sich eine Unterteilung in reflexive Verben im engeren Sinne und reflexive Konstruktionen bemerken. Zu den Ersteren werden Verben gerechnet, welche immer das Reflexivpronomen bei sich haben müssen (z. B. sich bedanken oder sich erkälten). Von Bedeutung ist ebenfalls, dass dieses Reflexivpronomen nicht durch ein vollsemantisches Wort mit Objektcharakter ersetzt werden kann. Da haben wir die reflexiven Konstruktionen: Das sind im Großen und Ganzen die Verben, die sowohl mit dem Reflexivpronomen als auch mit einem Akkusativ- bzw. Dativobjekt vorkommen können (z. B. kämmen oder schaden).
Im Rahmen reflexiver Verben im engeren Sinne spricht man ebenfalls von den sog. ‚Reflexiva tantum‘. Damit sind Verben gemeint, welche ausschließlich mit dem Reflexivpronomen auftreten (z. B. sich begnügen oder sich verbitten). Parallel zu den Reflexiva tantum existieren auch reflexive Verbvarianten, also Verben, die normalerweise mit dem Reflexivpronomen vorkommen, aber auch nicht-reflexive Bedeutungsvarianten aufweisen (z. B. sich auf jemanden verlassen vs. jemanden verlassen). Interessant sind ebenfalls solche reflexiven Verbvarianten, bei denen das Reflexivpronomen fakultativ ist. Das wirkt sich aber auf die Perfektbildung des jeweiligen Verbs aus, was sich am Beispiel von festfahren beobachten lässt (Der Wagen hat sich im Schnee festgefahren und Der Wagen ist im Schnee festgefahren).
Analog sieht die Einteilung reziproker Verben (im weiteren Sinne) aus:

Abbildung 2: Aufbau der Gruppe reziproker Verben bei Helbig / Buscha [eigene Abbildung].
Hier haben es die Lesenden mit einer ähnlichen Unterteilung zu tun: Jetzt unterscheidet man nämlich zwischen reziproken Verben im engeren Sinne und reziproken Konstruktionen. Die Ersteren zeichnen sich dadurch aus, dass sie schon in ihrer Grundbedeutung reziprok sind (z. B. sich anfreunden). Daneben befinden sich reziproke Konstruktionen, die im Plural homonym sind: Abhängig vom Kontext kann es sich um ein reflexives Verhältnis handeln oder um ein reziprokes, bei dem ein wechselseitiger Bezug gezeigt wird (z. B. sich kämmen). Analog wie bei den reflexiven Verben gibt es auch hier eine Unterkategorie, die als ‚Reziproka tantum‘ bezeichnet wird. Das sind Verben, die ausschließlich mit dem Reflexivpronomen vorkommen (z. B. sich überwerfen). Daneben sind die reziproken Verbvarianten zu sehen, die gewöhnlich mit dem Reflexivpronomen gebraucht werden können, aber auch nicht-reflexive Varianten zulassen (z. B. sich vertragen vs. etwas vertragen).
Eine ebenfalls interessante grammatische Erscheinung ist auf jeden Fall das sogenannte ‚Zustandsreflexiv‘. Es handelt sich dabei um Formen, die aus dem Hilfsverb sein und Partizip II zusammengesetzt sind und oft mit dem Zustandspassiv verwechselt werden. Eine gewisse Ähnlichkeit ist hier bemerkbar, weil solche Formen auch im Polnischen üblich sind (wie z. B. ich habe mich verspätet ‚ja spóźniłem się‘ = ich bin verspätet ‚ja jestem spóźniony‘).
Meine Aufmerksamkeit erweckte auch das Verb sich interessieren, das sich stets mit derselben Präposition für verbindet. Wird diese Verbkonstruktion jedoch umgeformt und in ein Zustandsreflexiv umgewandelt, fällt auf, dass jetzt die Präposition an gebraucht werden soll. Im Polnischen wird in den beiden Fällen derselbe Kasus verwendet (‚narzędnik‘) und keine Präposition findet hier Anwendung (ich habe mich für Hunde interessiert ,ja interesowałem się psami’ = ich bin an Hunden interessiert ,ja jestem zainteresowany psami’).
Die Fragen, mit denen ich mich befasste
- Worin liegt die eigentliche Ursache der Lernschwierigkeiten beim Gebrauch des Reflexivpronomens?
- Kann das Vorwissen über das Polnische eine Hilfe beim Erlernen der Gebrauchsregeln des Reflexivpronomens sein?
- Kann man aus den unterlaufenen Fehlern die entsprechenden Schlüsse für die Zukunft ziehen?
Die Ergebnisse der von mir konzipierten und konstruierten Umfrage
An dieser Stelle analysiere ich die ausgewählten Ergebnisse der Umfrage, die ich selbst konzipierte und unter meinen Mitstudierenden durchführte.
Dabei handelt es sich um eine repräsentative Befragung, an der genau 20 Studierende des dritten Studienjahres, die die Fachkombination Germanistik und Englisch belegen, teilnahmen. Die Umfrage beinhaltete 25 Satzbeispiele, wobei jeweils eine Lücke ausgefüllt werden sollte. Jede Leerstelle war entweder mit der richtigen Form des Reflexivpronomens oder mit einem Strich zu vervollständigen. Ziel der unternommenen Befragung war es, das Allgemeinwissen der Studierenden über die korrekte Verwendung des Reflexivpronomens zu überprüfen und aufzuzeigen, in welchen Kontexten Fehler auftreten können. Die in dieser Umfrage vorhandenen Sätze kommen teilweise aus der ‚Deutschen Übungsgrammatik‘ von Gerhard Helbig und Joachim Buscha, wobei manche von ihnen aus meiner Feder stammen. Bei der Auswahl einiger Verbbeispiele bediente ich mich ebenfalls der ,Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego‘ von Jan Czochralski und der ,Zwięzła gramatyka języka niemieckiego‘, die von Wanda Dewitzowa und Barbara Płaczkowska (Dewitzowa / Płaczkowska 1996) verfasst wurde.
Zu dem Satz Seine Tochter klagte ___ ständig über zu viele Hausaufgaben wurde von 55 % der Befragten (11 von 20) die richtige Antwort erteilt, also blieb die Lücke leer. Eine Person hielt die falsche Form mir für richtig. Acht Befragte begingen denjenigen Fehler, der vorherzusehen war: Sie trugen hier sich ein. Das kann daran liegen, dass die polnische Entsprechung des Verbs klagen ‚skarżyć się‘ lautet: Da wird der Gebrauch des Reflexivpronomens verlangt. Die Befragten können diese Phrase auch mit sich beklagen verwechselt haben.
Das Beispiel Du hast dich an dem Kirschkern verschluckt wurde zu Recht mit der Form dich vervollständigt. Für diese Lösung entschied sich die Mehrheit der Umfrageteilnehmer (16 von 20). Kannte jemand von den Befragten die Phrase sich an etwas verschlucken nicht, so mag er / sie am Kontext (Kirschkern) erkannt haben, dass es sich dabei um die Situation handelt, in der etwas beim Schlucken (ungewollt) in die Luftröhre gelangt. Auch die polnische Übersetzung – (za)krztusić się, (za)dławić się – kann den Studierenden zur richtigen Lösung verholfen haben. Der Rest der Befragten ließ die Lücke leer, was nicht richtig war.
Der Satz Du hast ___ den Kirschkern verschluckt bereitete den Befragten keine größeren Schwierigkeiten. Er wurde erneut überwiegend (70 % der Studierenden) korrekt ergänzt, also mit einem Strich bzw. die Lücke wurde leer gelassen. In der Bedeutung, wo etwas durch Schlucken (gewollt) in den Magen gelangt, ist verschlucken nicht-reflexiv zu verwenden. Die polnische Entsprechung dieses Verbs (,połykać‘) verlangt ebenfalls kein Reflexivpronomen.
Das Satzbeispiel Sie vergingen sich an dieser wehrlosen Frau scheint manche Befragten in Verlegenheit gebracht zu haben: Genau die Hälfte der Umfrageteilnehmer vervollständigte den Satz richtig – mit dem Reflexivpronomen sich. Die Bedeutung des Verbs vergehen, an die in dem Satz angeknüpft wird, muss nicht allen Studierenden bekannt gewesen sein. In der reflexiven Form bedeutet es ‚jemandem Gewalt antun‘. Warum trug also die Hälfte der Befragten richtigerweise das Reflexivpronomen ein? Es ist schon möglich, dass manche hier intuitiv handelten, während die anderen die Bedeutung einfach in einem Wörterbuch nachschlugen. Die andere Hälfte (10 von 20) entschied sich aber für einen Strich, also für die nicht-reflexive Variante. Dabei lässt sich die Hypothese aufstellen, nach der die Studenten dieses Verb mit der Phrase an jemandem vorbeigehen verwechselt haben können.
Schlussfolgerungen
Einerseits könnten solche falschen Analogien dem Einfluss des Polnischen zugeschrieben werden. Durch den Gebrauch dieser Sprache beeinflusst, trifft der Sprachbenutzer oft die Entscheidung, dort das Reflexivpronomen zu gebrauchen, wo es im Deutschen auf keinen Fall stehen darf.
Einige Fehler werden auch deswegen begangen, weil die deutsche Sprache stets verlangt, das Reflexivpronomen an die jeweilige Person anzupassen, woran man sich als Deutschlerner immer erinnern muss. Im Polnischen wird das Reflexivpronomen się überhaupt nicht konjugiert, was auch irreführend sein kann, wenn man einen Satz auf Deutsch formuliert.
Viele Deutschlernende unterlassen es häufig, das Reflexivpronomen zu gebrauchen oder verwenden es unnötigerweise. Was irreleitend sein kann, ist sicherlich auch die frappierende Bedeutungsähnlichkeit mancher Verbpaare.
Das Wissen über die beim Ausfüllen der Umfrage unterlaufenen Fehler könnte vielen Deutschlernenden dabei helfen, künftigen Missverständnissen besser vorbeugen zu können. Jeder, der das Deutsche in einem anständigen Ausmaß beherrschen möchte, sollte sich also die sprachlichen Unterschiede zwischen dem deutschen und dem polnischen Gebrauch mancher Verben merken.
Immer wenn man Zweifel hegt und nicht genau weiß, ob das jeweilige Verb reflexiv oder nicht-reflexiv verwendet wird, sollte man sich eines zuverlässigen Wörterbuches bedienen, um das Wort nachzuschlagen. Das häufige Zurateziehen von Nachschlagewerken kann nämlich unser grammatisches Wissen verfeinern und zum dauerhafteren Erlernen neuer Verben beitragen.
Das aus solchen Fehlern erlangte Wissen kann auch bei der Gestaltung neuer, besser ausgestatteter Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache wesentlich helfen.
Primärliteratur
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim. 1987a. Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.
- Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim. 1987b. Deutsche Übungsgrammatik. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.
Sekundärliteratur
- Engel, Ulrich. 1996. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Kunkel-Razum, Kathrin (u. a.). 2009. Duden: die Grammatik: unentbehrlich für richtiges Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
- Czochralski, Jan. 1994. Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
- Weinrich, Harald. 1993. Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Dudenverlag.
- Dewitzowa, Wanda / Płaczkowska, Barbara. 1996. Zwięzła gramatyka języka niemieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Szeląg, Aleksander. 2024. Zu den Problemen der Reflexivität aus der deutsch-polnischen Perspektive. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Nichtverstehen kurzgefasst
Nichtverstehen kurzgefasst – Eine korpuslinguistische Untersuchung der Funktionen des Nichtverstehensmarkers hä in Interaktionen[^* Der vorliegende Beitrag ist ein Artikel zu der im Wintersemester 2021 / 22 verfassten Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Formen der Verständnissicherung in Interaktion“ unter der Leitung von Dr. Robert Mroczynski.]
Was bedeutet eigentlich hä? Der vorliegende Artikel widmet sich einem Teil dieser in der linguistischen Forschung bisher noch nicht umfassend beantworteten Frage, indem er die Ergebnisse einer Analyse von 1233 hä-Tokens der Schreibweisen hä, häh und he im Forschungs- und Lehrkorpus für gesprochenes Deutsch (FOLK) zusammenfasst, die auf die Verwendung in Nichtverstehenskontexten untersucht wurden.[^1 Die Inhalte dieses Artikels beruhen auf einer im Rahmen des von Dr. Robert Mroczynski geleiteten Seminars „Formen der Verständnissicherung in Interaktion“ im Wintersemester 2021 / 22 verfassten Hausarbeit an der Universität Leipzig. Ich danke Herrn Dr. Mroczynski für seine Anregungen, die ebenso wie die Inhalte des Seminars in die Ausarbeitung eingeflossen sind. Dies betrifft vor allem den Aufbau der Arbeit, die Kriterien zur Beschreibung der Gesprächsbeispiele sowie seine Vorschläge zur Kategorisierung. Die in der Untersuchung verwendeten Daten stammen aus der am 25.07.2022 zuletzt aktualisierten Version des FOLK, welche in den Jahren 2003 bis 2021 aufgezeichnete 336 Stunden Audioaufnahmen enthält. Die 1233 Vorkommen (Schreibweisen: 998 x hä, 35 x häh und 200 x he) wurden mithilfe der Tokensuche gefunden. Von der Schreibweise he wurden nur die ersten 200 von 2707 Treffern analysiert, da die manuelle Selektion der Treffer nach Nichtverstehensmarkern sehr arbeitsaufwändig und in diesem Fall wenig lohnenswert ist. Die meisten Treffer für he sind Interjektionen, Vergewisserungssignale und Lachen. Nur bei 6 dieser 200 Treffer dient he tatsächlich der Anzeige von Nichtverstehen. Bei der Analyse der gesamten 2707 Treffer ist entsprechend mit etwa 81 Nichtverstehensmarkern zu rechnen.] Interessant ist dabei, wie Gesprächsteilnehmer[^2 Im Folgenden steht die maskuline Genusform stellvertretend für alle Geschlechtsidentitäten.] unterscheiden können, welche Funktion die implizite Nichtverstehensmanifestation hä in der jeweiligen Situation hat (vgl. Deppermann / Schmitt 2008: 240).
Hä kann vieles bedeuten: am Ende einer Frage, wird es manchmal als Vergewisserungssignal wie in des hoffen wa doch hä (IDS 1) oder als Reparatursignal, wie in aber is nur frei häh freundschaftsspiel oder (IDS 2) gebraucht. Im Rahmen der manuellen Selektion wurden diese und weitere Vorkommen der Partikel aussortiert, die nicht der Anzeige von Nichtverstehen dienen. Übrig blieben 597 von 1233 Treffern (566 x hä, 25 x häh, 6 x he), welche anschließend anhand folgender Kriterien kategorisiert wurden:
- Form des Ausdrucks,
- struktureller Kontext,
- prosodische Realisierung,
- Bezugsgegenstand,
- Art des epistemischen Ungleichgewichts,
- Kommunikationsform und
- Adressat.
Als Ergebnis der qualitativen Analyse der Partikel hä als Nichtverstehensmarker konnten insgesamt sechs interaktionale Funktionen festgestellt werden. Bei den letzten drei Funktionen ist die Zuordnung zur Nichtverstehensanzeige in der Interaktion nicht eindeutig, da entweder kein Nichtverstehen im eigentlichen Sinne vorliegt, wie beim Dissens (4), sie nicht eindeutig einer Interaktion zuzuordnen sind, wie das eigene Nichtverstehen (5), oder das Nichtverstehen nicht in der Interaktion stattfindet, zu der das betrachtete Datenmaterial vorliegt, wie beim Nichtverstehen in Erzählungen (6). All diese Funktionen haben gemeinsam, dass bei ihnen keine Fremdreparatur intendiert wird, da die hä-Äußernden vermuten, einen Wissensvorsprung zu haben. Da es sich jedoch um sehr interessante sowie frequente Verwendungen handelt und das Ziel der Untersuchung war, die sprachliche Realität möglichst genau und umfassend zu beschreiben, wurden die Kategorien dennoch aufgenommen. Inklusive dieser Grenzfälle wurden die folgenden Nichtverstehensarten als Wirkungsbereiche von hä identifiziert:
- Nichtverstehen durch eine Störung der Wahrnehmung,
- Nicht-Folgen-Können des Gesprächsverlaufs,
- Nichtverstehen durch fehlendes Wissen,
- Unverständnis oder Dissens gegenüber Handlungen, Äußerungen oder Verhalten,
- eigenes Nichtwissen oder Nichtverstehen und
- Nichtverstehen in Erzählungen.
Nichtverstehen durch eine Störung der Wahrnehmung
Im FOLK werden zwei Arten des Nichtverstehens durch Störungen des Wahrnehmungskanals mit hä angezeigt: akustisches Nichtverstehen und Nicht-Lesen-Können. Für die letztere Ausprägung sind nur drei Vorkommen zu verzeichnen, daher beschränkt sich dessen Beschreibung hier darauf, dass sich die Aufmerksamkeit der Gesprächsteilnehmenden vorübergehend auf einen unleserlichen Text richtet, über den kommuniziert wird. 133 der 136 Vorkommen sind dem akustischen Nichtverstehen zuzuordnen, welches von Margret Selting bereits 1987 beschrieben wurde (vgl. 132-134). Es tritt auf, wenn die akustische Qualität einer Äußerung sehr niedrig ist, der Gesprächspartner abgelenkt ist, oder externe Störgeräusche die akustische Wahrnehmung behindern, wodurch keine geeignete Verstehenshypothese gebildet werden kann (vgl. Myers 2014: 330; Selting 1987: 132; Bublitz 2009: 35-45). Hä wird daraufhin in den meisten Beispielen in einem eigenen Turn in zweiter Position mit kurzer, steigender Intonation realisiert und führt zum Abbruch des aktuellen Gesprächsthemas zugunsten einer fremdinitiierten Fremdreparatur (vgl. Bauer 2020: 378). Das Reparans besteht bei dieser Nichtverstehensart typischerweise in einer wortwörtlichen, deutlichen, entschleunigten sowie durch Pausen unterbrochenen Wiederholung des Reparandums (vgl. Selting 1987: 132; Bauer 2020: 378). Auf die gelungene Bildung einer Hypothese folgt die Verstehensanzeige des Gesprächspartners, welche häufig mithilfe eines Erkenntnisprozessmarkers wie Ach so! erfolgt (vgl. Imo 2009: 57, 63). Durch eine logische Anschlusshandlung wird die Schließung der Reparatursequenz besiegelt: die Gesprächsteilnehmer kehren zum vorherigen Thema zurück (vgl. Schäflein-Armbruster 1994: 502, Deppermann 2008: 231).
Nicht-Folgen-Können des Gesprächsverlaufs
Die elf Vorkommen dieser kleinen Kategorie entstammen fast ausschließlich informellen Spielinteraktionen, in welchen Regeln oder Tätigkeitsabläufe erklärt werden. Dabei besteht eine Wissensasymmetrie. Besonders häufig treten sie im FOLK in Aufnahmen mit dem Elizitierungsverfahren Maptask auf.[^3 Elizitierungsverfahren sind Verfahren zur Gewinnung von Sprachdaten mithilfe konstruierter Aufgaben, die die Gesprächsteilnehmer dazu anregen sollen, bestimmte sprachliche Strukturen zu produzieren (vgl. Kauschke 2012: 13). Maptask dient der Aufzeichnung von Spielinteraktionen. Zwei Spieler erhalten dazu jeweils eine Karte, auf der Objekte oder Personen dargestellt sind. Auf einer der Karten ist ein Weg eingezeichnet. Der Spieler mit dieser Karte, muss den Weg so beschreiben, dass der andere Gesprächsteilnehmer diesen auf seiner Karte einzeichnen kann. Dabei dürfen sich die Spieler ihre Karten nicht zeigen und sich nicht ansehen. Der beschreibende Partner hat im Gegensatz zum Hörer folglich einen enormen Wissensvorsprung. Dadurch kommt es gelegentlich vor, dass die zeichnende Person ihrem Gegenüber nicht folgen kann. Die kontinuierliche Verständnissicherung und -dokumentation ermöglicht die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe und wird daher intensiv betrieben.] Das Nichtverstehen besteht darin, dass die Menge und Äußerungsgeschwindigkeit der durch den Sprecher gegebenen neuen Informationen die Verarbeitungskapazitäten des Hörers übersteigen. Die Nichtverstehensanzeige mit hä erfolgt unmittelbar, wenn nötig auch mitten im Partnerturn, wenn der Hörer vermutet, dass der Erfolg des Gespräches ohne die ihm entgangenen Informationen nicht mehr gewährleistet ist. Durch eine hohe oder steigende Realisierung wird der Dringlichkeit der Reparatur Ausdruck verliehen. Entsprechende Reparaturen sind im Sinne einer gemeinsamen Verstehensarbeit oft interaktiv gestaltet (vgl. Bublitz 2001: 1330-1332, Bremer 1997). Die entgangenen Informationen werden in kleineren Abschnitten präsentiert, zu denen jeweils eine Verstehensbestätigung des Hörers eingefordert wird, bevor der nächste Teil folgt. Dieses Vorgehen sichert das Verstehen und somit langfristig den Spielerfolg.
Nichtverstehen durch fehlendes Wissen
Mit 110 Treffern handelt es sich beim Nichtverstehen durch fehlendes Wissen um die drittgrößte Gruppe von hä zur Anzeige von Nichtverstehen. Bublitz nennt bereits 2001 Wort-, Satz- und Äußerungsbedeutung als Wirkungsbereiche der Verstehensdokumentation (vgl. 1332-1335). Selting unterscheidet zwischen Problemen bei der Referenzherstellung und der Bedeutung (vgl. 1987: 234-239). Die Untersuchung des FOLK hat jedoch ergeben, dass die Bedeutung von Einzelwörtern eine eher marginale Rolle spielt. 89 der 110 Vorkommen sind dem Erfragen von Hintergrundinformationen zum besseren Verständnis zuzuordnen. Deppermann schreibt dazu, dass sich hä in zweiter Position auf den gesamten Turn bezieht (vgl. 2008: 241). Die meisten anderen Beispiele zeigen Probleme bei der Referenzherstellung in der aktuellen Gesprächssituation, hier mit ‚Sinn‘ bezeichnet, wohingegen der Begriff ‚Bedeutung‘ als überzeitlich konstant verstanden wird (vgl. Bublitz 2009: 39).
Die Äußerung von hä geht in dieser Funktion mit der Anzeige eines eigenen Wissensdefizites und der Erwartung, dass der Gesprächspartner in der Lage ist, dieses zu beheben, einher. In vielen der Beispiele dieser Kategorie werden zuerst Reparaturversuche für andere Nichtverstehensarten eingeleitet, bis der Gesprächspartner im Ausschlussverfahren erkennt, dass das Nichtverstehen durch fehlendes Wissen ausgelöst wird. Möglicherweise ist dieses Reparaturverhalten darauf zurückzuführen, dass der Sprecher seine Aussage bereits dem vermuteten Vorwissen des Hörers entsprechend gestaltet (recipient design) und ein Wissensdefizit daher als unwahrscheinlich ansieht (vgl. Deppermann 2013: 3).
Unverständnis oder Dissens gegenüber Handlungen, Äußerungen oder Verhalten
Mit 40,7 Prozent aller Treffer von hä als Nichtverstehensmarker ist hä als Reaktion auf Äußerungen oder Handlungen, deren Grund der Rezipient nicht versteht oder die er ablehnt die am häufigsten beobachtete Funktion. Selting beschreibt diese Kategorie als Widerspruch zu einer Erwartung (vgl. 1987: 139). Die unverständliche Handlung kann entweder Teil der aktuellen Gesprächssituation sein oder außerhalb dieser liegen. Hä wird geäußert, wenn der Sprecher eine Handlung oder Äußerung anders oder nicht getätigt hätte. Dadurch wird dieser ihre wahrscheinliche Korrektheit abgesprochen. Unverständnis für Handlungen und Dissens bilden Pole eines Spektrums, auf dem die verschiedenen Beispiele entsprechend des Wissenslevels des Äußernden angeordnet werden können. Während beim Unverständnis auch die Möglichkeit eines eigenen Wissensdefizites in Betracht gezogen wird und eine Fremdkorrektur erfolgen kann, ist der Sprecher sich beim Dissens sicher, einen Wissensvorsprung zu haben, was oft zur Revidierung der vom Gesprächspartner zuvor getätigten Äußerung führt. Da in diesem Fall oberflächlich ein Verständnisdefizit angezeigt wird, während der andere Gesprächsteilnehmer implizit zur Selbstreparatur aufgefordert wird, kann der Dissensanzeige mit hä eine gesichtswahrende Funktion zugeschrieben werden. Es handelt sich also um eine höfliche Form des Widerspruchs, welche es ermöglicht, das Selbstkonzept des anderen Gesprächsteilnehmers nicht direkt anzugreifen und somit die Chancen auf eine Weiterführung des Gespräches ohne Schaden an der Beziehung der Teilnehmer zu erhöhen (vgl. Bauer 2020: 413f.; Deppermann 2008: 252). Bei der Anzeige von Dissens kann davon ausgegangen werden, dass kein Verstehensproblem besteht, da die Bewertung einer Handlung oder Aussage des Gegenübers als falsch voraussetzt, dass diese mit den zu ihr führenden Beweggründen verstanden wurden. Es handelt sich also eher um eine Wertung des zuvor Gesagten, die Erstaunen oder Ablehnung ausdrückt. Da die inneren Vorgänge der Sprecher in den Gesprächsdaten nicht ersichtlich sind, ist die Verortung auf dem beschriebenen Spektrum jedoch oft nicht möglich, daher wurde entschieden, alle Vorkommen zu zählen. Anhand des Bezugsgegenstandes der Nichtverstehensanzeige kann diese Kategorie weiter in:
- Nichtverstehen von Handlungen oder Verhalten eines Gesprächsteilnehmers,
- Nichtverstehen des Grundes einer Äußerung und
- kollektives Nichtverstehen
unterteilt werden.
Beim Nichtverstehen des Grundes einer Äußerung eines Gesprächsteilnehmers (b) werden als allgemein bekannt angenommene Wissensbestände vernachlässigt, oder die Grice‘schen Konversationsmaximen Quantität, Qualität, Relevanz und Stil verletzt (vgl. Grice 1975: 45f.).
Die Teilkategorie c) kollektives Nichtverstehen bezieht sich auf Handlungen, Verhalten oder Äußerungen einer Person, die dem Gespräch nicht beiwohnt, sondern über die retrospektiv gesprochen wird. Meist bewertet der Sprecher ein bestimmtes Verhalten einer dritten Person als unverständlich, woraufhin die Hörer mit hä anzeigen, dass sie die beschriebene Handlung ebenfalls als rational nicht verständlich klassifizieren. Sie wird damit abgewertet, wobei dem Äußernden gleichzeitig zugesprochen wird, im Recht und rational überlegen zu sein. Günthner bezeichnet diese Form von Erzählungen, in denen die Rezipienten zur Beteiligung an der Entrüstung über das Verhalten einer nicht anwesenden Person angeregt werden, als „Beschwerdegeschichten“ (Günthner 2000: 203; vgl. Günthner 2000: 203, 223f.). Die Partikel hä kann nach Günthners Terminologie den „Entrüstungsausrufe[n]“ (2000: 249) zugeordnet werden. Sie kann in diesem Kontext die Funktion eines Hörersignals ausüben. In diesem Fall wird das Rederecht nicht an den hä-Äußernden übergeben (vgl. Gülich / Mondada 2008: 5f.). In einigen Beispielen führt sie jedoch zum Sprecherwechsel und ermöglicht, wie ein Diskursmarker, die Einleitung längerer Redebeiträge, auf welche der Gesprächspartner reagiert (vgl. Gohl / Günthner 1999: 57). Auf hä folgende Kommentare oder Fragen zum Erzählten werden möglicherweise als relevanter betrachtet, da formell Nichtverstehen angezeigt wurde.
Einige Gesprächsbeispiele in dieser Kategorie stammen nicht aus Beschwerdegeschichten, sondern aus Erzählungen von einem selbst erlebten unerwarteten Ereignis oder einem Zufall. Der Hörer zeigt mit der Partikel an, dass er sich in die Situation des Erzählenden hineinversetzen kann, beziehungsweise diese besonders positiv oder überraschend findet. Es wird ein Gemeinschaftsgefühl, ein kollektives Nichtverstehen erzeugt. Ein Beispiel dafür ist hä witzig (IDS 3).
Eigenes Nichtwissen oder Nichtverstehen
In dieser Gruppe, die lediglich 2,6 Prozent der Treffer ausmacht, wird mit hä ein innerer Vorgang des Nichtverstehens eigener Handlungen, einer Situation, in der man sich befindet, beziehungsweise das Nichtverstehen durch fehlendes Wissen oder Probleme beim Erinnern markiert. In fünf der 16 Fälle bezieht es sich auf eine lokale Angabe.
Das Selbstgespräch bildet den Schnittpunkt zwischen Sprache und Denken. Es wird ein innerer Vorgang verbalisiert, ohne dass eine Antwort des Gesprächspartners erwartet wird, die in der Regel auch nicht erfolgt. Das zeigt, dass es sich auf den ersten Blick nicht um ein interaktionales Phänomen handelt.[^4 In der Literaturwissenschaft gibt es Ansätze, die das Selbstgespräch als Dialog im Inneren mit verschiedenen Teilen der eigenen Identität betrachten (vgl. Orth 2000: 2). Orth bezeichnet es entsprechend als „dialogisierten Monolog“ (Orth 2000: 173). Die linguistische Forschung im deutschsprachigen Raum schließt Selbstgespräche aufgrund der nicht als reliabel angesehenen Fixierungsmöglichkeiten gedanklicher Gespräche als Untersuchungsgegenstand aus, erkennt jedoch deren Dialogcharakter an (vgl. Orth 2000: 14-15). Zu verbalisierten Selbstgesprächen konnte keine geeignete linguistische Forschungsliteratur gefunden werden.] Da hä zur Anzeige des eigenen Nichtwissens vor allem in informellen Kontexten vorkommt, kann vermutet werden, dass es der Erklärung einer für den anderen eventuell unverständlichen Handlung dient, oder der Sprecher das Bedürfnis hat, seine Gedanken mit der vertrauten Person zu teilen. Im Turn projiziert hä als Diskursmarker meist auf eine präzisierende Frage. Nach etwas Reflexionszeit wird auch die Erkenntnis laut geäußert. Die meisten Treffer dieser Gruppe sind gedehnt und steigend bei hohem Stimmeinsatz, einige auch gehaucht oder kurz realisiert.
Nichtverstehen in Erzählungen
13,57 Prozent der Vorkommen von hä als Nichtverstehensmarker entfallen auf die Partikel hä in Erzählungen, in denen sie die Beschreibung eines vergangenen Nichtverstehens, Unverständnisses oder Nichtwissens ersetzt. Da das Nichtverstehen auf einer Metaebene – in der erzählten Welt – erfolgt, wird in der aktuellen Interaktion keine Reparatur initiiert. Helga Kotthoff betont jedoch die Interaktionalität von Erzählungen, die unter anderem durch recipient design und die gemeinsame Entwicklung der Geschichte mit den Zuhörern gekennzeichnet ist (vgl. 2020:415f.).
Das Nichtverstehen in Erzählungen kann sowohl beim Sprecher selbst als auch bei einer Person, über die erzählt wird, vorgelegen haben. Daher können 1) selbstreferenzielle und 2) fremdbezogene hä-Partikeln in Narrationen unterschieden werden. Anhand des Verbs kann zwischen expliziter Redewiedergabe, z. B.: (dann) [hab ich gesagt] hä (IDS 4), oder implizitem Nichtverstehen, z. B.: [un ich dacht mir] hä (IDS 5), unterschieden werden. Ein besonderer Fall der expliziten Redewiedergabe ist das geschriebene hä, z. B.: ich schreib so °hh hä °hh [wer is das] (IDS 6), das im FOLK jedoch nur einmal vorkommt. Implizite Formulierungen erinnern an Selbstgespräche, in denen das hä nur gedacht wurde. Sie treten meist selbstbezogen auf, da ein Sprecher die Gedanken einer anderen Person nicht lesen kann. Explizite Formulierungen suggerieren, dass das Nichtverstehen in der Vergangenheit tatsächlich mit hä verbalisiert wurde, was anhand der Daten nicht überprüfbar ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass hä wie ein fiktives direktes Zitat funktioniert. Falsches „Zitieren“ wird von den Hörern in dieser Verwendung in der Regel nicht hinterfragt oder sanktioniert. Von der Funktion als fiktives Zitat (1 und 2) ist die stellvertretende hä-Partikel (3) abzugrenzen. Bei dieser Funktion kann hä eine längere Beschreibung der Nichtverstehenssituation und der entsprechenden Reflexionen zur Problemlösung ersetzen. Somit ist hä deutlich sprachökonomischer als die Formulierung eines ganzen Satzes. In neun von vierzehn Fällen steht die Partikel als Stellvertreter in einer so hä-Konstruktion und ohne Verbum dicendi.[^5 Verba dicendi sind Verben, die die Art einer Äußerung konkretisieren oder ein Zitat einführen, z. B.: sagen, meinen, fragen und schreiben (vgl. Auer 2006: 297).] Folglich ist keine Zuordnung zu den anderen Kategorien möglich.
Die 79 Vorkommen von hä in Erzählungen verteilen sich wie folgt auf die Kategorien:
-
selbstreferenzielle
hä-Partikel in Erzählungen
-
explizite, selbstreferenzielle
hä-Partikel:
17 Vorkommen -
implizite, selbstreferenzielle
hä-Partikel:
31 Vorkommen
-
explizite, selbstreferenzielle
hä-Partikel:
-
explizite, fremdbezogene
hä-Partikel in Erzählungen:
17 Vorkommen -
stellvertretende
hä-Partikel:
14 Vorkommen
Anhand der Erklärungen des Sprechers kann in einigen Fällen rekonstruiert werden, welche der bereits beschriebenen Arten des Nichtverstehens erzählt wird. Besonders häufig bezieht sich hä in Erzählungen auf Unverständnis für Handlungen oder Äußerungen sowie auf Nichtverstehen durch fehlendes Wissen. Das liegt vermutlich daran, dass Sprecher solche tiefgreifenden Verstehensprobleme erzählenswerter finden als beispielsweise akustisches Nichtverstehen.
In 42 Prozent der Vorkommen in Erzählungen steht hä in der Konstruktion so hä. Besonders häufig tritt so gemeinsam mit expliziten, selbstreferenziellen hä-Partikeln (65 %) und hä-Partikeln mit Stellvertreterfunktion (64 %) auf. Peter Auer schreibt der Partikel so eine projizierende Funktion für nachfolgendes „verschobenes Sprechen“ (Auer 2006: 295) zu. Dieses entspricht der narrativen Redewiedergabe, welche in diesem Artikel als fiktives Zitat bezeichnet wird, hier jedoch auch die Wiedergabe gedanklicher Prozesse bezeichnet (vgl. Auer 2006: 298). Das fiktive Zitat kennzeichnet die Kategorien 1) und 2), nicht aber die Stellvertreterfunktion 3), welche im FOLK jedoch zu 64 Prozent so hä-Konstruktionen ausmachen. Interessant ist auch, dass so im von Auer verwendeten Korpus lediglich einmal in Verbindung mit einem Verbum dicendi vorkommt, wohingegen im FOLK neun so hä-Konstruktionen mit Verbum dicendi enthalten sind (vgl. Auer 2006: 297). Da Peter Auer Gesprächsdaten aus dem Jahr 2000 verwendet hat, kann vermutet werden, dass sich bis zum Jahr 2021, aus dem die aktuellsten Daten des hier verwendeten Korpus stammen, ein Sprachwandel hin zur häufigeren Kombination von so-Konstruktionen mit Verba dicendi vollzogen hat (vgl. Auer 2006: 296). Wie bei den 34 Vorkommen in der so hä-Konstruktion im FOLK ist die Partikel so in Auers Korpus unakzentuiert (vgl. Auer 2006: 295). So erfüllt in den Kategorien 1) und 2) die Rolle einer „Quotativ-Partikel“ (Auer 2006: 295), das heißt sie steht im Vorfeld eines direkten Zitates und wirkt relativierend auf dessen Wahrheitsgehalt. Mit so kann ausgedrückt werden, dass so etwas in der Art wie gedacht oder gesagt wurde. Oft stehen hä oder so hä auch anstelle eines ausführlicheren direkten Zitates – der Turn endet dann mit hä. In der Kategorie 3) könnte es sich auch um die von Auer beschriebene „emphatische so-Konstruktion“ (2006: 304) handeln, in der hä ähnlich einem Adjektiv (z. B.: unverständlich) funktioniert (vgl. Auer 2006: 311f.).
Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Hörer mithilfe prosodischer Merkmale, der Position und des Kontextwissens in den meisten Fällen situationsangemessen auf die hä-Partikel reagieren. Das impliziert, dass der Nichtverstehensmarker trotz seiner relativen Bedeutungsoffenheit und Kürze verständlich ist. Die hä-Partikel ist, entgegen ihrer Konnotation als ungebildeter Ausdruck, ein Beispiel für maximale Sprachökonomie und Effizienz.
Als problematisch am genutzten Untersuchungsdesign kann angesehen werden, dass die Kategorisierung vorrangig mithilfe semantischer und somit subjektiver Kriterien erfolgte. Syntaktische und phonologische Kriterien stützen die semantische Gruppierung jedoch größtenteils. Wenn die Einordnung in mehrere Kategorien möglich war, wurde sich für die spezifischere Kategorie entschieden. Beim kollektiven Nichtverstehen deutet die phonologische Realisierung auf die Bildung einer eigenständigen Kategorie hin, welche eine softwaregestützte phonetische Analyse notwendig machen würde. Die Gruppe Unverständnis gegenüber Handlungen ist sehr groß, da sie auf einer Skala zwischen Unverständnis und Dissens beruht, welche erst noch einer gesonderten Betrachtung bedarf. Die Nutzung einer weiten und einer engen Definition des Nichtverstehens über das Hauptkriterium der Reparaturinitiierung führt zum sehr hohen Anteil von 57 Prozent Grenzfällen, was dafürspricht, ein anderes Hauptkriterium festzulegen.
- Auer, Peter. 2006. Construction Grammar meets Conversation: Einige Überlegungen am Beispiel von „so“-Konstruktionen. In Günthner, Susanne; Imo, Wolfgang (Hgg.), Konstruktionen in der Interaktion. S. 291-314. Berlin: De Gruyter.
- Bauer, Angelika. 2020. Reparaturen. In Birkner, Karin u. a. (Hgg.), Einführung in die Konversationsanalyse. S. 331-414. Berlin: De Gruyter.
- Bremer, Katharina. 1997. Verständigungsarbeit. Problembearbeitung und Gesprächsverlauf zwischen Sprechern verschiedener Muttersprachen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Bublitz, Wolfram. 2009. Englische Pragmatik. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Deppermann, Arnulf. 2008. Verstehen im Gespräch. In Kämper, Heidrun; Eichinger, Ludwig M. (Hgg.), Sprache - Kognition - Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. S. 225-262. Berlin: De Gruyter.
- Deppermann, Arnulf. 2013. Zur Einführung: Was ist eine „Interaktionale Linguistik des Verstehens“?. Berlin: Erich Schmidt Verlag. https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/ index/docId/1061/file/Deppermann_Zur_Einf%c3%bchrung_was_ist_ein_interaktionale_Linguistik_des_Verstehens_2013.pdf (16.06.2023).
- Deppermann, Arnulf / Schmitt, Reinhold. 2008. Verstehensdokumentation: Zur Phänomenologie von Verstehen in der Interaktion. In Deutsche Sprache Ausgabe 3. S. 20-245.
- Gohl, Christiane / Günthner, Susanne. 1999. Grammatikalisierung von weil als Diskursmarker in der gesprochenen Sprache. In Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18(1) https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfsw.1999.18.1.39/html S. 39-75. [16.06.2023].
- Grice, Herbert Paul. 1975. Logic and Conversation. In Cole, Peter; Morgan, Jerry L. (Hgg.), Speech Acts. Leiden: BRILL. https://brill.com/edcollbook/title/38192 (16.06.2023).
- Gülich, Elisabeth / Mondada, Lorenza. 2008. Konversationsanalyse. Eine Einführung am Beispiel des Französischen. Romanistische Arbeitshefte 52. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Günthner, Susanne (2000). Vorwurfsaktivitäten in der Alltagsinteraktion: Grammatische, prosodische, rhetorisch-stilistische und interaktive Verfahren bei der Konstitution kommunikativer Muster und Gattungen. Tübingen: Niemeyer.
- Imo, Wolfgang. 2009. Konstruktion oder Funktion? Erkenntnisprozessmarker („change-of-state tokens“) im Deutschen. In Günthner, Susanne; Bücker, Jörg (Hgg.), Grammatik im Gespräch: Konstruktionen der Selbst- und Fremdpositionierung. S. 57-86. Berlin: De Gruyter.
- Kauschke, Christina. 2012. Kindlicher Spracherwerb im Deutschen: Verläufe, Forschungsmethoden, Erklärungsansätze. Berlin: De Gruyter.
- Kotthoff, Helga. 2020. Erzählen in Gesprächen. In: Birkner, Karin u. a. (Hgg.), Einführung in die Konversationsanalyse. S. 415-467. Berlin: De Gruyter.
- Myers, David G. / Siegfried Hoppe-Graff. 2014. Psychologie. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Orth, Eva-Maria. 2000. Das Selbstgespräch: Untersuchungen zum dialogisierten Monolog am Beispiel englischsprachiger Romane. Trier: WTV, Wiss. Verl. Trier.
- Schäflein-Armbruster, Robert. 1994. Dialoganalyse und Verständlichkeit. In Fritz, Gerd u. a. (Hg.). Handbuch der Dialoganalyse. S. 493-519. Tübingen: Niemeyer.
- Selting, Margaret. 1987. Reparaturen und lokale Verstehensprobleme oder: Zur Binnenstruktur von Reparatursequenzen. Linguistische Berichte 108, Postprints der Universität Potsdam. https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index /docId/3993/file/reparaturen_1987.pdf (16.06.2023).
Gesprächsausschnitte aus dem FOLK
- IDS 1: IDS, DGD, FOLK. https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00137_SE_01_T_01_DF_01&cID=c170&wID=w315 Z. 170 (14.06.2023).
- IDS 2: IDS, DGD, FOLK. https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00040_SE_01_T_01_DF_01&cID=c81&wID=w2447 Z. 81 (14.06.2023).
- IDS 3: IDS, DGD, FOLK. https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00442_SE_01_T_01_DF_01&cID=c937&wID=w4430 Z. 937 (12.06.2023).
- IDS 4: IDS, DGD, FOLK. https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00022_SE_01_T_03_DF_01&cID=c216&wID=w702 Z. 2016 (12.06.2023).
- IDS 5: IDS, DGD, FOLK. https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00331_SE_01_T_02_DF_01&cID=c1381&wID=w4604 Z. 1381 (12.06.2023).
- IDS 6: IDS, DGD, FOLK. https://dgd.ids-mannheim.de/DGD2Web/ExternalAccessServlet?command=displayTranscript&id=FOLK_E_00296_SE_01_T_02_DF_01&cID=c544&wID=w2947 Z. 544 (12.06.2023).
- Lawniczak, Gina. 2024. Nichtverstehen kurzgefasst – Eine korpuslinguistische Untersuchung der Funktionen des Nichtverstehensmarkers hä in Interaktionen In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Einfluss der bilingualen Erziehung auf den deutsch-polnischen Spracherwerb
Einfluss der bilingualen Erziehung auf den deutsch-polnischen Spracherwerb Gesprächsanalytische Untersuchung des Codeswitchings[^* Der vorliegende Beitrag ist der Vorstellung der im Wintersemester 2023 / 24 fertiggestellten Bachelorarbeit gewidmet.]
Zielsetzung
Das Ziel meiner Abschlussarbeit ist die Untersuchung des bilingualen Spracherwerbs im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Im Fokus der Untersuchung steht der Einfluss des familiären Umfelds und der sozialen Umgebung auf den doppelten Erstspracherwerb (2L1) der Kinder. Zuerst werde ich auf die theoretischen Aspekte des bilingualen Erstspracherwerbs eingehen und die Termini der Mutter-, Erst-, Zweit- und Fremdsprache definieren. Dabei wird das Prinzip der Sprachdominanz genauer erläutert und anhand ihrer positiven und negativen Wirkung auf die Sprachwahl und auf das Sprachverhalten in Situationen, „in denen eine Sprache bevorzugt verwendet wird“ (Müller 2016: 68) analysiert. Parallel werde ich auf das Phänomen des Codeswitchings bei kindlichen Sprecher:innen ausführlich eingehen. Im empirischen Teil wird die Ausführung meiner nicht-teilnehmenden Beobachtung beschrieben und das aufgenommene Sprachdatenmaterial transkribiert. Die Ergebnisse der Transkription werden gesprächsanalytisch untersucht, mit Fokussierung auf das Vorkommen des Codeswitchings in der Interaktion der Sprechenden.
Die Mehrsprachigkeit ist ein präsentes Thema in der heutigen, durch Globalisierung und Digitalisierung geprägten Gesellschaft. Kultureller und sprachlicher Austausch zwischen den Sprecher:innen weltweit ist in den letzten Jahrzehnten eminent gestiegen. Die Folge dieser beobachteten Erscheinung sind bikulturelle und bilinguale Beziehungen. Immer häufiger entscheiden sich Menschen dafür, ein gemeinsames Leben mit einem Partner oder einer Partnerin aus einem anderen nationalen und sprachlichen Kulturraum zu führen (vgl. Jańczak 2012: 119). Dies führt zur Gründung von gemischtsprachigen Familien, in denen die Verbreitung eigener Kulturen und Sprachen ein natürliches Phänomen darstellt und in denen sich die Partner:innen für bilinguale Erziehung ihres Nachkommens entschließen. Daraus ergeben sich die entscheidenden Fragen: Wie verhält sich das Phänomen des Spracherwerbs innerhalb der gemischtsprachigen Familien, wenn beide Elternteile mit dem Kind in ihrer bzw. in ihren Muttersprache(n) kommunizieren, und welche Sprache(n) sprechen bilingual aufwachsende Kinder, „wenn sie untereinander kommunizieren“ (Schneider 2012a: 140).
Forschungsbezug
Die Popularität der Mehrsprachigkeit ist seit dem 20. Jahrhundert in der soziolinguistischen, psycholinguistischen und neurolinguistischen Wissenschaft (vgl. Tracy 2014: 16) rasant gestiegen, was sich anhand von zahlreichen Studien zur Mehrsprachigkeitsforschung (Schneider 2012a, Schneider 2012b, Müller et al. 2007, Kielhöfer / Jonekeit 2006, Klein 1992, Tracy 1991) ableiten lässt. Es ist unbestritten, dass die Definition der Zwei- und Mehrsprachigkeit eine bestimmte Diskrepanz in der Forschung darstellt. Die Annahme, dass die Mehrsprachigkeit als Sonderfall gilt, wird von den Wissenschaftler:innen kategorisch abgelehnt. Weltweit betrachtet, wird Mehrsprachigkeit als eine Norm der menschlichen Kommunikation angesehen (vgl. Tracy 2014: 15). Chomsky (1993: 12) bezeichnet „menschliche Sprache [als] ein System von bemerkenswerter Komplexität“, welches als „Produkt menschlicher Intelligenz“ zu verstehen ist. Darüber hinaus behauptet er, dass bei Kindern der Prozess der Beherrschung eines komplexen Zeichenverbundsystems, einer Sprache, „auch ohne besonderen Unterricht gemeistert“ (ebd.) wird. Auf diese Annahme stützend, werde ich mich den Definitionen der Zwei- und Mehrsprachigkeit widmen in Bezug auf den doppelten Spracherwerb im Kindesalter. Es ist wichtig zu bemerken, dass beide Termini kongruent behandelt werden. Kielhöfer / Jonekeit (2006: 11) behaupten, dass es „keine feste Definition der Zweisprachigkeit“ gibt. Sie referieren die Annahme von Weinreich (1977: 15), dass die praktische Fähigkeit, „abwechselnd zwei Sprachen zu gebrauchen“ (1977: 15), als Zweisprachigkeit zu verstehen ist (vgl. Kielhöfer / Jonekeit 2006: 11). Dabei wird Bilingualismus, äquivalent zur Zweisprachigkeit, nach Lambeck (1984) als „Sprachvermögen eines Individuums, das aus dem natürlichen Erwerb [...] zweier Sprachen als Muttersprachen im Kleinkindalter resultiert“ (vgl. Müller et al. 2007: 16). Anhand dieser Behauptung werde ich mich mit dem Phänomen des natürlichen Erwerbs befassen, welches entsteht, wenn die Kinder „in ihrer natürlichen Umgebung“ (Kielhöfer / Jonekeit 2006: 14), beispielsweise durch ihre Bezugspersonen, auf zwei Sprachen gleichzeitig angewiesen sind. Natürlicher Spracherwerb ist analog dem simultanen Spracherwerb zu verstehen, da er im Gegensatz zum gesteuerten Spracherwerb nicht auf einer formellen, künstlich erzeugten Ebene erfolgt. Diese Annahme wird jedoch in der linguistischen Forschung als inakkurat und kritisch angesehen, da sie den Prozess des Lernens „unter formellen Bedingungen“ (Apeltauer 1997: 13) im negativen Licht darstellt. Zunächst werde ich die Hypothesen von mehrsprachiger Aneignung anhand von „drei Erklärungsversuche[n]“ (ebd.: 130) näher erläutern. Der rationalistischen bzw. nativistischen Theorie nach unterliegt der Spracherwerb biologisch bedingten Kriterien, die das Prinzip der angeborenen Sprachfähigkeit in den Mittelpunkt setzen. Der Ausgangspunkt der Theorie ist, dass Sprache ein „Merkmal der menschlichen Spezies ist“ (Chomsky 1993: 54). Dieser Erklärungsansatz wurde jedoch „durch empirische Untersuchungen in Frage gestellt“ (Apeltauer 1997: 130) und anhand dieser modifiziert. Im Bereich der Sprachpsychologie wird dagegen behauptet, dass der Erwerb von Fremdsprachen einer kognitiven Basis bedarf (vgl. ebd.: 131). Darauf basiert die Theorie des Empirismus. Die Beschleunigung des Lernprozesses durch „Bewusstmachung, Kontrolle, Automatisierung und Rekonstruierung“ (ebd.: 132) wird ins Zentrum dieser Theorie gesetzt. Zuletzt werden „sozialpsychologische Erklärungsversuche“ (ebd.) thematisiert, die sich mit „sprachliche[n], soziale[n] und affektive[n] Faktoren“ (ebd.) auseinandersetzen und das Verhältnis zwischen der lernenden Person und der gewünschten Sprache als Priorität hervorheben. In dem Fall wird die Umgebung der Lernenden als positiver, aber auch als negativer Einflussfaktor angesehen. Problematisch an der Stelle ist, dass der Komplexitätsgrad einer Sprache so hoch ist, dass es unmöglich wäre, sich nur auf die theoretischen Ansätze zu stützen, was die Gewährleistung eines erfolgreichen Spracherwerbs angeht. Im Anschluss beziehe ich mich auf einen Hinweis von Nitsch (2007: 48), dass „Lernen [...] [und] der Erwerb von Sprachen ein höchst individueller Prozess“ ist, was oft in der Lernphase einer Sprache in Vergessenheit geraten kann. Auf weitere Aspekte der Mehrsprachigkeit und des simultanen Spracherwerbs werde ich in meiner geplanten Arbeit detaillierter eingehen.
Ausgewählte Forschungsmethode
Die Planung und die Unterteilung meiner empirischen Arbeit lässt sich mittels „forschungsmethodologische[n] Dreischritt[s]“ (Settinieri 2014: 58) so darstellen: Um das bilinguale Sprachverhalten innerhalb der gemischtsprachigen Familie zu untersuchen, wird eine qualitative Erhebung des Sprachdatenmaterials anhand einer nicht-teilnehmenden Beobachtung durchgeführt. Der Untersuchungsort ist die Stadt Görlitz im polnisch-sächsischen Grenzgebiet. Aufgrund ihrer Lage und daraus resultierender Vielfalt an zweisprachigen Familien bildet sie eine ideale Forschungsgrundlage. Ein deutsch-polnisches Paar mit bilingual aufwachsenden Töchtern hat Interesse gezeigt, an meiner Forschung teilzunehmen. Die Muttersprache des Vaters ist Deutsch und die der Mutter Polnisch. Sie erziehen ihre Töchter von Geburt an bilingual, indem sie sich der Spracherziehungsmethode „Eine Person – Eine Sprache“ (Müller 2016: 11) bedienen. Diese Methode werde ich präziser in meiner eigentlichen Bachelorarbeit darstellen. Im Rahmen der nicht-teilnehmenden Beobachtung wird die Mutter der Probandinnen, die zu dem Zeitpunkt der Untersuchung im Alter von vier und sieben Jahren sind, ihre alltägliche Kommunikation aufnehmen. Die Entscheidung, dass die Mutter für die direkte Datenerhebung verantwortlich ist, basiert auf der Annahme, dass es in bestimmten Fällen während der „Erhebungssituation zu Verhaltensveränderung bei den beobachteten Personen“ (Brede 2014: 137) kommen könnte, wenn die Aufnehmenden außerhalb des unmittelbaren, sozialen Umfelds stammen. Die Mutter der Probandinnen wird vierzehn Tage lang die verbale Kommunikation zwischen ihren Töchtern aufnehmen und mir das gewonnene Sprachmaterial am Ende dieser Zeit zur Verfügung stellen. Im Mittelpunkt meiner Untersuchung stehen während der Kommunikation auftretende Sprachphänomene, mit Hervorhebung des Codeswitchings und der Dominanzgrad der deutschen und polnischen Sprache. Die Datenaufbereitung wird im Transkriptionstool FOLKER durchgeführt. Die Ergebnisse der Transkription werden gesprächsanalytisch untersucht. Die Auswertung des Datenmaterials wird nach der Bottom-up-Perspektive erfolgen, was bedeutet, dass die Fragestellung erst nach der Datenanalyse zustande kommt.
Mehrsprachigkeit und Textdynamik?
Die Textdynamik bezieht sich nicht nur auf geschriebene, sondern auch auf gesprochene Sprache. Es lässt sich nicht abstreiten, dass Sprache ein äußerst dynamisches Phänomen ist, insbesondere wenn die Sprecher:innen in der Lage sind, mehrere Sprachen gleichzeitig zu beherrschen. Die Dynamik in der Mehrsprachigkeit bezieht sich auf den kontinuierlichen, fließenden Wechsel zwischen den Sprachen, der von Sprecher:innen je nach Situation und Kommunikationsbedarf gesteuert wird. Dieser dynamische Wechsel zwischen den Sprachen, auch als Codeswitching bekannt, spiegelt die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von Sprechenden wider. Es ermöglicht die effektive Kommunikation und die Ausdrucksfähigkeit in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten. Die Dynamik in der Mehrsprachigkeit illustriert die lebendige Entwicklung von sprachlichen Systemen der Sprecher:innen, die nicht statisch sind, sondern sich ständig an die Anforderungen der ein- oder mehrsprachigen Umgebung anpassen.
- Apeltauer, Ernst. 1997. Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs: Eine Einführung. Kassel: Langenscheidt.
- Chomsky, Noam. 1993. Reflexionen über die Sprache. 3. Auflage. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Jańczak, Barbara. 2012. Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache – Familienidentität? In Jańczak, Barbara / Jungbluth, Konstanze / Weydt, Harald (Hg.), Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. S. 119–138. Tübingen: Narr Verlag.
- Jonekeit, Sylvie / Kielhöfer, Bernd. 2006. Zweisprachige Kindererziehung. Unveränderte 11. Auflage. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
- Klein, Wolfgang. 1992. Zweitspracherwerb. Eine Einführung. 3. Auflage. Frankfurt a. M.: Hain.
- Müller, Natasza u. a. 2007. Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung: Deutsch, Französisch, Italienisch. 2. Auflage. Tübingen Narr Verlag.
- Müller, Natasza. 2016. Mehrsprachigkeitsforschung. Tübingen: Narr Verlag.
- Nitsch, Cordula. 2007. Mehrsprachigkeit: Eine neurowissenschaftliche Perspektive. In Anstatt, Tanja (Hg.), Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen: Erwerb. Formen. Förderung. S. 47–68. Tübingen: Narr Verlag.
- Ricart Brede, Julia. 2014. Beobachtung. In Settinieri, Julia / Demirkaya, Sevilen / Feldmeier, Alexis / Gültekin-Karakoç, Nazan / Riemer, Claudia (Hg.), Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Eine Einführung. S. 137–146. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schneider, Marzena. 2012a. Sprachwahlmuster beim deutsch-polnischen Erstspracherwerb und der Einfluss älterer Geschwister. In Jańczak, Barbara / Jungbluth, Konstanze / Weydt, Harald (Hg.), Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. S. 139–153. Tübingen: Narr Verlag.
- Schneider, Marzena. 2012b. Sprachwahl in der bilingualen Praxis: Eine Langzeitstudie zum deutsch-polnischen Erstspracherwerb. Stuttgart: Ibidiem-Verlag.
- Settinieri, Julia. 2014. Planung einer empirischen Studie. In Settinieri, Julia / Demirkaya, Sevilen / Feldmeier, Alexis / Gültekin-Karakoç, Nazan / Riemer, Claudia (Hg.), Empirische Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Eine Einführung. S. 57–72. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Tracy, Rosemarie. 1991. Sprachliche Strukturentwicklung: Linguistische und kognitionspsychologische Aspekte einer Theorie des Erstspracherwerbs. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Tracy, Rosemarie. 2014. Mehrsprachigkeit: Vom Störfall zum Glücksfall. In Krifka, Manfred / Błaszczak, Joanna / Leßmöllmann, Annette / Meinunger, André / Stiebels Barbara / Tracy, Rosemarie / Truckenbrodt, Hubert (Hg.), Das mehrsprachige Klassenzimmer: Über die Muttersprachen unserer Schüler. S. 13–33. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag.
- Szczęch, Kinga. 2024. Einfluss der bilingualen Erziehung auf den deutsch-polnischen Spracherwerb: Gesprächsanalytische Untersuchung des Codeswitchings. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Rhetorische Figuren in der Werbesprache
Rhetorische Figuren in der Werbesprache[^* Dieser Artikel entstand im Rahmen der Masterarbeit ‚Rhetorische Figuren in der Werbesprache‘.]
Forschungsfragen
In der Masterarbeit werden rhetorische Figuren in der Werbesprache behandelt. Diese Arbeit hat zum Ziel, folgende Forschungsfragen zu beantworten:
- Welche rhetorischen Figuren kommen in der Werbung vor?
- Welche Funktionen üben rhetorische Figuren in der Werbung aus? Lassen sich irgendwelche Tendenzen beobachten?
- Wie spielen sie mit anderen Elementen des Werbetextes zusammen?
- Von welchen Faktoren ist die Wahl rhetorischer Figuren in der Werbung abhängig?
Das Korpus der Arbeit beschränkt sich auf den Bereich der Kaffeewerbung.
Theoretische Grundlagen
In den zwei ersten Kapiteln der Masterarbeit werden die theoretischen Grundlagen besprochen. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Werbung. Es ist schwierig, eine ausführliche Definition dieses Begriffs zu finden. Trotzdem werden ein paar mögliche Erklärungen angegeben, die Andrea Csapóné-Horvath in ihrem Artikel „Werbung und Werbesprache“ (vgl. Csapóné-Horvath 2011: 342) erwähnt, vor allem die folgende: „Werbung sind alle Äußerungen, die sich an diejenigen richten, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen versucht wird“ (Hundhausen 1969: 46). Auch wenn diese Definition gar nicht ausführlich ist, weist sie auf die Hauptfunktion der Werbung hin, nämlich auf die Appellfunktion. Außerdem wird eine Einteilung der Werbung nach Rebekka Bratschi (2005) erwähnt. Die Forscherin nennt folgende Typen: politische, religiöse, kulturelle, soziale Werbung und Wirtschaftswerbung. Die Masterarbeit befasst sich mit der Wirtschaftswerbung, also mit der Werbung für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens.
Es werden auch die kommunikativen Funktionen der Werbung erklärt. Dabei wird Bezug auf die Publikation ‚Werbesprache‘ von Nina Janich genommen. Nach der Ansicht der deutschen Forscherin ist die Appellfunktion die Hauptfunktion der Werbung. Diese wird in mehrere Teilfunktionen aufgegliedert. Das sind etwa Aufmerksamkeit aktivierende Funktion, Verständlichkeitsfunktion, Akzeptanzfunktion, Erinnerungsfunktion, vorstellungsaktivierende Funktion, Ablenkungsfunktion und Attraktivitätsfunktion (Janich 2016: 119). Wegen des limitierten Umfangs des Beitrags werden nur einige Funktionen charakterisiert. Die erste dieser Funktionen äußert sich, indem bestimmte Elemente wie etwa Typografie oder gezielt verwendete auffällige Ausdrücke das Interesse des Rezipienten wecken. Die zweite besteht in der Versicherung, dass die Intention der Werbebotschaft verstanden wird.
Bei der Erinnerungsfunktion handelt es sich darum, dass die Werbebotschaft sich einfacher im Gedächtnis speichern lässt. Sie kann beispielsweise durch unterschiedliche Arten der Wiederholungen, wie etwa Reime, Alliterationen oder Wiederholungen ganzer Wörter realisiert werden. Bei der Ablenkungsfunktion handelt es sich darum, die Persuasionsabsicht des Werbetextes nicht offen zu zeigen. Attraktivitätsfunktion steht in einem Zusammenhang mit der Unterhaltung. Es besteht die Gefahr, dass diese Teilfunktion in dem Werbetext dominant wird, indem die Verwendung bestimmter Mittel wie Witz oder Ironie dazu führt, dass die Aufmerksamkeit des Rezipienten nicht dem beworbenen Produkt, sondern dem Werbetext und den in ihm verwendeten Mitteln geschenkt wird.
Bei der Behandlung der Werbung aus textlinguistischer Sicht soll dem Aspekt der Themenentfaltung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Textthemen in der Werbung können narrativ oder argumentativ entfaltet werden (vgl. Janich 2016: 120). Die narrative Themenentfaltung besteht darin, dass ein Werbetext wie eine Geschichte konstruiert wird. Dieser Aspekt wird in der Masterarbeit detailliert beschrieben.
Bei der argumentativen Themenentfaltung werden unterschiedliche Argumentationsstrategien verwendet, die sich auf das Produkt, auf den Sender oder auf den Empfänger beziehen können. Die senderbezogenen Argumente verweisen gewöhnlich auf die Auszeichnungen und Preise, die der Sender bekommen hat, sowie auf seine langjährige Erfahrung. Solch eine Argumentation kommt als Werbestrategie in unterschiedlichen Branchen vor. Die empfängerbezogene Argumentation beruft sich auf überindividuelle, in einer bestimmten Gesellschaft hochgeschätzte Werte. Je nach Branche sind das hedonistische, wie etwa Erfolg, Schönheit oder Jugend, oder altruistische Werte, wie etwa Sicherheit, Verantwortung oder Familie. Die Werte aus der ersten Gruppe kommen mit besonderer Häufigkeit in der Werbung für Reisen, Kosmetika und manche Arten von Lebensmitteln vor. Altruistische Werte werden in der Werbung für Versicherungen oder manchmal für Autos bevorzugt. Bezüglich der empfängerbezogenen Argumente wird emotionale Aufwertung genannt, also die Verbindung des Produkts mit bestimmten positiven Werten und Emotionen, wie etwa Exotik, Exklusivität, Lebensfreude und Eleganz (vgl. Janich 2016: 143–145).
Daneben werden mehrere Typen der produktbezogenen Argumente von Janich aufgezählt. Verweis auf Herkunft des Produkts soll besonders häufig in der Werbung für Lebensmittel und Kosmetika Anwendung finden. Im ersten Fall wird die regionale Herkunft des Produkts als Beweis seiner guten Qualität betrachtet. Bei Werbung für Kosmetika und manchmal auch für Lebensmittel wird Bezug auf die natürliche Herkunft des Produkts genommen. In vielen Werbetexten werden Produkteigenschaften genannt sowie die Wirkungsweise des Produkts beschrieben. Es können auch Verwendungssituationen gezeigt werden, damit die Empfänger mit dem Produkt vertraut werden und sehen, wie sie es verwenden können. Warentests werden als Beweis für die Qualität eines Produkts betrachtet, besonders wenn die zitierte prüfende Instanz als eine Autorität innerhalb einer Branche gilt. Nicht selten werden auch marktbezogene Argumente angegeben. Diese Strategie kann schlüssig sein, wenn die Angaben sich nachprüfen lassen (vor allem im Falle eines Sonderangebotes). Zu diesem Typ der Argumente werden jedoch auch typische Werbeaussagen wie etwa erstes, bestes usw. zugerechnet, die lediglich Behauptungen sind (vgl. Janich 2016: 141f.).
Im zweiten Kapitel der Masterarbeit werden die Werbesprache und ihre Eigenschaften anhand der Publikation ‚Werbesprache‘ von Nina Janich dargestellt. Teilweise wird auch Bezug auf ‚Die Sprache der Anzeigenwerbung‘ von Ruth Römer genommen. Im vorliegenden Beitrag werden die Eigenschaften der Werbesprache nur kurz geschildert. Obwohl Substantive häufig in der Werbung vorkommen, kann man vom Nominalstil nicht sprechen, weil erst dann von diesem Stil gesprochen werden kann, wenn die verwendeten Substantive vorwiegend Nominalisierungen von Verben oder Adjektiven sind (vgl. Janich 2016: 151). Auf der syntaktischen Ebene überwiegen kurze und einfache Sätze. Nicht selten kommen Ellipsen vor, insbesondere in Werbeslogans, wo häufig auf Vollverben verzichtet wird (vgl. Csapóné-Horvath 2011: 347).
Weil die Werbung ein Text ist, sind auch die Vertextungsmittel von Bedeutung. Das sind etwa explizite sowie implizite Wiederaufnahme, Struktur-Rekurrenz, Deixis, Konnexion und Isotopie (vgl. Janich 2016: 186f.). Explizite Wiederaufnahme, auch Korreferenz genannt, besteht in der Existenz der Referenzidentität zwischen mehreren Ausdrücken innerhalb eines Textes. Eine Korreferenzkette beginnt mit einem normalerweise autosemantischen (d. h. eine eigene lexikalische Bedeutung tragenden) Bezugsausdruck, auf den nachfolgende Ausdrücke sich beziehen. Das kann durch synsemantische (also lediglich eine grammatische Bedeutung tragende) Pronomina, Wortwiederholungen oder Verwendungen der gewöhnlich textgebundenen Synonyme realisiert werden. Bei impliziter Wiederaufnahme kann nicht von Referenzidentität gesprochen werden, sondern von logischer, ontologischer oder kultureller Kontiguität. Die zweite Variante kommt besonders häufig in der Werbung vor, indem einzelne Details des beworbenen Produkts genau beschrieben werden. Zur Zeit der Entstehung des Beitrags waren noch nicht genug Informationen zur Frage der Einteilung rhetorischer Mittel gesammelt.
Methodologie
Die Forschungsmethodologie stützt sich auf das von Nina Janich (vgl. 2016: 267) vorgeschlagenen Modell. Die Wahl fiel auf dieses Modell, weil es sich gut zur Untersuchung multimodaler Werbetexte eignet. Es besteht aus zwei Etappen: Der Analyse und der Synthese. Beide sind in drei Schritte untergliedert. Der erste Schritt der Analyse besteht in der Skizzierung textexterner Faktoren, wie etwa Branche, Sender, Werbemittel oder Zielgruppe. Zweitens werden Struktur und formale Gestaltung der Teiltexte erforscht. Darunter sind drei Ebenen zu nennen: die visuelle, die verbale und die paraverbale. Zu untersuchende Aspekte der visuellen Ebene sind vor allem Schrifttypen, Farben und das Arrangement der Elemente. Auf der verbalen Ebene können mehrere Typen der Teiltexte untersucht werden, u. a. Lexik, Phraseologie, Syntax oder rhetorische Figuren, wobei die meiste Aufmerksamkeit Letzteren geschenkt wird. Die paraverbalen Teiltexte sind vor allem Typographie und Interpunktion. Bei der Untersuchung des Inhalts der Teiltexte sind insbesondere Konnotationen, Denotationen und Isotopien zu berücksichtigen.
Im ersten Schritt der Synthese wird das Zusammenspiel textinterner Faktoren dargestellt. Dabei sollen vor allem die Argumentation und die persuasiven Funktionen einzelner Elemente erforscht werden. Der zweite Schritt ist der Korrelation zwischen intra- und extratextuellen Faktoren gewidmet. Am Ende soll eine zusammenfassende Interpretation des Werbetextes angeboten werden, sowie die mögliche und die beabsichtigte Wirkung. Dieser Schritt kann als problematisch erscheinen, weil es schwierig ist, die mögliche Wirkung des Werbetextes zu beurteilen, ohne Zugang zu Angaben über den Verkauf des Produktes zu haben.
Korpus der Arbeit
Zur Zeit der Entstehung des Beitrags wird das Korpus noch bearbeitet. Es wurden bereits ein paar Werbetexte aus der Kaffeeindustrie gefunden und gesammelt. Sie liegen in der Form von Werbebildern oder -videos vor und kommen aus offiziellen Instagram-Profilen und YouTube-Kanälen der jeweiligen Unternehmen, vor allem Röstereien, Cafés oder Kaffeehersteller (etwa Lavazza oder Jacobs). Die genaue Unterteilung dieses Kapitels ist noch nicht völlig bestimmt. Er soll mindestens sechs Unterkapitel umfassen und jedes soll sich einer anderen rhetorischen Figur widmen. Falls eine rhetorische Figur nur in einem Werbetext vorkommt und der Text trotzdem untersuchenswert erscheint, wird dieser dem Unterkapitel „Sonstige“ zugeordnet. Angestrebt wird in jedem Unterkapitel mindestens drei Werbetexte zu untersuchen.
- Bratschi, Rebekka. 2005. Xenismen in der Werbung. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Csapóné-Horvath, Andrea. 2011. ‚Werbung und Werbesprache’, Orbis Linguarum, 37, S. 341–351.
- Hundhausen, Carl. 1969. Werbung. Grundlagen. Berlin: De Gruyter.
- Janich, Nina. 2016. Werbesprache: Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
- Römer, Ruth. 1968. Die Sprache der Anzeigenwerbung. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.
- Giemza, Katarzyna. 2024. Rhetorische Figuren in der Werbesprache. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Die unterschiedlichen Textbestände der
Historienbibel IIa
Die unterschiedlichen Textbestände der Historienbibel IIa Ein stemmatischer Erklärungsversuch[^* Dieser Beitrag stellt einen Einblick in das laufende Promotionsprojekt unter dem Arbeitstitel ‚Schreiben in der Lauberwerkstatt‘ dar.]
Julia Seibicke (Universität Leipzig)
Texte aus mehr als 100 der Forschung bekannten Handschriften werden unter dem Begriff ‚Historienbibel‘ zusammengefasst (vgl. Handschriftencensus 2023 [a]), der aufgrund seiner Unschärfe Schwierigkeiten bereitet. Denn gerade diese Unschärfe ist Anzeichen der charakteristisch hohen Varianz dieser Texte. Die noch immer treffendste Definition des Begriffs ‚Historienbibel‘ liefert Vollmer 1912:
Ich verstehe im folgenden unter deutschen Historienbibeln deutsche Prosatexte, die in freier Bearbeitung den biblischen Erzählungsstoff, möglichst vollständig, erweitert durch apokryphe und profangeschichtliche Zutaten und unter Ausschluß oder doch Zurückdrängung der erbaulichen Glosse darbieten, ganz gleichgültig, ob dabei gereimte Quellen oder die Vulgata, Historia scholastica, das Speculum historiale oder sonstige die heilige in Verbindung mit profaner Geschichte behandelnde Texte als Vorlage dienten (Vollmer 1912: 5).
Nach den unterschiedlichen Quellen, auf die die Texte zurückgehen, und nach ihren Schreibsprachen gliedert Vollmer die Historienbibeln in neun Hauptgruppen, wobei bei den Redaktionen I bis III die Untergruppen Ia, b, c; IIa, b, c sowie IIIa und b unterschieden werden (vgl. Vollmer 1912: 8–36). Diese Unterteilungen versuchen, der enormen Varianz dieser Texte gerecht zu werden, doch selbst innerhalb der Untergruppen wird besonders im Textbestand die Uneinheitlichkeit deutlich:
Der Bestand an biblischen und außerbiblischen Büchern in den ‚Hbb.‘ ist unterschiedlich und auch innerhalb der einzelnen Gruppen durchaus unfest; [Nach Vollmer] läßt sich in bezug auf Inhalt und Aufbau einer ‚Hb.‘ jeweils nur für eine Hs. Genaues sagen […] (Gerhardt 1983, Sp. 69f.).
Diesem Problem wird im Folgenden nachgegangen: Ist der Textbestand[^1 Der Begriff des ‚Textbestandes‘ wird hier in Anlehnung an Bumke verwendet, der ihn zur Unterteilung von Fassungen verwendet (vgl. Bumke 1996: 391f.).] innerhalb einer Untergruppe der Historienbibeln tatsächlich für jede Handschrift so einzigartig, dass Gruppierungen scheitern?
Dazu soll eine Gruppe mit möglichst vielen überlieferten Textzeugen zugrunde gelegt werden, bei der die Varianz im Textbestand besonders deutlich wird: Die Redaktion IIa mit 17 vollständigen Handschriften scheint besonders geeignet zu sein (vgl. Handschriftencensus 2023 [b]). Eine wissenschaftlichen Standards genügende Edition liegt nicht vor, einzig die bereits 1912 durch Vollmer scharf kritisierte Edition Merzdorfs, die sich vor allem an den beiden Dresdener Handschriften orientiert (vgl. Vollmer 1912: 8). Auch eine stemmatische Betrachtung der Überlieferungsstränge steht noch aus. Vollmer hielt nur skizzenartig einzelne Verwandtschaften zwischen Handschriften fest (Vollmer 1912: 104–125, besonders 115).
Die Redaktion IIa stellt eine beinahe wörtliche Prosaauflösung der ‚Weltchronik‘ Rudolfs von Ems dar. In seiner kürzeren Version, der Merzdorfs Edition folgt, endet der Text bei Salomon und Atonias (vgl. Merzdorf 1870: 900). Die durch Vollmer sogenannte ‚Fortsetzung‘ (vgl. Vollmer 1912: 8) führt ihn weiter bis Ahab. Zusätzlich kann der Psalter eingefügt sein und eine Prosaauflösung des ‚Marienlebens‘ des Bruders Phillipp. Folgende Verteilung der Textteile liegt in den Handschriften vor:
|
Signatur |
Weltchronik |
Psalter |
Fortsetzung |
Marienleben |
|---|---|---|---|---|
|
Augsburg, Staats- und Stadtbibl., |
ja |
nein |
ja |
ja |
|
Berlin, Staatsbibl., Hdschr. 382 |
ja |
nein |
ja |
nein |
|
Bonn, Universitätsbibl., Cod. S 712 |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Darmstadt, Universitäts- und |
ja |
nein |
ja |
ja |
|
Dresden, Landesbibl., Mscr. A 49 |
ja |
nein |
nein |
ja |
|
Dresden, Landesbibl., Mscr. A 50 |
ja |
nein |
nein |
nein |
|
Frauenfeld, Kantonsbibl., Cod. |
ja |
nein |
ja |
nein |
|
Köln, Hist. Archiv der Stadt, Best. |
ja |
nein |
ja |
ja |
|
Kopenhagen, Königl. Bibl., Cod. |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
London, British Libr., MS Add. |
ja |
nein |
nein |
nein* |
|
Mainz, Stadtbibl., Hs. II 64 |
ja |
nein |
ja |
ja |
|
München, Nationalmuseum, Cod. |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
München, Staatsbibl., Cgm 1101 |
ja |
nein |
ja |
ja |
|
München, Staatsbibl., Cgm 206 |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Nelahozeves, Lobkowitzsche Bibl., |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Würzburg, Universitätsbibl., |
ja |
ja |
ja |
ja |
|
Zürich, Zentralbibl., Ms. C 5 |
ja |
ja |
ja |
ja |
* Die Londoner Handschrift enthält als zweiten Teil nicht das Marienleben, sondern das ‚Buch der Könige‘ (BdK) über Ahab hinaus (zu den Textbeständen der Handschriften vgl. auch Vollmer 1912: 12).
Auf den ersten Blick scheinen sich schon anhand des Textbestandes Gruppierungen innerhalb der Redaktion IIa zu ergeben. Sieben Handschriften beinhalten alle vier Textteile, fünf weiteren fehlt nur der Psalter und die übrigen fünf haben Textbestände in unterschiedlichen Kombinationen. Um zu klären, wie die Auswahl der Textbestandteile getroffen wurde, ist zu prüfen, ob der Textbestand möglicherweise vorlagenabhängig war. Im Folgenden sollen die 17 vollständigen Historienbibeln der Redaktion IIa Überlieferungssträngen zugeordnet werden, deren Textbestand zu bestimmen ist.
Die Überlieferungsstränge der Historienbibel IIa
Zur Unterscheidung der Überlieferungsstränge werden Textvergleiche herangezogen. Da vier Handschriften das ‚Marienleben‘ fehlt und zehn der Psalter, sollen sich die folgenden Betrachtungen auf die in allen Handschriften enthaltene ‚Weltchronik‘ konzentrieren. Es wurden fünf Beispiele ausgewählt, um einen knappen Überblick über die unterschiedlichen Lesarten einzelner Textstellen zu bieten. Da es sich bei diesem Teil des Historienbibeltextes um eine beinahe wörtliche Prosaübertragung der ‚Weltchronik‘ handelt, wird der Rudolf’sche Text nach der Edition von Gustav Ehrismann als Vergleichsgrundlage dienen. Ihm gegenübergestellt werden alle Auflösungsvarianten der Textstelle mit je einem Transkriptionsbeispiel aus einer Handschrift. In der abschließenden Tabelle, die wieder alle Handschriften verzeichnet, wird notiert, welcher Variante die entsprechende Handschrift an dieser Textstelle folgt.
Textstelle 1:
|
Weltchronik |
Auflösung A |
Auflösung B |
|---|---|---|
|
[V. 5138] do tet Abraham zehant, der edil Gotis wigant, als in Got hiez und im gebot: […] |
(Zürich, 52v) Do nü abraham der edel gotez wigant wolt vollenden also im gotte geheissen vnd gebotten hette […] |
(Frauenfeld, 46v) Do Nü Abraham der Edel gottes wigant als In got geheissen vnd gebotten hette […] |
Textstelle 2:
|
Weltchronik |
Auflösung A |
Auflösung B |
|---|---|---|
|
[V. 7136] ein wip im do ze wibe nam, der vater was genant Ýram und si was Sue genant. dú gebar im sa zehant zwene súne, Her und Omam. darnah er abir ze wibe nam ein andir wip dú hiez Tamar, dú gebar im al fúr war ze kinden zwene súne îesa, das was Phares und Zara. |
(Zürich, 72v) Vnd was sine tochter Sne[^2 In der Züricher Handschrift könnte auch ‚Sue‘ gelesen werden. In den Historienbibeln IIa bei Lauber scheint dieser Name allerdings vermehrt mit n geschrieben worden zu sein.] genant die gebar jme zwen süne genant her vnd Eman Dar noch nam er aber ein wip hies thamar Die gebar jme zwen súne einer genant Paris der ander Sara |
(München, Cgm 1101, 70v) ¶Vnd waz sin dochter sne genant die gebar yme zwen süne einer genant paris der ander genant sara |
Textstelle 3:
|
Weltchronik |
Auflösung A |
Auflösung B |
Auflösung C |
Auflösung D |
|---|---|---|---|---|
|
[V. 10405] ‚mir ist des wol ze můte in minem willen, das ich niemer me gesehe dih!‘ ‚das tů‘, sprah der kúnig, ‚odir ih heize bi namen teoden dih!‘ [V.10410] Moýses der reine man von Pharaone kerte dan, do er sin angesiht verswor. hin zů sinim kúnne er fůr und gap in gůtes trostes vil. |
(Zürich, 101r) Do / sprach moyses jch gloub das ich dich niemer me gesehe |
(Frauenfeld, 100r) Da sprach moÿses Jch gloube das ich dich niemer mer gesehen mag |
(München, Cgm 1101, 101v) Do sprach moyses jch gloub das ich dich niemer me gesehe Vnd fùr heim zü syme kùnige vnd gap in güten tröst |
(Dresden, A 50, 121v) Do sprach moises das du mich nit me hie sůchest ich gloube das ich dichnie mer me gesehe |
Textstelle 4:
|
Weltchronik |
Auflösung A |
Auflösung B |
Auflösung C |
Auflösung D |
|---|---|---|---|---|
|
[V. 13831] Moýses zůzim do nam die eltisten von al der diet, die er im ze rate uz schiet, |
(Zürich, 130r) […] den eltisten von der diet beschiet er jn v̀s zú sime raute Do sprach |
(Frauenfeld, 138r) […] den Eltesten von der beschied er jme vff zü same Raute da sprach […] |
(München, Cgm 1101, 131v) den eiltesten von der diet beschiet er yme vs mit sime Rate |
(München, Cgm 206, 93r) den eltosten von der diet beschied er jm was zü seinem ratt |
Textstelle 5:
|
Weltchronik |
Auflösung A |
Auflösung B |
Auflösung C |
|---|---|---|---|
|
[V. 16857] die boten vůren dannen sa, wise lúte als er die vant, unde besahen in dú lant eigenliche fur unde wider. |
(Zürich, 155v) Die botten fürnt hindan Vnd befülhent in die lante gar eigentlichen teilen |
(München, Cgm 1101, 155v) die botten füren hin danne ¶Vnd befülhen in die lant gar eigentlich |
(London, 200v) Die botten fürent hin dan hin dan in die lant gar eigentlich […] |
Verteilung der Varianten
|
Signatur |
Textstelle und Auflösung |
Textbestand |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
London, British Libr., MS Add. 24917* |
C |
W+BdK |
||||
|
Dresden, Landesbibl., Mscr. A 50** |
B |
A |
D |
n. l. |
B |
W |
|
Dresden, Landesbibl., Mscr. A 49 |
B |
n. l. |
n. l. |
n. l. |
n. l. |
W+M |
|
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl., Hs. 1 |
B |
A |
D |
D |
B |
W+F+M |
|
München, Staatsbibl., Cgm 206 |
B |
A |
D |
D |
A |
W+P+F+M |
|
Mainz, Stadtbibl., Hs. II 64 |
A |
B |
C |
C |
fehlt |
W+F+M |
|
München, Staatsbibl., Cgm 1101 |
A |
B |
C |
C |
B |
W+F+M |
|
Köln, Hist. Archiv der Stadt, Best. 7010 (W) 250*** |
B |
A |
B |
fehlt |
A |
W+F+M |
|
Berlin, Staatsbibl., Hdschr. 382 |
B |
A |
B |
B |
A |
W+F |
|
Frauenfeld, Kantonsbibl., Cod. Y 19 |
B |
A |
B |
B |
A |
W+F |
|
Augsburg, Staats- und Stadtbibl., 2° Cod. 50 |
A |
A |
fehlt |
A |
A |
W+F+M |
|
Bonn, Universitätsbibl., Cod. S 712 |
A |
A |
A |
A |
A |
W+P+F+M |
|
München, Nationalmuseum, Cod. 2502 |
A |
A |
A |
A |
A |
W+P+F+M |
|
Würzburg, Universitätsbibl., M. ch. f. 25 |
A |
A |
A |
A |
fehlt |
W+P+F+M |
|
Zürich, Zentralbibl., Ms. C 5*** |
A |
A |
A |
A |
A |
W+P+F+M |
|
Kopenhagen, Königl. Bibl., Cod. Thott. 123 2° |
W+P+F+M |
|||||
|
Nelahozeves, Lobkowitzsche Bibl., Cod. VI Ea 5 |
W+P+F+M |
|||||
* leere bzw. gestrichene Zellen verweisen auf nicht ausgewertete Textstellen.
** ‚n. l.‘ steht für nicht lesbare Passagen. In Dresden, A 49 ist dies einem schweren Wasserschaden der Handschrift geschuldet.
*** Durch weitere Textvergleiche deutet sich ein Vorlagenwechsel an, der in diesen knappen Tabellen nicht deutlich gemacht werden kann: Die Kölner Handschrift wechselt auf Blatt 163v von einer Vorlage des Frauenfelder Stranges zu einer des Stranges um München Cgm 1101.
Anhand der Verteilung der Varianten ist es möglich, Überlieferungsstränge zu benennen. Die Redaktion IIa geht auf fünf Überlieferungsstränge zurück. Der Strang der Londoner Handschrift kann nicht untersucht werden, da ein zweiter Überlieferungsträger als Vergleichsbasis fehlt.
Sehr uneinheitlich ist der Textbestand in der Gruppe um die Dresdener Handschriften. Dazu passt, dass in dieser Gruppe für keine zwei Handschriften die Lesarten in der ‚Weltchronik‘-Übertragung genau übereinstimmen. Über den gesamten Verlauf dieses Teils des Textes sind die Lesarten in dieser Gruppe höchst uneinheitlich und Vorlagenwechsel sind nicht auszuschließen. Eine Vorlage, auf die alle dieser Gruppe angehörenden Handschriften zurückgehen, ist nicht zu benennen, sie könnte aber bereits einige der hier mit ‚D‘ markierten Textvarianten enthalten haben, die keiner der anderen Stränge enthält. Dass Dresden, A 50 sowohl die Fortsetzung als auch das ‚Marienleben‘ fehlt, könnte durch das Beenden der Abschrift bei einem scheinbar eigenständig gewählten Kapitel erklärt werden: >Wie Atonias zů hulden kam< (fol. 282r). Wenige Kapitel eher bricht auch Dresden, A 49 die ‚Weltchronik‘ ab: >Wie dauit got sin opfer brahte vnd wie er die werckmeister vs sůchte< (fol. 185v). Darauf folgt in Dresden, A 49 allerdings das ‚Marienleben‘. Möglicherweise wurde dafür auch eine andere Vorlage genutzt. Der Darmstädter Handschrift fehlt nur der Psalter, die Fortsetzung ist vorhanden. Von welcher Vorlage diese abgeschrieben wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. München, Cgm 206 stellt die einzige Handschrift mit Psalter dar, die sicher einer anderen Gruppe zugewiesen werden kann als der um die Zürcher Handschrift. Da sie von der Kunstgeschichte nicht der ‚Lauberwerkstatt‘, dem Kontext, aus dem die übrigen Historienbibeln dieses Stranges stammen, zugeordnet wird (vgl. Bodemann. 2023 [a]), könnte es sich um die Abschrift einer eigenständigen Vorlage handeln. Diese Vorlage müsste aber im Bereich der ‚Weltchronik‘ enger mit der Gruppe um die Dresdener Handschriften verwandt sein.
Üblich ist der Psalter in der Gruppe um die Zürcher Handschrift. Die Historienbibeln dieser Gruppe beinhalten alle vier Textbestandteile. Nur bei der Handschrift Augsburg, 2° Cod. 50, wurde der Psalter ausgelassen, obwohl sie sicher diesem Strang angehört. Da diese Handschrift allerdings nicht wie die übrigen Handschriften dieses Überlieferungsstranges in der ‚Lauberwerkstatt‘ (vgl. Bodemann 2022 [a]) gefertigt wurde, könnte es sich auch hier um eine andere Vorlage handeln als die der Werkstatt.
Die mit ‚A‘ markierten Lesarten dieses Stranges bilden für (beinahe) jedes Textbeispiel die Variante, die in den meisten Handschriften aller Stränge vorkommt. Alle Textgruppen enthalten ‚A‘-Varianten.[^3 Nicht genauer untersucht werden konnte die Londoner Handschrift, deren Näheverhältnis zur Zürcher Gruppe noch zu klären ist.] Es deutet sich also an, dass die Überlieferungsstränge um die Dresdener Handschriften, um München, Cgm 1101 und um Frauenfeld in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Zürcher Überlieferungsstrang stehen. Für die Dresdener Gruppe ist diese Beobachtung aufgrund der komplexen Vorlagensituation, die auch den Textbestand betrifft, nicht näher zu schärfen.
Eine Konkretisierung des Verhältnisses des Zürcher Stranges zum Strang von München, Cgm 1101 und dem von Frauenfeld ist allerdings möglich: Diese beiden Stränge teilen entweder die Lesart ‚A‘ oder sie weichen ab. Diese Abweichungen sind nicht selten Kürzungen, Verballhornungen oder Bezugsfehler von ‚A‘ (vgl. Textstellen 1, 2, 4 und 5). Die Abweichungen von ‚A‘ im Strang um München, Cgm 1101 und Frauenfeld sind voneinander unabhängig. Sie treten niemals im jeweils anderen Überlieferungsstrang auf. Es kann also angenommen werden, dass die beiden Vorlagen, auf die die Stränge um München, Cgm 1101 und Frauenfeld zurückgehen, vom Strang um die Zürcher Handschrift abgeschrieben worden sind.
Der Textbestand der Gruppe um München, Cgm 1101 ist fest: Er beinhaltet die ‚Weltchronik‘, ihre Fortsetzung und das ‚Marienleben‘, aber nicht den Psalter. Der Gruppe um Frauenfeld fehlt das ‚Marienleben‘, sie enthält nur die ‚Weltchronik‘ mit ihrer Fortsetzung. Eine Ausnahme bildet hier die Kölner Handschrift, die das ‚Marienleben‘ enthält. Diese Handschrift bietet wieder ein etwas komplexeres Bild: Auf Blatt 163v wird der Vorlagenstrang gewechselt. Zuvor ist der Text dem Strang um Frauenfeld zuzuordnen, danach dem um München, Cgm 1101. Dieser Wechsel erklärt das Auftreten des ‚Marienlebens‘.
In den Gruppen um Zürich, München, Cgm 1101 und Frauenfeld tritt ein Vorlagenwechsel nur in diesem einen Fall auf. Das legt nahe, dass bereits bei der Anlage der Abschrift der Textbestand geplant und die entsprechende Vorlage gewählt wurde: eine Vorlage der Gruppe um Frauenfeld, um nur den alttestamentarischen Teil (die Prosaauflösung der ‚Weltchronik‘ mit der Fortsetzung) zu erhalten, eine Vorlage der Gruppe um München, Cgm 1101 für das Alte (‚Weltchronik‘ und Fortsetzung) und das Neue Testament (‚Marienleben‘) und eine Vorlage des Stranges um Zürich für beide Testamente und den Psalter. Denkbar wäre, dass diese Zusammenstellungen nach Aufträgen gewählt wurden. Wollte man nun spekulieren, könnte der Kölner Befund durch eine Veränderung des Auftrags erklärbar werden: Eine Vorlage mit Marienleben wurde nötig, nachdem ein großer Teil der Abschrift der ‚Weltchronik‘ bereits nach einer Vorlage der Gruppe um Frauenfeld abgeschlossen war. Sicher sind auch andere Szenarien möglich.
Momentan lässt sich nichts Genaueres zu den Handschriften aus Kopenhagen und Nelahozeves sagen, da beide noch nicht eingesehen werden konnten. Einzelabbildungen der Handschriften, beispielsweise bei Saurma-Jeltsch (vgl. Saurma-Jeltsch 2001: Abb. 115, 260, 314, 320 und Taf. 19 / 2) oder im KdiH (vgl. Bodemann 2022 [b] und vgl. Bodemann 2023 [b]) zeigen auch Textbruchstücke, die für beide Handschriften jeweils mit den Varianten der Gruppe um Zürich übereinstimmen, weshalb sie bis auf Weiteres dieser Gruppe zugeordnet werden sollen.
Abschließend ist festzuhalten, dass für zehn Handschriften (die Gruppen um Zürich außer Kopenhagen und Nelahozeves; sowie die Gruppen um München, Cgm 1101 und Frauenfeld) die Vorlagensituation weitgehend bestimmt werden konnte. Von den der ‚Lauberwerkstatt‘ zugeordneten Handschriften folgen alle der durch die Vorlagen vorgegebenen Textzusammenstellung. Ob Augsburg möglicherweise von einer anderen Vorlage abgeschrieben wurde als die Lauber-Handschriften der Zürcher Gruppe, ist nicht zu sagen. Dies weist darauf hin, dass der Vorlage eine gewisse Verbindlichkeit zugedacht wurde und dass ein willkürliches Kürzen einzelner Textpassagen nicht anzunehmen ist. Dass Überlieferungsstränge aber zum Teil nur aus einer einzigen oder zwei Handschriften bestehen und dass zwischen diesen Strängen solch gravierende Unterschiede im Textbestand herrschen, kann erklären, warum Aussagen über die Textbestände nicht generalisierbar sind. Verallgemeinerungen zum Textbestand können nur einzelne Überlieferungsstränge der Untergruppen betreffen und auch dann sind Ausnahmen möglich.
- Augsburg, Staats- und Stadtbibl., 2° Cod. 50
- Berlin, Staatsbibl., Hdschr. 382
- Bonn, Universitätsbibl., Cod. S 712
- Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl., Hs. 1
- Dresden, Landesbibl., Mscr. A 49
- Dresden, Landesbibl., Mscr. A 50
- Frauenfeld, Kantonsbibl., Cod. Y 19
- Köln, Hist. Archiv der Stadt, Best. 7010 (W) 250
- Kopenhagen, Königl. Bibl., Cod. Thott. 123 2°
- London, British Libr., MS Add. 24917
- Mainz, Stadtbibl., Hs. II 64
- München, Nationalmuseum, Cod. 2502
- München, Staatsbibl., Cgm 1101
- München, Staatsbibl., Cgm 206
- Nelahozeves, Lobkowitzsche Bibl., Cod. VI Ea 5
- Würzburg, Universitätsbibl., M. ch. f. 25
- Zürich, Zentralbibl., Ms. C 5
Editionen
- Ehrismann, Gustav. 1915. Rudolfs von Ems Weltchronik: Aus der Wernigeroder Handschrift. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
- Merzdorf, Theodor. 1870. Die deutschen Historienbibeln des Mittelalters. Nach vierzig Handschriften zum ersten Male herausgegeben, Bd. 2. Tübingen: Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart 101.
Sekundärliteratur
- Bumke, Joachim. 1996. Die vier Fassungen der ‚Nibelungenklage‘: Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte und Textkritik der höfischen Epik im 13. Jahrhundert. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Gerhardt, Christoph. 1983. Historienbibeln. In Ruh, Kurt / Keil, Gundolf / Schröder, Werner / Wachinger, Burghart / Worstbrock, Franz Josef (Hgg.), Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon: Bd. 4: Hildegard von Hürnheim - Koburger, Heinrich. Unveränderte Neuausgabe der 2. Auflage (2010), Sp. 67–75. Berlin, New York: De Gruyter.
- Saurma-Jeltsch, Lieselotte E. 2001. Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung: Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau. Bd. 2. Wiesbaden: Reichert Verlag.
- Vollmer, Hans. 1912. Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters. Bd.1. Ober- und mitteldeutsche Historienbibeln. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
Datenbanken
- Bodemann, Ulrike. 2022 (a). Historienbibeln. Historienbibel IIa. 59.4.1. Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2º Cod 50 (Cim. 74). In Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH). Begonnen von Hella Frühmorgen-Voss und Norbert H. Ott. Hrsg. von Ulrike Bodemann, Kristina Freienhagen-Baumgardt, Norbert H. Ott, Pia Rudolph und Nicola Zotz. Band 7. München 2017. https://kdih.badw.de/datenbank/handschrift/59/4/1; zuletzt geändert am 01.03.2022 (07.09.2023).
- Bodemann, Ulrike. 2022 (b). Historienbibeln. Historienbibel IIa. 59.4.16. Nelahozeves, Lobkovicka knihovna (Schloss Nelahozeves, Bibliothek der Fürsten Lobkowicz), Cod. VI Ea 5. In Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH). Begonnen von Hella Frühmorgen-Voss und Norbert H. Ott. Hrsg. von Ulrike Bodemann, Kristina Freienhagen-Baumgardt, Norbert H. Ott, Pia Rudolph und Nicola Zotz. Band 7. München 2017. https://kdih.badw.de/datenbank/handschrift/59/4/16; zuletzt geändert am 24.01.2022 (07.09.2023).
- Bodemann, Ulrike. 2023 (a). Historienbibeln. Historienbibel IIa. 59.4.12. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 206. In Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH). Begonnen von Hella Frühmorgen-Voss und Norbert H. Ott. Hrsg. von Ulrike Bodemann, Kristina Freienhagen-Baumgardt, Norbert H. Ott, Pia Rudolph und Nicola Zotz. Band 7. München 2017. https://kdih.badw.de/datenbank/handschrift/59/4/12; zuletzt geändert am 19.09.2022 (07.09.2023).
- Bodemann, Ulrike. 2023 (b). Historienbibeln. Historienbibel IIa. 59.4.8. København, Det Kongelige Bibliotek, Thott 123 2º. In Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH). Begonnen von Hella Frühmorgen-Voss und Norbert H. Ott. Hrsg. von Ulrike Bodemann, Kristina Freienhagen-Baumgardt, Norbert H. Ott, Pia Rudolph und Nicola Zotz. Band 7. München 2017. https://kdih.badw.de/datenbank/handschrift/59/4/8; zuletzt geändert am 24.03.2023 (07.09.2023).
- Handschriftencensus. 2023 (a). Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters. Gesamtverzeichnis Werke. https://handschriftencensus.de/werke (07.09.2023).
- Handschriftencensus. 2023 (b). Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters. ‚Historienbibel‘ (Gruppe IIa). https://handschriftencensus.de/werke/6580 (07.09.2023).
- Seibicke, Julia. 2024. Die unterschiedlichen Textbestände der Historienbibel IIa: Ein stemmatischer Erklärungsversuch. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Überlegungen zur Poetik des Prosa-‚Tristrant‘
Überlegungen zur Poetik des Prosa-‚Tristrant‘ (1484)[^* Der vorliegende Beitrag widmet sich der Vorstellung der im September 2023 an der Universität Leipzig eingereichten Masterarbeit.]
Einleitung
Wie entfalten Erzähltexte eigentlich Sinn? Falls die in dieser Frage enthaltenen Prämissen nicht rundheraus abgelehnt werden, wird die erste Antwort wohl lauten: In der Regel durch das, was erzählt wird. Wenn uns Erzählungen etwas zeigen, dann dadurch, dass sie Handlungskonstellationen erproben, Konflikte durchspielen, Modelle entwickeln, kurz: mögliche Welten darstellen. Erzähltexte sind, so verstanden, dann besonders wirksam, wenn sie einen möglichst bruchlosen Übergang zwischen Text- und Darstellungsebene simulieren, wenn die Sprache also nicht zu sehr als Sprache erfahren wird. Moritz Baßler hat in mehreren Studien herausgearbeitet, wie sich diese realistische Erzählweise zum narrativen default-Modus der Gegenwart herausgebildet hat (vgl. Baßler 2014; Baßler 2015). Dass vor allem der Inhalt von Erzähltexten als relevant angesehen wird, werde etwa deutlich, wenn man aktuelle Jurybegründungen der wichtigen Literaturpreise betrachtet. Selten sind es die komplexen Erzählstrukturen, ist es die Selbstreflexivität oder die avancierte Sprache, die herausgehoben werden; zumeist ist der Gegenwartsbezug, ist es die Thematisierung relevanter Diskurse, die preiswürdig erscheinen (vgl. Baßler 2022: 224–227).
Man könnte aus kulturanthropologischer Perspektive argumentieren, dass in dieser Möglichkeit zur mimesis tatsächlich das Skandalon der Erzählung liegt. Doch dieser Schluss könnte vorschnell sein – denn das, was in diesem eben geschilderten Sinne als realistische Erzählung aufgefasst werden kann, ist in diachroner Betrachtung keineswegs selbstverständlich. Der direkte Übergang von der sprachlichen Ebene zur Ebene der Darstellung, dieser effet de réel (vgl. Barthes 1968), verdankt sich im Gegenteil selbst einer hochartifiziellen literarischen Strategie mit einem bestimmten zeitlichen Index; es gibt und gab neben ihr andere Arten der narrativen Sinnbildung. Insbesondere ab der Klassischen Moderne um 1900 wurde der Übergang von der Text- zur Darstellungsebene in der Literatur selbst thematisch, hier hat sich Literatur autoreflexiv mit ihren eigenen Möglichkeiten auseinandergesetzt und ihre Grenzen ausgelotet. Doch auch bereits das deutschsprachige Mittelalter kannte andere Arten der narrativen Sinnbildung.
Um dies einsichtig zu machen, werde ich zunächst erläutern, was ich
unter literarischem Sinn bzw. literarischer Bedeutung verstehe und
wie ich eine Untersuchung der Evokation von Bedeutung oder Sinn
konzeptionalisieren möchte. In einem zweiten Schritt zeige ich
anhand einer mittelalterlichen Erzählung, wie sich die Art der
narrativen Sinnbildung textgeschichtlich verändern kann. Ich wähle
dafür die Erzählung von Tristan und Isolde, die einer der
prägendsten Stoffe nicht nur des deutschsprachigen Mittelalters war.
Gegenstand meiner Untersuchung ist dabei aber nicht der berühmte
‚Tristan‘-Roman Gottfrieds von Straßburg, sondern jene Version, die
den Stoff zuerst in deutscher Sprache umgesetzt hat: Es handelt sich
um den ‚Tristrant‘, den ein sonst unbekannter Dichter namens Eilhart
von Oberg entweder um 1170 oder 1190 verfasst hat und dessen
älteste, leider nur fragmentarische Textzeugen derzeit in der Bibl.
Jagiellońska verwahrt werden (vgl. Handschriftencensus 2024; Wolff /
Schröder 1980: 412).
Dieser ‚Tristrant‘-Roman wurde im 15.
Jahrhundert vom Vers in die Prosa umgesetzt und gelangte in dieser
Form 1484 in der Augsburger Offizin Anton Sorgs in den Druck (vgl.
Gesamtverzeichnis der Wiegendrucke 2024 [GW 12819]; Schmid 1995:
1065).
Zum Begriff des literarischen Sinns
Zunächst zur Frage des literarischen Sinns. Ich beginne mit einer terminologischen Klärung: Mit literarischer Bedeutung meine ich die einzelne figurative, also metaphorische, symbolische, allegorische oder metonymische Bedeutung innerhalb eines literarischen Werks. Literarischer Sinn meint demgegenüber gleichsam den Bedeutungsrahmen, die Gesamtbedeutung, auf die hin die einzelnen bedeutungstragenden Elemente angeordnet sind. Der literarische Sinn ergibt sich aus dem Werk, ist aber selbst nicht aussageförmig verfasst, lässt sich also nicht paraphrasieren oder übersetzen. Der Sinn besteht also, ich folge hierin Jan Urbich, „in der Arbeit bzw. dem Geschehen seiner Rekonstruktion, indem über die primären lexikalischen und kontextuellen Bedeutungen von Ausdrücken, Sätzen und Satzzusammenhängen zu den formensprachlichen wie kulturellen Bedeutungszusammenhängen fortgeschritten wird“ (Urbich 2011: 100).
Der zentrale Unterschied zu gängigen linguistischen Bedeutungsbegriffen liegt mithin darin, dass sich mein Verständnis von Sinn nicht in der Rekonstruktion einer Proposition erschöpft, sondern sich erst aus dem Nachvollzug der formalen Gestaltung des Textes erschließt. Der kanonische Begriff für diese Art der literarischen Sinnbildung stammt von Jurij M. Lotman, es ist der des „sekundären modellbildenden Systems“. Er meint, dass in literarischen Texten die Art und Weise der Aussage nicht wie in alltagssprachlichen Kontexten zugunsten eines Bedeutungsgehalts zurücktritt, sondern selbst Teil der Aussage wird: „Die Zeichenelemente im System der natürlichen Sprache: Phoneme und Morpheme – geraten in Reihen gewisser geordneter Wiederholungen, werden dadurch semantisiert und treten nun ihrerseits als Zeichen auf“ (Lotman 1972: 41). Aus diesem Strukturmerkmal erklärt sich auch, warum Interpretationen stets Stückwerk bleiben müssen: Anders als in normalsprachlichen Aussagen kann in Literatur nie entschieden werden, was Zeichen ist und was nicht, was also in den Prozess der Semiose eingeht und was bloßes Material bleibt. Dies gilt indes nicht allein für phonetische, morphologische oder syntaktische Textmomente, sondern übergreifender auch für die literarische Form. In literarischen Texten kann also auch die Makrostruktur semantisiert werden.
Ich halte fest: Der Sinn eines Textes ergibt sich (auch) aus der formalen Struktur des Textganzen und lässt sich in Interpretationen, wenn auch stets nur vorläufig, formulieren. Mir geht es jedoch nicht um Interpretationen, sondern vorgelagert um die Art der Sinnbildung. Dies sei abermals anhand der eingangs formulierten Überlegungen geschildert: Warum entwickelt sich der Sinn in realistischen Texten vor allem auf der Ebene der Diegese, also der Handlungswelt? Es liegt daran, dass der Übergang von der Ebene des Textes zur Ebene der Darstellung so weit kulturell etablierten Mustern gehorcht, dass er selbst nicht weiter auffällt. Die Brisanz liegt also in der Handlung und nicht bereits auf der Ebene der Sprache. In expressionistischen Texten etwa ist es aber natürlich anders: Hier entfaltet sich der Sinn bereits zwischen Text und Darstellungsebene; es ist oft genug nicht einmal möglich, eine bestimmte Diegese zu rekonstruieren.
Moritz Baßler, dem ich diese verfahrensanalytischen Überlegungen verdanke, präzisiert noch weiter. Mit Roman Jakobson unterscheidet er zwischen metonymischen und metaphorischen Schreibweisen (vgl. Baßler 2015: 19–30). Die Metonymie bezeichnet in der Rhetorik die Verschiebungstrope; ein Begriff wird also durch einen semantisch verwandten Begriff ausgedrückt. Wenn in einem Erzähltext zum Beispiel von einem Weihnachtsfest die Rede ist, dann ist damit ein kulturell etablierter Frame aufgerufen, zu dem Weihnachtsbäume, Kirchgänge und Gänsebraten gehören. Es müssen nicht alle Aspekte dieses Frames geschildert werden, da wir über das Wissen verfügen, um fehlende Details ergänzen zu können. Eine metonymische Textur empfinden wir somit als realistisch: Es werden etablierte Codes verwendet, die den Übergang zur Diegese unproblematisch werden lassen. Beim metaphorischen Verfahren verhält es sich anders. Die Metapher beruht nicht auf der Kontiguität zweier Begriffe, sondern bezieht als Sprungtrope zwei distinkte Codes aufeinander. Hier ist interpretatorische Leistung gefragt: Was verbindet die beiden Codes miteinander, wie lässt sich aus den disparaten Vorstellungswelten eine konsistente konstruieren? Baßler beschränkt sich bei seiner Untersuchung auf den Zeitraum zwischen 1850 und 1950; ich glaube aber, dass man eine solche Verfahrensgeschichte auch auf die Literatur des Mittelalters ausdehnen kann. Das methodische Inventar muss dafür aber natürlich angepasst werden.
Sinnbildung im ‚Tristrant‘ Eilharts von Oberg und der Prosaauflösung
Betrachten wir also den ‚Tristrant‘-Roman Eilharts von Oberg. Wir haben einen Text vor uns, der uns überfordert, indem er unseren Versuch zur Ebene der Diegese zu gelangen, unterminiert. Die Schwierigkeit liegt hier aber nicht wie im modernen Grenztext darin, die Sprachebene zu verlassen. Die Formulierungen kommen uns nicht dunkel vor; die Sprache ist zwar auch spröde, nicht aber aufgrund eines metaphorischen Verfahrens unverständlich. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die verschiedenen Momente der Darstellung sich nicht so recht zu einer kausallogisch organisierten Handlungswelt fügen möchten. Die Handlung des Romans zerfällt vielmehr in mehrere Episoden, deren innerer Zusammenhang sich nicht im Rückgriff auf unser alltagsweltliches Wissen erschließt. Wie kann man mit diesem Befund umgehen? Die Forschung hält dafür im Wesentlichen drei Antwortmöglichkeiten bereit. Die erste und radikalste verneint den Zusammenhang der verschiedenen Episoden rundheraus. Wir haben es demnach nicht mit einem konstruierten Ganzen zu tun, das Kohärenzkriterien erfüllen muss und im oben entwickelten Verständnis tatsächlich Sinn entfalten könnte. Das, was sich uns als Textganzes präsentiert, ist vielmehr Ergebnis medien- oder überlieferungsgeschichtlicher Prozesse, ist also beispielsweise einer diskontinuierlichen Vortragssituation geschuldet (vgl. Haug 1995; Ruh 1980: 224; instruktiv – wenn auch in Bezug auf das ‚Nibelungenlied‘ – Heinzle 2014: 149–164). Diese Erklärung ist meines Erachtens jedoch nicht überzeugend. Sie mag zwar erklären können, wie der Text sich im Laufe verschiedener Bearbeitungsstufen zu dem entwickelt hat, was er ist; er wird aber anschließend weiter kopiert und gelesen, er findet Eingang ins Medium Buch und präsentiert sich so wie selbstverständlich als Ganzes. Also zur zweiten Erklärungsoption. Sie besagt, dass die Verbindung zwischen den einzelnen Episoden und Handlungsmomenten letztlich doch gemäß einem metonymischen Verfahren geschieht, nur dass sich uns die Frames nicht mehr unmittelbar erschließen (vgl. Hübner 2013; Hübner 2015). Leerstellen werden also hier, ganz so wie im realistischen Roman, selbstverständlich durch alltagsweltliches Wissen gefüllt. Diese Erklärung mag zwar im Einzelnen zutreffen, scheint mir die Eigenart des Eilhart-Textes aber doch zu verkennen. Zwar können wir nicht wissen, wie zeitgenössische Leser oder Zuhörer den Eilhart-Text verstanden haben, es gibt aber im bedeutenden ‚Tristan‘-Roman Gottfrieds eine Stelle, in der sich der Erzähler über die fehlende Motivation in vorangegangenen Texten mit dem gleichen Stoff mokiert:
Si lesent an Tristande,
daz ein swalwe z’Îrlande
von Curnewâle kæme,
ein vrouwen hâr dâ næme
z’ir bûwe und z’ir geniste
(ine weiz, wâ si’z dâ wiste)
und vuorte daz wider über sê.
genistet ie kein swalwe mê
mit solhem ungemache,
sô vil sô si bûsache
bî ir in dem lande vant,
daz si über mer in vremediu lant
nâch ir bûgeræte streich?
weizgot, hie spellet sich der leich,
hie lispet daz mære
(Gottfried von Straßburg: ‚Tristan‘, V. 8601–8615).
‚Man erzählt in Tristan-Geschichten, daß eine Schwalbe in Cornwall nach Irland geflogen sei und sich da ein Frauenhaar zum Nestbau aufgepickt und übers Meer hergebracht habe – ich weiß nicht, woher sie davon wissen konnte. Hätte je eine Schwalbe sich so mühselig ihr Nest gebaut, daß sie über das Meer in ein fremdes Land nach Nistzeug geflogen wäre, wo sie doch so viel Baumaterial im eigenen Lande finden konnte? Bei Gott, hier werden Lügen erzählt, hier redet die Geschichte wirr.‘
(Gottfried von Straßburg 2011: 483–485; Übers. v. Walter Haug).
An dieser Invektive Gottfrieds gegen frühere Tristan-Versionen zeigt sich, dass durchaus ein Mangel an kausallogischer Verknüpfung einzelner Handlungsmomente empfunden wurde, dass mithin zumindest nicht alle Leerstellen durch historisches Handlungswissen gefüllt werden konnten. Es könnte zwar nun argumentiert werden, dass Eilhart seiner Stoffvorgabe schlicht nicht gewachsen war, doch erklärt dies abermals nicht, wieso in den späteren Redaktionen des Eilhart-Texts nicht umgearbeitet wurde oder explizierende Einordnungen vorgenommen wurden. Es muss also eine Erklärung für die Poetik des Textes gefunden werden, die die Bruchstellen nicht vorschnell als kontingent abtut, sondern sie als signifikant ernst nimmt. Diesem Anspruch will die dritte Option gerecht werden. Hier wird angenommen, dass die Erzählung anderen Verknüpfungsgesetzen folgt, als es in modernen realistischen Erzählungen der Fall ist. Die historische Narratologie hat verschiedene Vorschläge gemacht, um diese andere Verknüpfungsweise zu erklären, wobei das Modell des ‚künstlichen Erzählens‘ von Cordula Kropik besonders informativ ist (vgl. Kropik 2018). Es besagt, stark verkürzt, dass die verschiedenen Teile der Erzählung dahingehend verknüpft sind, dass sie ein gemeinsames Thema verhandeln. Die spezifische Anordnung dieser verschiedenen Teile ermöglicht es, das Thema gleichsam wie in einer Argumentation nachzuvollziehen, wobei auf eine artifizielle Weise verschiedene Verfahren von Wiederholungen und Variationen eingesetzt werden. Es leuchtet nun ein, warum es sich bei diesem ‚künstlichen Erzählen‘ abermals um ein metaphorisches Verfahren handelt. Auch hier müssen verschiedene disparate Frames miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der Sinn entfaltet sich jedoch oberhalb der Sprachebene: Die metaphorische Verknüpfung findet nun auf der Darstellungsebene statt. Es muss interpretativ erfasst werden, welches Thema die einzelnen Teile der Erzählung zusammenhält und wie sie in ihrer internen Koordination Sinn entfalten.
Da es mir jedoch nicht um eine semiotische Reformulierung von Kropiks Gedanken, sondern um Überlegungen zur Dynamik literarischer Verfahren im Mittelalter geht, wende ich meinen Blick nun auf die Prosaversion von Eilharts Text, die im 15. Jahrhundert entsteht und bis ins 17. Jahrhundert in mindestens 13 Redaktionen gedruckt wurde (vgl. Schmid 1995: 1065). Zunächst zur groben Phänomenologie des Bearbeitungsprozesses dieses Textes. Die Prosaversion des Spätmittelalters hält sich, was die Handlung betrifft, streng an die frühhöfische Vorlage; die maßgebliche Bearbeitungsleistung scheint auf den ersten Blick in der Umsetzung in ungebundene Rede zu liegen. Doch der genauere Blick fördert mehr zu Tage: Der Prosaroman bemüht sich beinah pedantisch um Motivierung des Geschehens (vgl. bereits Kröhl 1930: 18–23). Was dem Bearbeiter nicht klar genug erschien, reicht er durch einordnende und erklärende Erzählerkommentare nach. Die Brisanz der Ehebruchsgeschichte wird so zum Beispiel an zeitgenössischen Rechtsvorstellungen gemessen, die Liebe zwischen Tristrant und Isalde wird psychologisch plausibel ausgedeutet (vgl. Plate 1977). Während bei Eilhart beispielsweise auf handlungsweltlicher Ebene unklar bleibt, warum Tristrant auch dann noch in mehreren Rückkehrabenteuern die Nähe zu Isalde suchen muss, wenn die Wirkung des Liebestranks längst verloschen ist, entwickelt der Prosaist eine Theorie, der zufolge sich die Liebenden während der Dauer der Trankwirkung so sehr aneinander gewöhnt hätten, dass sie auch fürderhin nicht voneinander lassen können. Man könnte mit den eben entwickelten Begriffen sagen, dass der Prosaroman eine Metonymisierung anstrebt: Er ist darum bemüht, sich andeutende Framebrüche zu kitten und den Übergang zur Diegese auf diese Weise unproblematisch werden zu lassen. Neben den expliziten Motivierungen sind es vor allem zwei weitere Metonymisierungsstrategien, derer sich der Prosaist bedient: Bewusstseinsdarstellungen und die Vorführung einer empfohlenen Rezeption durch das Hervortreten der Erzählinstanz. In meiner Masterarbeit gehe ich der poetologischen Relevanz dieser Strategien, die ich hier nur streifen konnte, weiter nach.
Ich fasse zusammen: Obwohl sich die handlungstragenden Elemente des Eilhart-Texts beinah sämtlich auch im Prosaroman finden, ist hier doch etwas grundsätzlich anders. Es geht nicht mehr um die Gedankenbewegung über ein Thema, sondern um die Evokation einer konsistenten Diegese, innerhalb derer der Text seinen Sinn entfalten kann. Wie gesagt, die Eigenleistung des Prosaisten ist nicht allzu umfänglich; und doch scheinen mir die Bearbeitungstendenzen auf eine kategoriale Veränderung im Sinnbildungstyp hinzuweisen: Aus dem künstlich motivierten Versroman wird eine Prosageschichte, deren Reiz im affektiven Mitfühlen liegt.
Primärliteratur
- [Eilhart von Oberg]. 1877. Eilhart von Oberge, hg. Franz Lichtenstein. Straßburg: Trübner.
- Gottfried von Straßburg. 2011. Tristan und Isold, hg. Walter Haug / Manfred Günter Scholz. Berlin: Deutscher Klassiker Verlag.
- Tristrant und Isalde: Prosaroman, hg. Alois Brandstetter. Tübingen: Niemeyer.
Sekundärliteratur
- Barthes, Roland. 1968. L’Effet de Réel. Communications 11. 84–89.
- Baßler, Moritz. 2014. Prolegomena zu einer Verfahrensgeschichte deutscher Erzählprosa 1850–1950. In Buschmeier, Matthias / Erhart, Walter / Kauffmann, Kai (Hg.), Literaturgeschichte: Theorien – Modelle – Praktiken, 231–245. Berlin / Boston: De Gruyter.
- Baßler, Moritz. 2015. Deutsche Erzählprosa 1850–1950: Eine Geschichte literarischer Verfahren. Berlin: Erich Schmidt.
- Baßler, Moritz. 2022. Populärer Realismus: Vom International Style gegenwärtigen Erzählens. München: C.H. Beck.
- Gesamtverzeichnis der Wiegendrucke. 2024. 12819 Historia. Tristan. Tristrant und Isalde. Augsburg: Anton Sorg, 1484. 4°. https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/docs/GW12819.htm (30.01.2024).
- Handschriftencensus. 2024. Eilhart von Oberg: ‚Tristrant‘. https://handschriftencensus.de/werke/98 (30.01.2024).
- Haug, Walter. 1995. Der ‚Tristan‘ – eine interarthurische Lektüre. In Haug, Walter, Brechungen auf dem Weg zur Individualität: Kleine Schriften zur Literatur des Mittelalters, 184–196. Tübingen: Max Niemeyer.
- Heinzle, Joachim. 2014. Traditionelles Erzählen: Beiträge zum Verständnis von Nibelungensage und Nibelungenlied. Stuttgart: S. Hirzel.
- Hübner, Gert. 2013. Rez. zu Armin Schulz: Erzähltheorie in mediävistischer Perspektive. ZfdPh 2 (2013). 445–450.
- Hübner Gert. 2015. Historische Narratologie und mittelalterlich-frühneuzeitliches Erzählen. LJB 56. 11–54.
- Kröhl, Günther. 1930. Die Entstehung des Prosaromans von Tristrant und Isalde. Göttingen: Gebrüder Müller.
- Kropik, Cordula. 2018. Gemachte Welten: Form und Sinn im Höfischen Roman. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Lotman, Jurij M. 1972. Die Struktur literarischer Texte, übers. v. Rolf-Dietrich Keil. München: Fink.
- Plate, Bernward. 1977. Verstehensprinzipien im Prosa-Tristrant von 1484. In Kaiser, Gert (Hg.), Literatur, Publikum, historischer Kontext, 79–89. Bern / Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Ruh, Kurt. 1980. Höfische Epik des deutschen Mittelalters. Zweiter Teil: ‚Reinhart Fuchs‘, ‚Lanzelet‘, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg. Berlin: Erich Schmidt.
- Schmid, Elisabeth. 1995. Art. ‚Tristrant und Isalde‘ (‚Histori von Tristrant und Ysalden‘). In Ruh, Kurt et al. (Hg.), Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon, Bd. 9, 1065–1068. Berlin / New York: De Gruyter.
- Urbich, Jan. 2011. Literarische Ästhetik. Köln / Weimar / Wien: Böhlau.
- Wolff, Ludwig / Schröder, Werner. 1980. Art. ‚Eilhart von Oberg‘. In Ruh, Kurt et al. (Hg.), Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon, Bd. 2, 410–418. Berlin / New York: De Gruyter.
- Krabi, Richard. 2024. Überlegungen zur Poetik des Prosa-‚Tristrant‘ (1484). In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Hierarchiedynamik im ‚Salomon und Markolf‘
Hierarchiedynamik im ‚Salomon und Markolf‘[^* Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Seminars „Salomon und Markolf“ bei Prof. Dr. Sabine Griese und in der Auseinandersetzung mit der Vorlesungsreihe „Figuren des Widerstands“. Die Ausarbeitung des Hierarchiegedankens beruht auf den tiefgründigen und spannenden Diskussionen des Seminars, in welchem die Widerständigkeit Markolfs aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wurde. ]
1.
Dynamik und Statik sind Gegensätze. Während der eine Begriff einen festen, klaren, zeitlich wie räumlich unveränderten Zustand beschreibt, steht die Dynamik sinnbildlich für die Begriffsbilder Bewegung, Fluss, Veränderung. Dynamik beschreibt somit eine zeitliche Veränderung eines Zustandes. Wendet man dies auf einen Text an, können Veränderungen in einem spezifischen Bereich dadurch genau beschrieben werden.
Der Bereich, der dynamisch betrachtet werden soll, ist in diesem Vortrag die Hierarchie im Spruchgedicht ‚Salomon und Markolf‘. Die Entstehung dieses Komplexes ist ins 12. und 13. Jahrhundert rückverfolgbar (vgl. Griese 1999: 3) Die vorliegende und genutzte Textausgabe (Hartmann 1934) beruht auf handschriftlichen Textzeugen des 15. Jahrhunderts.
2.
Nicht nur überzeugte Fans von mittelalterlich angehauchten Serien wie ‚Game of Thrones‘, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Teil der Menschen haben ein Bild vor Augen, wenn über Konventionen und Rituale einer längst vergangenen – und doch in vielerlei Hinsicht noch sehr aktuellen – Zeit gesprochen wird: dem Mittelalter der Könige, Ritter, der Kirche und der Mönchsorden, der Fehden, der Burgen, der Handschriften auf Pergament oder auf Papier mit Wasserzeichen. Konventionen und Rituale, die sich häufig in fest ablaufenden Mustern zeigen.
Das Herantreten an eine Person mit Macht, wie es beispielsweise häufig ein König sein könnte, sei es der große Artus selbst oder der biblische Salomo, ist auch bis heute nur im Zusammenspiel mit einer Haltung der humilitas (der Demut) zu denken. Die Hierarchie ‚schwingt‘ nicht nur mit, sie bildet das Fundament von Konventionen. Konventionen, die sich in Anbetracht der heutigen Zeit zwar verändert haben, aber bei weitem nicht gänzlich verschwunden sind. Der Text versucht, anhand des Hierarchiebegriffs in der Einhaltung bzw. der expliziten Widersetzung gegenüber Konventionen Veränderungen in der wahrgenommenen Stellung der Akteure zu beobachten.
Gerd Althoff schreibt in seinem Buch ‚Die Macht der Rituale‘: „Im Bereich der mittelalterlichen Herrschaftsordnungen wurde die öffentliche Kommunikation von ritualisierten Formen des Umgangs untereinander geprägt“ (Althoff 2013: 199). Er geht sogar noch weiter: „Dieser Zwang zur Konformität des Verhaltens, der deshalb geradezu permanent gegeben war, war nur zu durchbrechen, wenn man sich dazu entschloss, fern zu bleiben oder zu stören.“ (ebd.)
3.
In unserem Spruchgedicht von Salomon und Markolf geht es um einen, der sich für das Stören entschieden hat, einen Störenfried, der sich dem Zwang zur Konformität widersetzt, der Bewegung in das statische Hierarchiegefälle bringt, eine Figur, die als Katalysator Herrschaftsdynamik herbeiführt. Dabei ist der Herausgeforderte nicht nur eine Randnotiz der menschlichen Geschichte. Der Herausgeforderte ist der biblische König Salomo, Sohn Davids, der Herrscher Israels über 40 Jahre, Erbauer des Tempels in Jerusalem, in unzähligen Kunstwerken als weiser und reicher Herrscher dargestellt.[^1 An dieser Stelle sei auf den Beitrag „Eine Autorität gerät ins Wanken“ von Prof. Sabine Griese hingewiesen, erschienen in „Die Bibel in der Kunst“ (2017), welcher König Salomo nicht nur als Herausgeforderten betrachtet, sondern regelrecht dessen Straucheln in der Auseinandersetzung mit Markolf darstellt, einer Figur der ständigen Provokation.] Sollte diese Aufzählung die Besonderheit dieses Herrschers noch nicht ausdrücklich gezeigt haben, steht im Alten Testament, dass der König Salomo mit einer solch großen Weisheit ausgestattet gewesen ist, dass kein Mensch vor oder nach ihm eine Weisheit gleichen Ausmaßes aufweisen kann. Im Ersten Buch der Könige spricht Gott zu Salomo: „Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird“ (1.Könige 3,12). All das ist tausende Jahre her und doch sollte angemerkt werden, dass auch in Krakau ein salomonischer Geist weiterhin weht. Zwischen dem Wawel und der Remuh-Synagoge liegt ein Vier-Sterne-Hotel, welches den Namen des eben erwähnten Königs trägt.
Dem mittelalterlichen Leser und vor allem dem mittelalterlichen Hörer ist der biblische König Salomo weit besser bekannt als uns heute. Somit ist es keineswegs verwunderlich, dass die Einführung der einen von zwei Figuren, von denen heute die Rede sein wird, kurz und knapp gehalten wird.
Hie vor ein richer herre was,
der gar geweldeclich besaz
in Israel des riches kron:
der was geheizen Salomon.
Er drug die kron bi sinen jaren.
Vil lande ime underdenig waren. (V. 19–24)
Innerhalb von sechs Versen wird der mächtigste König seiner Zeit eingeführt. Mehr werden auch nicht benötigt, da jedem klar ist, um wen es sich handelt. Mit der Erwähnung des Königs Salomo und seiner eindeutigen Bestimmung durch die Verortung als König von Israel wird auf ein Frame rekurriert, welches den mittelalterlichen Christen einen großen Deutungsspielraum gibt.
Salomo ist ein König, dessen Weisheit ein literarisch interessantes Vakuum neben sich schafft. König Saul besaß Samuel, König David Nathan als Richtungsweiser an expliziten Kreuzungen des Lebens. König Salomo kann eine solche Person nicht aufweisen. Belesene Personen würden eventuell auf die Königin von Saba hinweisen, diese greift aber in der biblischen Tradition nicht aktiv in die Lebensweise Salomos ein. Ein König, dessen Weisheit einmalig auf Erden ist und der trotzdem Gott immer stärker den Rücken kehrt, dabei aber niemanden hat, der ihn zurechtweisen kann, ist aus literarischer Perspektive eine Goldgrube (1. Könige 11, 4-13). Das Vakuum wird gefüllt mit einer Figur, die scheinbar in jeder Hinsicht dem König diametral entgegengesetzt werden kann.
4.
Nahezu das Achtfache an Beschreibung erhält Salomos Gegenspieler Markolf, als er am Anfang der Dichtung am Hofe Salomos mit seiner Frau auftritt. Dabei wurde aus Kulanz auf das Addieren der Stellen, an welcher alleine Markolfs Frau in zutiefst unkonventioneller, alle Grenzen der Höflichkeit sprengender, geradezu bösartiger und ekelhafter Manier beschrieben wird, verzichtet. Dabei wird kein Blatt vor den Mund genommen, keine Übertretung der Gürtellinie gescheut, jedwede Konventionen einer ‚Belletristik‘ über Bord geworfen.
Sine augen glichten wol dem struzen
Ein alt hengst von zwenzig muzen
enhette nit so lange zende;
korze finger, dicke hende,
die waren uzer mazen swarz. (V. 45–49)
Es würde gedacht werden, wenn der Erzähler es selbst nicht so vortrefflich auf den Punkt gebracht hätte: Sie waren iemerlich gestalt (V. 71).
Jämmerliche Gestalten, die am Hof auffallen, die für ein aufsehenerregendes Momentum sorgen. Dieses Gefühl, dass beide, Markolf und seine Frau, am falschen Ort sind, wird vor allem durch den Hierarchieabstand verstärkt. Es ist nicht irgendein Hof. Es ist der Hof des Königs Salomo. Und an eben diesen Hof kommen die hässlichsten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Jeder Tiervergleich scheint angebracht, um diese Gestalten bildhaft greifen zu können, um sie in der Hierarchie ganz unten einzuordnen, tiefer noch als die Grenze der Menschheit es erlaubt.
5.
Die Hierarchie, welche an diesem Punkt den größten Abstand zwischen den beiden (Gegen-) Spielern beträgt, lässt sich an Gegenpaaren gut verdeutlichen, wobei die Darstellungen Markolfs dem Text entnommen sind, die Gegendarstellung Salomos hingegen auf den Grundkenntnissen der Hörerinnen und Hörer beruht: schwarz – weiß, dreckig – sauber, ekelerregend – rein, triebgesteuert – höflich / kontrolliert, arm – reich.
Man gerät in die Versuchung, diese Liste der Antonyme auszubauen, neigt sogar dazu, den Gegensatz dümmlich – klug aufzustellen, stolpert aber über die Eigenschaft Markolfs, gut klaffen (V. 86) zu können. Diese Gestalt – mehr Tier als Mensch – kann anscheinend ihr Maul aufreißen, sie kann sich artikulieren. Durch diese Information verringert sich der Abstand der Hierarchie um Haaresbreite – die bei Markolf dicker ausfallen dürfte als der höfische Durchschnitt. Es entsteht Dynamik in der Hierarchie.
In einem weiteren überzeugenden Beitrag von Althoff wird der schwierige Weg zum Ohr des Königs analysiert. Nur durch gratia oder über familiaritas war es möglich, in die unmittelbare Nähe des Königs zu kommen und den „Austausch“ zu finden (vgl. Althoff 2014: 197). Markolf benötigt beides nicht, zu versteinert scheint das Gefolge am Hof beim Anblick der beiden zu sein, zu widersprüchlich wirkt das Aussehen im Gegensatz zum deutlich erkennbaren Stolz des Bauern. Der Stolz Markolfs bzw. das Zutrauen dieses Bauern ermöglichen erst den Austausch zwischen zwei Welten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. In salomonischer Manier übersieht der König das Aussehen und fordert Markolf erstmal auf, sich mit Namen und familiärer Herkunft auszuweisen. Versetzt man sich für einen Moment in die Rolle Markolfs und überlegt, wie man sich im besten Licht und in der Hoffnung auf ein offenes Ohr einem König vorstellen würde, ergibt die eigene Vorstellung des Handelns eine diametral entgegengesetzte Form zu der Art, wie Markolf sich präsentiert.
Er (Markolf) sprach: Du salt sagen an,
wer was din fader oder din an,
oder wan kommet dir diz geval,
daz man dich fochtet uber al? (V.123–126)
Markolf forciert Augenhöhe, er sprengt die festgelegte Hierarchie. Er leistet Ungehorsam, fordert den König Salomo heraus. Es birgt eine politische Sprengkraft, wenn der ungebetene Gast am Hof den Hausherren, der nebenbei König von Israel ist, auffordert, sich auszuweisen. Entgegen der Erwartung ist die bäuerliche Herkunft eine Tatsache, auf die er stolz ist.
Ich bin von den geburen.
Der ir swerte sulde schuren,
er endede iz nit in eime jare. (V.141–143)
6.
Innerhalb weniger Verse kippt die Hierarchie nahezu, da sich Markolf in großen Schritten der hierarchischen Höhe des Königs nähert. Einzig und allein die Ruhe des Königs, sein sichtbares Interesse an dieser merkwürdigen Figur, seine durch Prägnanz und Ausgeglichenheit geprägte Haltung bewahrt im Sinne der Dynamik das Kippen der Hierarchie. König Salomo bleibt vorerst unantastbar, so sehr dieser merkwürdig schlaue Bauer auch rebelliert. Die Hierarchie wird aber auch von Salomo deutlich ausgesprochen, indem er Markolf zum reichen Mann machen möchte, wenn dieser seine Fragen beantworten kann. Es gibt einen Geber und es gibt einen Nehmer und somit auch ein Gefälle.
Diese Hierarchieaussage, welche von Salomo ausgesprochen wird, hindert Markolf nicht, provokant den ‚schlechter sprechenden‘ der beiden aufzufordern, mit dem ‚Disputieren‘ zu beginnen. Dabei steht es für Markolf außer Frage, dass Salomo der ist, welcher schlechter diskutiert.
Der ubel singet, der singe an!
Also du du und kom dar van! (V. 175–176)
Der Spruchstreit, welcher durch die provokante Aufforderung des Markolf beginnt, als Stichomythie über mehrere hundert Verse verfasst, ist von zwei sich scheinbar widersprechenden Eigenschaften geprägt. Auf eine salomonische Aussage, welche häufig auch im Wortlaut auf das Alte Testament (vielfach auf die Sprüche) rekurriert, folgt eine bauernschlaue, im Normalfall unter der Gürtellinie angelegte Antwort. Markolfs Antworten wirken vulgär, gefährlich und unangebracht. Dennoch treffen sich die beiden Aussagen häufig, da Markolf auf seine Art die Aussage des Salomo deutet, umdeutet und häufig auch umkehrt. Der Sprachgebrauch des einen ist geprägt von moralischen Begriffen und Ideen, von der guten, höfischen Art zu leben, während der Sprachgebrauch des anderen geprägt vom bäuerlichen Leben, von den alltäglichen Arbeiten und den Misthaufen, mit denen man zu tun hat, geprägt ist. Zwei sehr unterschiedliche Begriffswelten treffen aufeinander und behandeln im Kern häufig das gleiche Thema. Dabei ist die beeindruckende Leistung des Markolf, zum einen dem König auf Augenhöhe zu begegnen trotz der unterschiedlich erzeugten Bilder, zum anderen führen Markolfs Aussagen häufig die von Salomon ausgesprochenen Ideale in die reale Welt ein. Markolf zeigt im Vergleich mit Salomo Lebensnähe, zugleich aber auch Witz, Intelligenz und eine zügellose Direktheit. Auf verschiedensten Ebenen kann dieser Spruchstreit auch als Widerstand gegen den Souverän gelesen werden. Ein Beispiel für einen Wortwechsel zwischen den beiden (Gegen-)Spielern ist folgender:
Sal. Win brenget unkuscheit:
Wer drunken ist, der stiftet leit.
Mar. Den armen machet rich der win.
Des solde er alle zit drunken sin. (V. 249–252)
Markolf besiegt Salomo im Spruchstreit und dieser belohnt ihn dafür. Meiner Ansicht nach ist die Hierarchie am Ende dieses ersten Teiles noch immer nicht gekippt, da Salomo seiner Position und Rolle treu bleibt. Erst in späteren Momenten der Handlung wirkt der König immer gereizter, er wird unruhig, lässt sich von Markolf immer wieder herausfordern und verliert an Ansehen. Er droht Markolf häufig mit dem Tod, verurteilt diesen sogar, doch Markolf findet immer einen Weg, seine Haut zu retten. Er soll gehängt werden, bittet aber darum, den Baum selbst auswählen zu dürfen. Wie man sich vorstellen kann, gibt es an jedem Baum etwas auszusetzen.
7.
Vor allem in den weiteren Teilen und den verschiedenen Enden der Konstellation Salomon-Markolf könnte die Analyse des Hierarchieverhältnisses gute Einblicke bieten, den grundlegendenden Fragen des Textes auf die Spur zu kommen. Welches Ziel verfolgt Markolf? Ist er ein Widerständler, ein eigennütziger Bauer, ein Störenfried, ein Bajazzo oder ein verkappter Prophet? Kann oder sollte sogar der Text als eine Provokation gegen die mittelalterliche Hierarchie gelesen werden, vielleicht auch im Sinne einer missverstandenen Zweisprachigkeit?
Den Ansatz, die Beweglichkeit in einer häufig als statisch und unveränderlich wahrgenommenen Gesellschaft, die sich in der Literatur widerspiegelt, zu analysieren, würde ich gerne weiter vertiefen. Auch im Komplex ‚Aristoteles und Phyllis‘ oder im kürzeren Format bei den Mären des Strickers glaube ich, dass sich die Beobachtung der Hierarchie als nützlich erweisen kann, dabei vor allem die der zeitlichen Veränderung, der Dynamik.
Primärliteratur
- Hartmann, Walter (Hg.). 1934. Salomon und Markolf: Das Spruchgedicht. Halle / Saale: Max Niemeyer Verlag.
- Deutsche Bibelgesellschaft (Hg.). 2016. Die Bibel: Lutherübersetzung. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
Sekundärliteratur
- Griese, Sabine. 1999. Salomon und Markolf: Ein literarischer Komplex im Mittelalter und in der frühen Neuzeit: Studien zu Überlieferung und Interpretation. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Griese, Sabine. 2017. Eine Autorität gerät ins Wanken. Markolfs Worte und Taten gegen Salomon in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. in Die Bibel in der Kunst. (Hrsg.) Burnet, Regis. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
- Althoff, Gerd. 2013. Die Macht der Rituale. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Althoff, Gerd. 2014. Spielregeln der Politik im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Toth, Raphael. 2024. Hierarchiedynamik im ‚Salomon und Markolf‘. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Gellerts ‚Gedanken‘ und die ‚Freundschaftlichen
Briefe‘ Gleims
Gellerts ‚Gedanken‘ und die ‚Freundschaftlichen Briefe‘ Gleims[^* Der vorliegende Beitrag stellt die Vorstudie zu der im November 2023 an der Universität Leipzig abgegebenen Masterarbeit mit dem Titel ‚Christian Fürchtegott Gellert und die Briefkultur um 1750‘ dar.]
Für die bürgerliche Briefkultur erwies sich die Mitte des 18. Jahrhunderts als eine außerordentlich produktive Zeit, in der zudem eine lange historische Entwicklung der Regel-Epistolographie zu ihrem Ende geführt wurde. In beeindruckender Ähnlichkeit ihrer Stoßrichtung erschienen 1751 gleich drei Briefsteller (d. h. Lehrbücher über das Verfassen von Briefen), die zu einer einschneidenden Briefreform beitrugen. Bei den fraglichen Texten handelt es sich um Johann Christoph Stockhausens ‚Grundsätze wohleingerichteter Briefe‘, Christian Fürchtegott Gellerts ‚Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen‘ und Johann Wilhelm Schauberts ‚Anweisung zur Regelmäßigen Abfassung Teutscher Briefe‘ (vgl. Nickisch 1969: 161f.). Die genannten Texte eint, dass sie sich dezidiert vom strengen, förmlichen Briefzeremoniell, samt dem dazugehörigen System rhetorischer Vorschriften und Dispositionsschemata, ihrer barocken Vorgänger distanzierten und entscheidende Impulse zur Entrhetorisierung des Briefes (vgl. Golz 1997: 251; Furger 2010: 21) und der damit verbundenen Emanzipation des modernen Privatbriefes setzten (vgl. Nickisch 1969: 58).
Die grobe Tendenz in der Brieflehre von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 18. Jahrhundert ließe sich wie folgt charakterisieren: Die Stillehre wandelt sich, ausgehend von einer zeremoniell-formelhaften Ausdrucksweise, über einen galanten Stil um die Jahrhundertwende hin zur Durchsetzung eines stärker dem Ideal der ‚Natürlichkeit‘ verpflichteten gesprächsmimetischen Schreibgebarens um die Mitte des 18. Jahrhunderts (vgl. Furger 2010: 22; Vellusig 2000: 86–92).
Während die barocke Epistolographie also geprägt ist von konventionellen Verhaltensnormen, die in ihrem System der Abstufungen für Titulaturen, Einleitungs-, Bitt-, Gruß- und Schlussformeln etc. die hierarchischen Verhältnisse ihrer Zeit differenziert zum Ausdruck bringen, grenzt sich die aufklärerisch-empfindsame Epistolographie Gellerts, die nicht nur neuen Stilidealen, sondern neuen moralisch-ästhetischen Lebensidealen verpflichtet ist, deutlich davon ab (vgl. Arto-Haumacher 1995: 31).
1742 erschienen bereits Gellerts ‚Gedanken von einem guten deutschen
Briefe, an den Herrn F. H. v. W.‘ in der Zeitschrift ‚Belustigungen
des Verstandes und des Witzes‘ (vgl. Schönborn 2020: 894), an der
Gellert von 1741 bis 1745 mitarbeitete (vgl. John u. a. 1990: 13).
Gellert hat für diesen Text die Form des Briefes gewählt; Gegenstand
und Form der Darstellung fallen hier also zusammen, daher kann
analog zu dem aus der Essayforschung geläufigen Begriff des
Meta-Essays hier von einem Meta-Brief gesprochen werden (vgl. Bognár
2017: 169–175). Der Verfasser stellt darin theoretische Forderungen
an einen guten Brief auf, gibt aber mit seinem Brief selbst ein
praktisches Beispiel davon, wie ein solcher aussehen könne. Zudem
merkt er bei der Gelegenheit kritisch an, dass es an tauglichen
praktischen Beispielen in deutscher Sprache immer noch fehle,
derweil doch bereits in größerer Zahl aus verschiedenen Sprachen
Briefsammlungen vorlägen, in denen eine gepflegt-‚natürliche‘
Schreibart anzutreffen sei (vgl. ‚Gedanken‘, S. 181).[^1 Der Text
wird im Folgenden zitiert nach Gellert ‚Gedanken‘ 1971.] Als ein
sehr prominentes Beispiel wären hier etwa die von Gellert einige
Jahre später in seiner ‚Praktische Abhandlung‘ explizit gelobten
Briefe der Madame de Sévigné zu nennen, deren Lektüre er seinen
Leser:innen anempfiehlt
(vgl.‚Praktische Abhandlung‘, S.
67).[^2 Der Text wird im Folgenden zitiert nach Gellert, ‚Briefe‘
1971.] Ihre Briefe wurden im 18. Jahrhundert begeistert rezipiert
und trugen bahnbrechend dazu bei, den modernen Brief als
literarische Gattung zu etablieren (vgl. Becker-Cantarino 2003:
133). Den Briefen der Sévigné ist von Treskow eine
‚Als-ob-Natürlichkeit‘ attestiert worden, sie zeichnen sich durch
eine, dem Eindruck nach, spontane und nachlässige Schreibart aus,
sie führen ein kunstvolles Verbergen ihres Kunstcharakters vor und
genau das wird sicherlich auch für Gellert diese Briefe besonders
attraktiv gemacht haben (vgl. Treskow 1996: 587).
Aufsehenerregend sind die Briefe der Sévigné fraglos besonders wegen des dort gebotenen feudalen ‚Flurfunks‘, darüber hinaus tragen sie aber auch deutlich familial-private Züge und geben Einblicke in die Lebenswelt einer Angehörigen des französischen Hochadels (vgl. Becker-Cantarino 2003: 133; Kittelmann 2020: 826). Auch Gleim verehrte die Briefe der Sévigné sehr, sie galten ihm als den Liedern Anakreons ebenbürtig. Insbesondere Verfasser:innen empfindsamer Freundschaftsbriefe schätzten ihren Stil als für das eigene Schreiben vorbildhaft und 1765 riet sogar Friedrich II. in seiner Instruktion für die Berliner Ritterakademie zur Lektüre der Sévigné-Briefe (vgl. Kittelmann 2020: 829).
Aber zurück zu Gellert. Er zeigt durchaus, dass er um die publizierten deutschsprachigen Briefe, die auch seinen Ansprüchen genügen, weiß, wie sie „in dem Neukirch hin und wieder, in dem Patrioten, dem Biedermanne, den Tadlerinnen, dem Freymäurer und andern solchen klugen Blättern […] anzutreffen sind: Allein dieses sind einzelne Blumen, wobey man lange suchen muß, ehe man einen ganzen Straus winden kann“ (‚Gedanken‘, S. 181).
Nur wenige Jahre nachdem Gellert diese Worte niedergeschrieben hat, hat Johann Wilhelm Ludwig Gleim im Verbund mit einigen Freunden eine Sammlung von sechzig Briefen vorgelegt, die effektiv etwas an dem von Gellert monierten Umstand änderte. Dazu kam es wie folgt: Da Gleims vormaliger Arbeitgeber Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, für den er als Sekretär gearbeitet hatte, 1744 bei der Belagerung von Prag fiel, musste Gleim sich nach einer neuen Anstellung umsehen, so verschlug es ihn nach Halberstadt. Gleim war dort räumlich isoliert von den Künstler- und Gelehrtenkreisen der Universitäts- und Residenzstädte. Um den ersehnten Kontakt aber nicht gänzlich zu entbehren, bediente er sich naheliegenderweise des Briefes (vgl. Heinrich 2020: 914).
Um nun nicht nur bei dieser individuell-biographischen Ebene zu verharren, ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass das gesteigerte Bedürfnis des deutschen Bürgertums sich brieflich mitzuteilen im 18. Jahrhundert durch ökonomische und sozialgeschichtliche Prozesse zu erklären ist, denn schließlich nahm die ökonomische Bedeutung des Bürgertums merklich zu, was sich aber noch nicht in einer entsprechenden politischen Organisations- und Repräsentationsform niederschlug. Ihr wachsender ökonomischer Einfluss bewirkte aber ein gänzlich neues Bewusstsein für den eigenen Wert, es bewirkte, dass das bürgerliche Subjekt seine Empfindungen und Gedanken wichtiger und ernster nahm als je zuvor, es provozierte Selbstreflexion und Introspektion und dieses Bewusstsein suchte und fand im Medium Brief einen Kanal zur Artikulation, der es zugleich ermöglichte diesen Gefühlen und Gedanken einen bleibenden Ausdruck zu verleihen (vgl. Balet / Rebling 1979: 165f.; Nickisch 1991: 44). Habermas schreibt dazu:
Das 18. Jahrhundert wird nicht zufällig zu einem des Briefes; Briefe schreibend entfaltet sich das Individuum in seiner Subjektivität. […]. Im Zeitalter der Empfindsamkeit sind Briefe Behälter für die ‚Ergießung der Herzen‘ eher als für ‚kalte Nachrichten‘, die, wenn sie überhaupt erwähnt werden, der Entschuldigung bedürfen. Der Brief gilt, im zeitgenössischen Jargon, der Gellert so viel verdankt, als ‚Abdruck der Seele‘, als ein ‚Seelenbesuch‘; Briefe wollen mit Herzblut geschrieben, wollen geradezu geweint sein (Habermas 1990: 113).
Gleim und seine befreundeten Mitstreiter lieferten dafür ein frühes und bedeutendes Beispiel. Unter anderem aus Teilen seiner umfangreichen Briefkorrespondenzen ging 1746 die Sammlung ‚Freundschaftliche Briefe‘ hervor, die Gleim zusammen mit Samuel Gotthold Lange und Johann Georg Sulzer herausbrachte. Aufnahme in die anonym publizierte Sammlung fanden Teile aus den Korrespondenzen Gleims und Langes mit Sulzer, Ewald von Kleist, Catharina Wilhelmina Keusenhoff und Christian Nicolaus Naumann. Indem sie diese Briefe programmatisch als ‚freundschaftlich‘ ausweisen, unterstreichen sie den persönlich-vertrauten Charakter dieser – eben auch als exemplarisch zu verstehenden – Texte, in denen sich das anakreontische Ideal geselliger Freundschaft(lichkeit) materialisiert, und distanzieren sich damit zugleich von der umständlich-formelhaften Epistolographie der zünftigen Briefsteller. Heinrich erklärt sogar, dass der epistolographische Paradigmenwechsel, der für gewöhnlich auf 1751, als Jahr des Erscheinens von Gellerts ‚Praktischer Abhandlung‘, datiert wird, bedingt durch die konzeptionelle Nähe, die die ‚Freundschaftlichen Briefe‘, zu dieser aufweisen, vorzudatieren ist, denn schon die ‚Freundschaftlichen Briefe‘ wirkten in bahnbrechender Weise ein auf die Entwicklung von Briefstil und Literatursprache (vgl. Heinrich 2020: 915f.).
In ihrem Vorwort, das auch epistolographische Reflexionen enthält, machen Gleim und Lange deutlich, dass sie mit ihrer Sammlung andere zu derartigen Korrespondenzen animieren wollen, die zudem als Teil empfindsamer Lebenspraxis zu verstehen sind:
[…] wenn wir etwas beitragen, die Sprache des Herzens und der Vertraulichkeit, an statt der Sprache des Zwangs und der Schmeichelei, unter den Correspondenten […] einzuführen; wenn wir folglich unsere Absicht zu unserm gemeinschaftlichen Vergnügen erreichen; so wird uns die Gefälligkeit, womit wir unsern Briefwechsel […] bekannt machen, niemals gereuen (‚Freundschaftliche Briefe‘, Vorwort, S. 32f.).
Der in dieser Sammlung anzutreffende Stil zeichnet sich durch ungezwungene, beweglich-aufgeweckte Gesprächsnähe aus und überragt in dieser Hinsicht selbst die avanciertesten Musterstücke der bis zu diesem Zeitpunkt erschienenen deutschen Briefsteller. Wie von den Herausgebern intendiert, konnten sich von derlei freundschaftlichen Briefen dann wiederum auch andere Briefverfasser inspirieren lassen und somit ging eine den Stil weiter entkrampfende Wirkung von ihnen aus (vgl. Nickisch 1969: 161).
Ihre Briefe sind also befreit vom ökonomischen oder ständegesellschaftlich bedingten Zweckdenken, das die Musterbriefe der barocken Briefsteller bestimmte, stattdessen feiern sie das Selbstzweckhafte ihrer vertrauten Korrespondenzen und setzen im Kern das praktisch um, was Gellert bereits in seinen ‚Gedanken‘ skizzierte und was er dann einige Jahre darauf in größerer Ausführlichkeit in seiner ‚Praktischen Abhandlung‘ darlegen wird (vgl. Heinrich 2020: 915).
Schon in den ‚Gedanken‘ wendet sich Gellert gegen alle zuvor erschienenen Briefsteller, da sie „mit aller Gewalt gekünstelt schreiben lehren“ (‚Gedanken‘, S. 179). Weil es aus Gellerts Position heraus nötig war, sich gegen eine lange und mächtige epistolographische Tradition abzugrenzen, bestand seine Hauptaufgabe darin, seine Leserschaft dazu anzuleiten, das rhetorisch-steife Schreibgebaren zu verlernen (vgl. Vellusig 2000: 85). Er plädiert klar und nachdrücklich für einen ungezwungeneren, ‚natürlich‘ anmutenden Schreibstil (vgl. Nickisch 1969: 158f.) und richtet er sich gegen das Aufstellen von zu vielen Regeln beim Briefschreiben (vgl. Schönborn 2020: 894): „Nun werde ich Ihnen sagen sollen, welches ich denn für die besten Regeln halte. Ich antworte, die wenigsten. Oder daß ich genauer rede, ich glaube, daß die nöthigen Regeln zum Briefschreiben keine große Anzahl ausmachen“ (‚Gedanken‘, S. 182).
Wenn Gellert an den älteren Briefsteller kritisiert, dass sie lehren, gekünstelt zu schreiben, folgt daraus nicht, dass er für einen rigoros nachlässig-kunstlosen Stil plädieren würde, was sich schon an folgender Äußerung ablesen lässt: „Wodurch wird also ein Schreiben von […] der Rede unterschieden? […] durch gewisse äusserliche Eigenschaften, die wir der Kunst, dem Geschmacke und Gebrauche zu danken haben“ (‚Gedanken‘, S. 178). Schließlich habe man beim Briefschreiben auch schlichtweg „mehr Zeit zum Nachsinnen“ um „sorgfältiger, zierlicher, einnehmender“ zu formulieren und diese Zeit will und soll nach Gellert genutzt sein (‚Gedanken‘, S. 179).
Auch für die notwendige Übung ist Zeit aufzubringen. Gellert skizziert sogleich eine ihm gangbar erscheinende Methode: Statt Paragraphen zu pauken und erlernte Regeln gleichsam mechanisch zu applizieren, erscheint es Gellert als zweckdienlicher, sich an hochkarätigen Vorbildern, wie namentlich etwa Cicero, Plinius und Seneca zu schulen. Nicht zuletzt wird aus seinem methodischen Vorschlag ersichtlich, dass er den Wert lebendiger Erfahrung im Umgang mit Texten erkannt hat (vgl. Schönborn 2020: 894):
Die besten Regeln werden wohl diese seyn. Man lese die Briefe in fremden Sprachen. Man übersetze sie frey in das Deutsche. Man zergliedere die besten Stücke, und sehe, in welcher Ordnung sie ungefehr aufgesetzt sind. Man merke den Hauptinhalt von dem, der uns am besten gefällt, und mache in einigen Tagen einen nach, und sehe, ob man seinem Originale gleich gekommen, oder es wohl gar noch übertroffen hat. […] wer also gute Briefe will schreiben lernen, der braucht sich nicht an die Schulregeln zu binden (‚Gedanken‘, S. 183f.).
Zuvor machte Gellert schon deutlich, dass für ihn die bloße Kenntnis von Regeln noch keinen guten Briefschreiber mache, denn man könne alle möglichen Regeln beachten und anwenden und trotzdem schlechte Briefe produzieren, „wenn man nicht denken kann“ (‚Gedanken‘, S. 183). Daraus folgt im Umkehrschluss: „Wer gute Briefe schreiben will, der muß gut von einer Sache denken können“ (‚Gedanken‘, S. 184.). Nur: „Das Denken lehren uns alle Briefsteller nicht. Eine geübte Vernunft, eine lebhafte Vorstellungskraft, eine Kenntniß der Dinge, wovon man reden will, richten hier das meiste aus“ (‚Gedanken‘, S. 184). An Bemerkungen wie dieser wird evident, wie sich Gellert argumentativ distanziert von „einer Poetik der Regeln, wie sie noch Gottsched vertreten hatte“, demgegenüber etabliert er „eine Reflexionsebene, auf der die personale und darum poesienahe Dimension des Briefwechsels zur Diskussion steht“ (Vellusig 2000: 85).
Ganz im Geiste des anregenden freundschaftlich-lebendigen Austausches und Miteinanders empfiehlt Gellert dem Novizen im Briefschreiben, bei einem erfahreneren „Freund von Geschmacke“ kritische Unterstützung zu suchen, „der […] die besondern Fehler zeiget, die Lücken füllet, die Schreibart verbessert“ (‚Gedanken‘, S. 185), bis er sich schließlich selber zu helfen weiß.
Aus den obigen Zitaten wird ersichtlich, dass es ihm zufolge einer eigenen intellektuellen Leistung bedarf. Die Nachahmung zu Übungszwecken soll nicht starr und eng erfolgen, vielmehr diene das Vorbild als zu verinnerlichendes Grundmuster, aus dem sich, mit und durch die eigene Persönlichkeit, ein persönlich gefärbter Ausdruck formt, so ließe sich, in Anlehnung an Gellerts Definition des Briefes als „freye Nachahmung des guten Gesprächs“ (‚Praktische Abhandlung‘, S. 3), sagen, dass also auch die Nachahmung der Vorbilder eine freie sein soll. Es geht hier also nicht um das Anwenden von Schreibschablonen, sondern um einen intellektuellen Arbeits- bzw. Verarbeitungsprozess des Erwerbens, oder vielmehr des Aneignens, denn zu guter Letzt besteht die Aufgabe der Exempel darin, sich selbst überflüssig machen, sodass man sich nunmehr sicher und frei im eigenen Schreiben von ihnen lösen kann, wie er einige Jahre später auch in seiner ‚Praktischen Abhandlung‘ darlegen wird:
Wenn man endlich selbst Briefe schreiben will, so vergesse man die Exempel, um sie nicht knechtisch nachzuahmen, und folge seinem eignen Naturelle. Ein jeder hat eine gewisse Art zu denken und sich auszudrücken, die ihn von Andern unterscheidet. [. . .] wer seiner eignen Art zu denken nicht folgt, der benimmt sich das sicherste Mittel, dem Andern zu gefallen, und etwas neues zu sagen (‚Praktischen Abhandlung‘, S. 71f.).
Was an Gellerts Bemerkungen deutlich wird ist, dass seine anempfohlene Methode auf literarische Bildung setzt und darauf, auf ernste und genaue Tuchfühlung mit den Briefbeispielen zu gehen, wodurch der eigene Geschmack geschult und somit in seinen Urteilen sicherer wird und woraus dann idealiter eine gute eigene Schreibart erwachsen solle, die dann wiederum auch andere zu einer solchen inspiriert und ermuntert (vgl. Schönborn: 2020, 895):
So werden durch wenig gute Beispiele, die in ihrer Art vortrefflich sind, die richtigen Empfindungen des Natürlichen und Feinen in andern erweckt und unterhalten, und der gute Geschmack geht vom Freunde zum Freunde, vom Vater zum Sohne, von der vernünftigen Mutter zur Tochter fort, und wird der herrschende Geschmack (‚Praktischen Abhandlung‘, S. 119f.).
Primärliteratur
- Gellert, Christian Fürchtegott. 1971. Gedanken von einem guten deutschen Briefe, an den Herrn F. H. v. W. In Gellert, Christian Fürchtegott, Die epistolographischen Schriften: Faksimiledruck nach den Ausgaben von 1742 und 1751, hg. Paul Böckmann / Friedrich Sengle. Stuttgart: Metzler.
- Gellert, Christian Fürchtegott. 1971. Briefe, nebst einer Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen. In Gellert, Christian Fürchtegott, Die epistolographischen Schriften. Faksimiledruck nach den Ausgaben von 1742 und 1751, hg. Paul Böckmann / Friedrich Sengle. Stuttgart: Metzler.
- Gleim, Johann Wilhelm Ludwig / Lange, Samuel Gotthold [Anonym]. 1990. Freundschaftliche Briefe: Vorwort 1746. In Ebrecht, Angelika u. a. (Hg.), Brieftheorie des 18. Jahrhunderts: Texte, Kommentare, Essays, S. 32–34. Stuttgart: Metzler.
Sekundärliteratur
- Arto-Haumacher, Rafael. 1995. Gellerts Briefpraxis und Brieflehre: Der Anfang einer neuen Briefkultur. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
- Balet, Leo / Rebling, Eberhard. 1979. Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. Dresden: Verlag der Kunst.
- Becker-Cantarino, Barbara. 2003. Leben als Text: Briefe als Ausdrucks- und Verständigungsmittel in der Briefkultur und Literatur des 18. Jahrhunderts. In: Gnüg, Hiltrud / Möhrmann, Renate (Hg.), Frauen Literatur Geschichte: Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, S. 129–146. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Bognár, Zsuzsa. 2017. ‚als Mischform verrufen‘: Der literarische Essay der Moderne, hg. Attila Bombitz u. Károly Csúri. Wien: Praesens.
- Furger, Carmen. 2010. Briefsteller: Das Medium ‚Brief‘ im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Köln / Weimar / Wien: Böhlau.
- Golz, Jochen. 1997. Art. Brief. In Weimar, Klaus u. a. (Hg.), Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte, Bd. I, S. 251–255. Berlin / New York: De Gruyter.
- Habermas, Jürgen. 1990. Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Heinrich, Tobias. 2020. Gleim und sein Kreis. In Matthews-Schlinzig, Marie Isabel u. a. (Hg.), Handbuch Brief: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, S. 914–925. Berlin / Boston: De Gruyter.
- John, Heidi u. a. 1990. Gellerts Leben. Eine Übersicht. In Witte, Bernd (Hg.), Ein Lehrer der ganzen Nation: Leben und Werk Christian Fürchtegott Gellerts. S. 11–29. München: Fink.
-
Kittelmann, Jana. 2020.
Madame de Sévigné und ihre Erb*innen.
In Matthews-Schlinzig, Marie Isabel u. a. (Hg.), Handbuch Brief: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, S. 826–833. Berlin / Boston: De Gruyter. - Nickisch, Reinhard M. G. 1969. Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 18. Jahrhunderts: Mit einer Bibliographie zur Briefschreiblehre (1474–1800). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Nickisch, Reinhard M. G. 1991. Brief. Stuttgart: Metzler.
- Schönborn, Sibylle. 2020. Gellert, Moritz und die Popularisierung der Brieftheorie. In Matthews-Schlinzig, Marie Isabel u. a. (Hg.), Handbuch Brief: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, S. 893–904. Berlin / Boston: De Gruyter.
- Treskow, Isabella von. 1996. Der deutsche Briefstil Elisabeth Charlottes von der Pfalz und die ‚art épistolaire‘ Madame de Sévignés. Zeitschrift für Germanistik 6 (3). S. 584–595.
- Vellusig, Robert. 2000. Schriftliche Gespräche: Briefkultur im 18. Jahrhundert. Wien / Köln / Weimar: Böhlau.
- Franke, Sebastian. 2024. Gellerts ‚Gedanken‘ und die ‚Freundschaftlichen Briefe‘ Gleims. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Epistemische Funktion des Briefes
Epistemische Funktion des Briefes Zum Konzept der Ganzheit in den Korrespondenzen Karl August Varnhagens von Ense mit Alexander von Humboldt und Ignaz Paul Vital Troxler[^* Der vorliegende Beitrag bietet die Projektbeschreibung zum gleichnamigen Dissertationsprojekt.]
Zum Gegenstand meiner Untersuchung wurde die epistemische Funktion des Briefes, die ich am Beispiel von zwei bedeutenden Korrespondenzen des Intellektuellen Karl August Varnhagen von Ense (1785–1858) analysierte. Varnhagen von Ense war ein deutscher Publizist, Diplomat und Begründer der einzigartigen Handschriftensammlung, die heute in der Jagiellonen-Bibliothek in Krakau (Polen) aufbewahrt wird (vgl. Jaglarz / Jaśtal 2018: 15–30). Den Schwerpunkt meiner Arbeit bildete die Untersuchung des im Brief geführten intellektuellen Dialogs, der auf die Vermittlung von Wissen abzielte, das die Korrespondenzpartner im Laufe ihrer individuellen Erkenntnisse erworben haben.
Der erste Teil des Korpus umfasst die Korrespondenz Varnhagens mit dem als „Weltbürger“ (Biermann / Schwarz 1999: 182) und Polyhistor bekannten Alexander von Humboldt (1769–1859), dem Reiseforscher, der mit seinem Verständnis von der Natur als „Netz des Lebens“ (Wulf 2016: 21) die Entwicklung der modernen Wissenschaft beeinflusste. Die Edition ‚Briefe Alexander von Humboldts an K.A.V. von Ense aus den Jahren 1827–1858‘ wurde im Jahre 1860 von Ludmilla Assing veröffentlicht, Varnhagens Nichte, die nach dem Tod ihres Onkels seinen handschriftlichen Nachlass verwaltete (vgl. Gatter 2000: 266). Die Ausgabe enthält 157 Briefe von Humboldt und 12 Briefe von Varnhagen und ist kein vollständiges Register dieser Briefpartnerschaft.
Den zweiten Teil des Korpus bildet die Korrespondenz Varnhagens mit Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866), dem Schweizer Arzt und Philosophen, der ebenso als ‚Gründervater der modernen Schweiz‘ (Furrer 2009) gilt. Der Briefwechsel fand in den Jahren 1815–1858 statt. Die 1953 von Iduna Belke herausgegebene Briefedition wird von der Forscherin als vollständig angesehen, sie enthält 66 Briefe von Varnhagen und 81 Briefe von Troxler.
Für die Zusammenstellung beider Korrespondenzen war die geistige Nähe der Gesprächspartner, ihre naturwissenschaftliche Ausbildung (Humboldt und Troxler waren Naturwissenschaftler, Varnhagen studierte Medizin), das politische Engagement und das Interesse an publizistischen Fragestellungen von Bedeutung. Außerdem beeinflusste diese Entscheidung auch die unterschiedlich ausgeführte Aufbewahrungs- und Editionspraxis. Die präzise Dokumentation von Varnhagens Ansichten aus dem Korrespondenzverhältnis mit Troxler erlaubt es, seine frühen Ansichten über aktuelle Fragestellungen kennenzulernen und seinen Beitrag an dem chronologisch später erfolgenden Briefwechsel mit Humboldt zu erkennen, von dem bis heute grundsätzlich nur die Briefe des Naturforschers erhalten geblieben sind.
Eine Inspirationsquelle für die Betrachtung des Briefs als Medium der Wissensvermittlung waren Thesen des britischen Forschers Peter Burke zur sozialen Geschichte des Wissens. In seiner Studie ‚Explosion des Wissens‘ (2014) untersuchte Burke die Mechanismen der Entstehung und Vermittlung von Wissen in Bezug auf das kommunikative Potenzial verschiedener Medien. Dem Brief kommt laut Burke eine besondere Qualität als Medium der Wissensvermittlung zu, er zeichnet sich durch seinen dialogischen Charakter und hybride Form aus, d. h. solche, die Elemente der Mündlichkeit und Schriftlichkeit verbindet (vgl. Burke 2014: 114).
Burkes innovatives Werk bietet dem Leser jedoch keine kohärente Methodologie, die er für seine weitere Forschung nutzen könnte. Es erschien deshalb notwendig, die Vorschläge des englischen Forschers zu ergänzen, d.i. den Begriff Wissensvermittlung präzise zu definieren und die Kategorien der Briefanalyse zu bestimmen. Die Wissensvermittlung definierte ich u. a. in Anlehnung an die Vorschläge von Antoine Hornung (vgl. Hornung 2005: 391) und Gerhard Steindorf (vgl. Steindorf 1985: 160) als eine kommunikative Handlung zwischen einem Sender und Empfänger, deren Ziel die Weitergabe von Wissen mit Verständnisanspruch darstellt. Versuche, Analysekategorien der Gattung Brief systematisch zu benennen, werden selten unternommen. Ein ausgebautes Kategorieninventar bietet die Studie von Karl Ermert aus den 1980er Jahren mit dem Titel ‚Briefsorten. Untersuchungen zu Theorie und Empirie der Textklassifikation‘, die in der Forschung bisher wenig beachtet wurde. Dank der darin enthaltenen Vorschläge wurde es möglich das Sender-Empfänger-Verhältnis festzulegen, die Rolle der epistolaren Kommunikation im allgemeinen Kontext der brieflichen und nicht brieflichen Kommunikation zwischen den Schreibenden zu bestimmen, Themen zu identifizieren und vor allem die Funktion der einzelnen Briefe zu ermitteln (vgl. Ermert 1979: 68–82). Ermert geht davon aus, dass ein Brief mehrere Funktionen erfüllen kann, wobei eine immer dominant bleibt. Er zählt folgende Funktionen auf: Kontaktfunktion, Darstellungsfunktion, Wertungsfunktion, Aufforderungsfunktion und kognitive Funktion. In meiner Untersuchung erweiterte ich das von Ermert erstellte Modell um die epistemische Funktion, unter der ich nach Dietrich Busse und Grzegorz Pawłowski die in der epistolaren Kommunikation stattfindende Wissensvermittlung verstehe, die „auf vorgängige Erkenntnisakte“ (zit. nach Pawłowski 2015: 67) der Schreibenden zurückverweist. Die epistemische Funktion wird im Brief dann realisiert, wo in der Nachricht der Fokus auf die Präsentation der bereits erfolgten individuellen Erkenntnisse gerichtet wird (Darstellungs- und Wertungsfunktion nach Ermert) und nicht dort, wo im Zentrum die Exposition der Beziehung steht (Kontakt- und Appellfunktion) oder der Reflexionsprozess, der während des Schreibens stattfindet (kognitive Funktion).
Um zu bestimmen, in welchen Phasen der Zusammenarbeit der Brief von den Gesprächspartnern als Medium der Wissensvermittlung verwendet wurde, war es notwendig, die Korrespondenz anhand der von Ermert vorgeschlagenen Analysekategorien genau zu strukturieren. Bei der Lektüre und Analyse der Briefe erwies es sich als hilfreich, den biographischen Kontext zu berücksichtigen, der wichtige Hinweise auf den Verlauf der epistolaren Kommunikation und seine Funktion lieferte.
Das Korrespondenzverhältnis zwischen dem preußischen Diplomaten Varnhagen und dem Schweizer Gelehrten Troxler entwickelte sich vor dem Hintergrund der politischen Debatten auf dem Wiener Kongresses, an dem beide Intellektuellen teilnahmen und ihre Länder repräsentierten. Beide vertraten liberale Ansichten und engagierten sich für die internationale Zusammenarbeit. Ihr Briefwechsel aus den Jahren 1815–1858 wurde zum Ausdruck des europäischen Zusammenhalts. Den Verlauf der Korrespondenz bestimmten zwei Ereignisse im Leben der Gesprächspartner. Die erste bedeutende Zäsur war im Februar 1815, als Troxler (zwei Monate nach dem Beginn der Korrespondenz) mit dem Ende des Kongresses Wien verließ und in seine Heimat Schweiz zurückkehrte. Als zweite biografische Zäsur kann Juni 1856 angesehen werden, als sich die Freunde nach einer über 40 Jahre dauernden Trennung in der Schweiz wiedertrafen. Anhand der angegebenen Daten lässt sich die Korrespondenz zwischen Varnhagen und Troxler in drei Phasen einteilen: eine kurze Zeitspanne von Januar bis Februar 1815, in der die epistolare Kommunikation die Zusammenarbeit der Intellektuellen auf dem Wiener Kongress unterstützte, die Briefe erfüllten die Appellfunktion; die Zeit zwischen März 1815 bis Juni 1856, in der der Briefwechsel die Kontakte zwischen Varnhagen und Troxler regulierte, in den Briefen aus dieser Phase dominierten die Darstellungs- und Wertungsfunktion. Abhängig von den persönlichen und beruflichen Interessen wechselte in diesen Jahren die thematische Ausrichtung der Korrespondenz: zwischen 1815–1818 fand der intensivste Gedankenaustausch statt, verbunden war er mit der literarisch-politischen Zusammenarbeit der Briefpartner, die um die Herausgabe der internationalen Zeitschrift „Schweizerisches Museum“ zirkulierte. Zwischen 1819 und 1846 kam es zu einer allmählichen Abschwächung der Korrespondenzbeziehung. Dies lag zum einen an der Verschärfung der politischen Situation, zum anderen an der Konzentration der Gesprächspartner auf ihre eigenen Projekte. In Troxlers Briefen aus dieser Zeit dominieren philosophische Überlegungen, in Varnhagens Briefen Reflexionen über die Bedeutung der Literatur für das gesellschaftliche Leben. Kurz vor dem Ausbruch der Märzrevolution kehrten politischen Fragen zurück. Zwischen 1847 und 1856 erörterten die Schreibenden aktuelle Ereignisse, mögliche Entwicklungen in Europa und ihren Beitrag zur geistigen Entwicklung der Menschheit. In der letzten, dritten Phase der Korrespondenz, d. h. zwischen 1856–1858, dominierte die Kontaktfunktion.
Die edierten Briefe zwischen Varnhagen und Alexander Humboldt dokumentieren das Korrespondenzverhältnis zwischen den Intellektuellen, das in den Jahren 1827–1858 stattfand. Die verfügbaren Quellen deuten jedoch darauf hin, dass die Korrespondenten schon viel früher in Kontakt getreten sind (vgl. Varnhagen von Ense 1987: 59). Aus den Briefen geht hervor, dass ihre Beziehung 1827 nach Humboldts Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin erneuert wurde. Der Gelehrte hatte die Jahre zuvor in Paris verbracht, die Motivation für die Kontaktaufnahme mit Varnhagen ging mit Humboldts wissenschaftlich-publizistischen Vorhaben einher. Die Briefe enthalten zahlreiche Hinweise auf die Zweigleisigkeit der Kommunikation, d. h. auf ihren mündlichen und schriftlichen Charakter, da sie über die Treffen der Korrespondenten berichten und manchmal die dabei besprochenen Themen berühren. Die biographischen Schlüsselmomente, die die Dynamik der Korrespondenz prägen, waren politische Ereignisse und schwierige persönliche Erfahrungen. Diese waren (in chronologischer Reihenfolge): der Tod Varnhagens Frau Rahel (1833), der Tod Humboldts Bruders, des Sprachwissenschaftlers Wilhelm von Humboldt (1835) und die Märzrevolution (1848 / 49). Die Erkenntnis dieser Zäsuren ermöglichte es, den Briefwechsel in drei Phasen zu gliedern.
Die erste Phase umfasst Briefe aus den Jahren 1827 bis 1835. Die erhaltene Korrespondenz aus dieser Zeit dokumentiert Vorarbeiten Alexander von Humboldts zum opus magnum ‚Kosmos‘, an dem Varnhagen als literarischer Berater beteiligt war. In diesen Briefen dominiert die Darstellungsfunktion. In den folgenden Jahren, d. h. zwischen 1836 und 1849, besprachen die Korrespondenten die individuellen wissenschaftlichen und literarischen Projekte (zu denen u. a. die weitere Arbeit Humboldts am ‚Kosmos‘ gehörte sowie Varnhagens Arbeit an Lebenserinnerungen ‚Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens‘ oder der berühmten Varnhagen-Sammlung), sowie bewerteten wissenschaftliche Bemühungen anderer Intellektuellen, kommentierten auch politische Entwicklungen. Die Briefe erfüllten die Wertungsfunktion. Die letzten Jahre des Briefwechsels, d. h. 1850–1858 wurden durch die Folgen der Märzrevolution bestimmt. Die Briefe spiegeln die politische Unzufriedenheit der Schreibenden wider. Ihre Hoffnungen auf einen einheitlichen deutschen Staat waren gescheitert. Während in den vorangegangenen Phasen die schriftliche Kommunikation mit der mündlichen einherging, wurden in der letzten Phase ihres intellektuellen Austausches die persönlichen Treffen der Schreibenden aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands merklich seltener. Die Briefe kompensierten die Unmöglichkeit des persönlichen Gesprächs, in den Mitteilungen aus dieser Zeit überwiegen, je nach Situation, die Wertungs- und Kontaktfunktion.
Aufgrund der durchgeführten Analysen konnte festgestellt werden, dass die epistemische Funktion in der Korrespondenz zwischen Varnhagen und Troxler in dem Schreibzeitraum zwischen März 1815 und Juni 1856 realisiert wird. Im Fall der Briefe von Humboldt und Varnhagen ist die epistemische Funktion in der gesamten Korrespondenz aus den Jahren 1827–1858 präsent. Die in beiden Korrespondenzen wiederkehrenden Gedankengänge ließen das Konzept der Ganzheit als den vermittelten Wissensbestand identifizieren, den Varnhagen, Humboldt und Troxler in ontologischer und erkenntnistheoretischer Hinsicht erwogen. Das Konzept der Ganzheit wurzelt in der antiken Tradition und verweist auf den Problemzusammenhang zwischen dem Teil und dem Ganzen. Um 1800, aufgrund der erlebten Zersplitterung infolge der politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen, kam es zur Aufwertung dieser Problematik. Die Suche nach komplexen Zusammenhängen, einem integrierten Blick auf die Welt und den Menschen wurde zur Notwendigkeit.
Die Präsentation der Inhalte im Brief (einschließlich wissenschaftlicher Fragestellungen) unterlag in den epistolaren Nachrichten des 19. Jahrhunderts keinen formalen Vorschriften. Briefe waren adressatengebunden und wurden an den Verstehenshorizont des Gesprächspartners angepasst. Um die Vermittlung des Konzepts der Ganzheit in den durch ihre Selektivität gekennzeichneten Korrespondenzen näher ergründen zu können, rekapitulierte ich in der Arbeit die Ansichten der Intellektuellen. Ausschlaggebend für meine Untersuchung wurden die auf ein ganzheitliches Weltverständnis ausgerichteten Studien der Intellektuellen, d.i. ‚Kosmos‘ (1845–1862) von Alexander von Humboldt, ‚Blicke in das Wesen des Menschen‘ (1812) von I. P. V. Troxler sowie eine Sammlung von Literaturkritiken von K.A.V von Ense (1833). Auf diese Weise konnte ich einen breiteren Kontext für die nicht systematischen oder verkürzten Beiträge zu den von mir analysierten wissenschaftlichen Themen skizzieren.
Für Alexander von Humboldt wurde die ganzheitliche Erkenntnis zum Grundmodell seines wissenschaftlichen Denkens. Diese für seine Arbeit grundlegende These formulierte der Wissenschaftler bereits vor dem Beginn seiner Südamerikareise (1799–1804) und bestätigte 1808 in seiner Studie ‚Ansichten der Natur‘, in der er auf die Komplexität der Naturerscheinungen hinwies. Schon damals förderte er die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, was schließlich zur Veröffentlichung seines Lebenswerks ‚Kosmos‘ führte. Troxler bezog das Konzept der Ganzheit auf seine anthropologischen Untersuchungen. Er strebte eine ganzheitliche Sicht des Menschen an und versuchte dabei, die gegensätzlichen Positionen von Materialismus und Spiritualismus sowie Idealismus und Realismus zu verbinden. Die Ergebnisse seiner Forschung legte er in seiner Studie ‚Blicke in das Wesen des Menschen‘ vor. In den folgenden Jahren seines Lebens arbeitete er weiter an der Idee der Anthroposophie, seiner originellen philosophischen Position, in der er anthropologische, philosophische und theologische Ansätze zu verbinden suchte. Varnhagens frühe Thesen zum Konzept der Ganzheit lassen sich in seiner Korrespondenz wiederfinden. In seiner beruflichen Tätigkeit als Publizist, Literaturkritiker und Autographensammler setzte er seine Ansichten in die Praxis um. Sein ganzheitliches Denken wandte er auf die literarische Tätigkeit an: zum einen auf den Schreibprozess und die damit verbundene Spannung zwischen den Textteilen und dem Textganzen, zum anderen auf den Text als Element (Teil) eines Ganzen, das es im Kulturraum ist, innerhalb dessen er eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellt.
Varnhagens Briefwechsel mit Troxler und Humboldt bieten dem Leser zwei unterschiedliche Reflexionsvarianten von dem Konzept der Ganzheit. Dies wird sowohl durch den Entwicklungsgrad ihres intellektuellen Bewusstseins zu dem bestimmten biografischen Zeitpunkt bestimmt als auch durch die Rolle, die der Brief in der Kommunikation zwischen den Partnern spielte. Die Briefe Varnhagens und Troxlers zeichnen sich durch eine detaillierte Ergebnisdarstellung aus. Dies ist zum einen auf die räumliche Entfernung und die Beschränkung der Interaktion auf schriftliche Kommunikation zurückzuführen, zum anderen auf die im Laufe der Jahre fortschreitende Präzisierung der individuellen Ansichten. Im Falle von Varnhagen und Humboldt waren detaillierte Aussagen größtenteils überflüssig. Lange Zeit ergänzte die schriftliche Kommunikation die zahlreichen persönlichen Treffen. Die Intellektuellen verfügten zum Zeitpunkt der epistolaren Kontaktaufnahme über ausgebaute konzeptuelle Lösungen, die der Öffentlichkeit bekannt waren. Das Konzept der Ganzheit manifestierte sich in den Briefen in der Realisierung gemeinsamer Projekte, in denen die Korrespondenzpartner versuchten, die individuell entwickelten Ideen miteinander zu verbinden.
In dem intellektuellen Austausch zwischen Varnhagen und Troxler aus dem Zeitraum zwischen März 1815 und Juni 1856 wurde das Konzept der Ganzheit auf drei Themenkomplexe bezogen: Politik, Literatur und Philosophie, die teilweise getrennt, teilweise parallel diskutiert wurden und in verschiedenen Phasen der Korrespondenz, abhängig von politischen, persönlichen und beruflichen Interessen dominierten.
Die Analyse der vermittelten Ansichten lässt einen von Brief zu Brief stattfindenden Wissenszuwachs beobachten. Sie markieren einen vollständig durchgeführten Denkvorgang von Analyse zur Synthese, der über die Jahre verteilt ist und das Konzept der Ganzheit als ein übergeordnetes Denkprinzip erkennen lässt. Die Erweiterung der Erkenntnisperspektive vollzieht sich sowohl auf der quantitativen (Themenvielfalt) als auch qualitativen (Gedankentiefe) Ebene. Wesentliche Wendepunkte bilden die Jahre 1819 und 1847, in denen neue Ideen in den epistolaren Dialog eingeführt wurden und den intellektuellen Austausch in drei Phasen gliedern ließen: die Jahre 1815–1818, in denen das Konzept der Ganzheit politisch-literarisch erörtert wurde. Die Veränderungen in den einzelnen Ländern nach dem Wiener Kongress diskutierten die Korrespondenzpartner nicht getrennt, sondern zusammen, als Teile einer gemeinsamen Weltentwicklung. In der Publizistik erkannten sie die Möglichkeit der Völkerverbindung und den Weg zum politischen Wiederaufbau. Beide kommentierten die Bedeutung der Literatur für den sozialen Bewusstseinswandel. Durch die Herausgabe der Zeitschrift ‚Schweizerischen Museums‘ beabsichtigten sie die Zusammenarbeit der deutschsprachigen Länder zu unterstützen und langfristig auf das Zusammensein der Nationen einzuwirken.
In der Zeit zwischen 1819 und 1846 wurde das Konzept der Ganzheit im philosophischen und literarischen Kontext erörtert. Im Gegensatz zu früheren Überlegungen wurde die ganzheitliche Weltentwicklung auf das Wirken von Individuen zurückgeführt. Dies hing u. a. mit der philosophischen Tätigkeit Troxlers zusammen, der in der Weltordnung einen generationenübergreifenden Entwicklungsprozess erkannte und die „Suche des Menschen im Menschen“ (Aeppli 1936: 153) postulierte. In den Briefen erläuterte er seinen innovativen philosophischen Ansatz der Anthroposophie. Varnhagen beschäftigte hingegen die literarische Auslegung des Konzepts der Ganzheit, das er sowohl auf Einzeltexte als auch auf literarische Formen anwandte. Die Korrespondenten experimentierten mit neuen Ausdrucksformen, die sich auf dieses Konzept bezogen. Varnhagen übte sich in dieser Zeit in Formen des biografischen und autobiografischen Schreibens und gab u. a. Briefe seiner verstorbenen Frau heraus: ‚Rahel. Das Buch des Andenkens‘ (1833). Zudem engagierte er sich als Autographensammler. In den Briefen aus den letzten Jahren des intellektuellen Austausches, d.i. 1847–1856, wurden politische, philosophische und literarische Überlegungen miteinander verbunden, das Konzept der Ganzheit wurde von den Korrespondenten als ein universelles Prinzip der Weltwahrnehmung und der Reflexion über die Welt verstanden.
Der Briefwechsel von Karl August Varnhagen von Ense und Alexander von Humboldt aus den Jahren 1827 bis 1858 lässt beobachten, wie die von den Gesprächspartnern zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten ganzheitlichen Konzepte von der Natur und Literatur miteinander verbunden werden. Die bereits vorgeschlagene Einteilung der Korrespondenz in drei Perioden, deren Wendepunkte mit den für die Gesprächspartner wichtigen persönlichen und politischen Ereignissen zusammenfallen, erlaubt auch die Einführung neuer thematischer Schwerpunkte zu bemerken.
Briefe aus den Jahren 1827–1835 zeigen die Anfänge der Zusammenarbeit zwischen Varnhagen und Humboldt. Das Konzept der Ganzheit wurde von den Gesprächspartnern auf die Frage der Wissenspopularisierung bezogen. Für Humboldt war dies eine intensive Zeit der Arbeit an seinem Lebenswerk ‚Kosmos‘, einer Himmel und Erde umfassenden Weltbeschreibung, in der er die Komplexität der Naturphänomene zu vermitteln suchte. Varnhagen, als ein von Humboldt geschätzter Literaturkritiker, beteiligte sich an dem Vorhaben des Naturforschers, indem er Korrekturarbeiten zum Werk leistete und den richtigen literarischen Ausdruck für die Darstellung der Ganzheit der Natur suchte. In den Briefen aus den Jahren 1836 bis 1849 wurde das Konzept der Ganzheit von den Gesprächspartnern sowohl auf ihr eigenes geistiges Schaffen als auch auf die Leistungen der Zeitgenossen bezogen: im Sinne einer posthumen Ehrung (hier sind u. a. das gemeinsame Projekt zur Herausgabe der sprachwissenschaftlichen Arbeiten Wilhelm von Humboldts oder die Varnhagen-Sammlung zu nennen) oder aktueller Debattenführung. Die Schreibenden kommentierten den Beitrag der Zeitgenossen zur Entwicklung der Wissenschaft, darunter die Werke von Philosophen, Schriftstellern, Theologen oder Politikern. Nach 1843 wurde auf das Konzept der Ganzheit bezüglich der politischen Situation zurückgegriffen, negativ beurteilt wurde die Kurzsichtigkeit der Regierenden. In den letzten Korrespondenzjahren, d. h. 1850–58, ist aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Korrespondenzpartner eine stärkere Tendenz zu verallgemeinernden Aussagen über den Weltentwicklungsvorgang zu beobachten. Die eigene Existenz schien den Gesprächspartnern ein Bruchteil der Weltgeschichte darzustellen. Trotzdem versuchten sie die eigenen Leistungen im Kontext der Weltentwicklung zu positionieren und hoben den individuellen Beitrag zum Weltfortschritt hervor. In diesem Sinne schließen diese Erwägungen an das Konzept der Ganzheit an, da sie das individuelle Verhältnis zwischen dem Ich und der Welt thematisierten.
Die durchgeführte Untersuchung zur epistemischen Funktion des Briefs fokussierte zwei Korrespondenzen aus dem 19. Jahrhundert. Die Analyse anderer Briefwechsel aus dieser Zeit, die in der zeitgenössischen Forschung noch nicht berücksichtigt wurden, könnte zu weiteren Erkenntnissen im Bereich der epistolaren Wissensvermittlung verhelfen, in einer Zeit, in der die Suche nach Wechselwirkung und Verbindung zum Grundmodell erklärt wurde.
Primärliteratur
- Assing, Ludmilla (Hg.). 1860. Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827–1858: Nebst Auszügen aus Varnhagen’s Tagebüchern und Briefen von Varnhagen und Anderen an Humboldt. Leipzig: F.A. Brockhaus.
- Belke, Iduna (Hg.). 1953. Der Briefwechsel zwischen Ignaz Paul Vital Troxler und Karl August Varnhagen von Ense 1815–1858. Aarau: H.R. Sauerländer & Co.
Sekundärliteratur
- Aeppli, Willi (Hg.). 1936. I.P.V. Troxler Fragmente: Erstveröffentlichung aus seinem Nachlasse. St. Gallen: Dreilinden-Verlag AG.
- Biermann, Kurt-R. und Schwarz, Ingo. 1999. „Moralische Sandwüste und blühende Kartoffelfelder“: Humboldt – ein Weltbürger in Berlin. In Holl, Frank (Hg.), Alexander von Humboldt: Netzwerke des Wissens, S. 182–200. Bonn: Hatje-Cantz.
- Burke, Peter. 2014. Die Explosion des Wissens: Von der Encyclopédie bis Wikipedia. Berlin: Wagenbach.
- Ermert, Karl. 1979. Briefsorten. Untersuchungen zu Theorie und Empirie der Textklassifikation. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Furrer, Daniel. 2009. Gründervater der modernen Schweiz. Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866). https://folia.unifr.ch/documents/301195/files/FurrerD.pdf (2.11.2023). Ohne DOI.
- Gatter, Nikolaus. 2000. „Sie ist vor allem die m e i n e…“ Die Sammlung Varnhagen bis zu ihrer Katalogisierung. In Gatter, Nikolaus (Hg.), Wenn die Geschichte um eine Ecke geht, S. 239–271. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH.
- Hornung, Antonie. 2005. Wissenstransfer versus Wissensvermittlung: eine Annäherung an den Begriff am Beispiel sprachlich- / kulturelles Wissen. In: Antos, Geld (Hg.), Wissenstransfer durch Sprache als gesellschaftliches Problem, S. 391–402. Frankfurt a. M.: Peter Lang GmbH.
- Jaglarz, Monika und Jaśtal, Katarzyna. 2018. Bestände der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin in der Jagiellonen-Bibliothek: Geschichte und Struktur. In: Jaglarz, Monika und Jaśtal, Katarzyna (Hg.), Bestände der ehemaligen Preußsischen Staatsbibliothek zu Berlin in der Jagiellonen Bibliothek: Forschungsstand und -perspektiven, S. 15–30. Berlin: Peter Lang GmbH.
- Pawłowski, Grzegorz. 2015. Kognitiv und / oder epistemisch? Auf dem Weg zur epistemologischen Semantik. Glottodidactica XLII(1). S. 63–79.
- Steindorf, Gerhard. 1985. Lernen und Wissen: Theorie des Wissens und der Wissensvermittlung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Varnhagen von Ense, Karl August. 1987. Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens. Bd. 2, hg. Konrad Feilchenfeldt. Frankfurt a. M.: Bibliothek Deutscher Klassiker.
- Wulf, Andrea. 2016. Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. München: C. Bertelsmann.
- Szczukiewicz, Joanna. 2024. Epistemische Funktion des Briefs: Zum Konzept der Ganzheit in den Korrespondenzen Karl August Varnhagens von Ense mit Alexander von Humboldt und Ignaz Paul Vital Troxler. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Körperdarstellung in der Korrespondenz Rahel Varnhagens
Körperdarstellung in der Korrespondenz Rahel Varnhagens: Nerven, Schmerz und Krankheit[^* Der vorliegende Beitrag bietet Einblick in die März 2024 abgegebene Masterarbeit.]
Die thematische Ausrichtung auf den Körper in den Briefen Rahel Varnhagens (1771–1833) ist keineswegs dem Zufall geschuldet. Vielmehr offenbart sich in dieser Korrespondenz ein zentrales Anliegen der Verfasserin, das durch die prominente Betonung von Sensibilität und Krankheit gekennzeichnet ist. Bei der Untersuchung dieses Zusammenhangs im kulturgeschichtlichen Kontext der Epoche wird deutlich, dass die Wahl dieses Themas keineswegs willkürlich erfolgte, sondern durch den medizinischen Diskurs ihrer Zeit determiniert war. Eine herausragende Bedeutung maßen die zeitgenössischen Diskurse den Nerven als zentraler Struktur des Körpers bei. Mit diesen Strukturen wurde neben der individuellen Sensibilität auch die Anfälligkeit des Menschen gegenüber Krankheiten erklärt. Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist ein Korpus von 244 Briefen, die an insgesamt 21 verschiedene Adressaten gerichtet waren. Dabei liegt der Fokus auf der Korrespondenz Rahel Varnhagens mit einer Bandbreite von Adressaten, darunter ihr Ehemann K. A. Varnhagen, ihre Geschwister Markus Theodor, Moritz und Ludwig und Rose sowie enge Freunde wie der Mediziner David Veit, der schwedische Diplomat Karl Gustav von Brinckmann, Wilhelm von Humboldt und die Schriftstellerin Regina Frohberg.
Zu Beginn soll kurz auf das Briefwerk von Rahel Varnhagen eingegangen werden. Anschließend wird das vorherrschende neurologische Modell des Körpers in der medizinischen Praxis dieser Zeit behandelt. Dies dient als Basis, um abschließend die Beschreibung eines Nervenanfalls bei Varnhagen darzustellen und zu analysieren.
Rahel Varnhagen und ihre Korrespondenz:
Ein Überblick
Die Prominenz der jüdisch-deutschen Intellektuellen Rahel Varnhagen, die auch unter den Namen Rahel Levin oder Rahel Robert bekannt ist, in der Korrespondenz ihrer Zeit ist unbestreitbar. Ihr Ansehen gründet sowohl auf der Qualität als auch der Anzahl ihrer Briefe. Bis dato sind über 6000 dieser Schriftstücke bekannt, in denen sie mit etwa 300 Adressaten in Kontakt stand (vgl. Trejnowska-Supranowicz 2011: 303). Dieser Kreis umfasste vor allem einflussreiche Persönlichkeiten des deutschen Kulturlebens, wie etwa Wilhelm von Humboldt, Achim von Arnim, Heinrich Heine und Jean Paul. Ihr prominentestes Werk ist die Briefsammlung ‚Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde‘, das im Jahr 1834 posthum veröffentlicht wurde. In ihrer Rolle als Intellektuelle und Schriftstellerin spielte Rahel Varnhagen eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung der Ideen der deutschen Romantik. Sie war unmittelbar mit dem Geist dieser Ära verknüpft, die sich durch eine nachdrückliche Betonung von Emotionen, Individualität, Vorstellungskraft sowie dem Streben nach der Verkörperung innerer Wahrheit und Authentizität auszeichnete. Die literarische Brillanz der Briefe ist in hohem Maße den Prinzipien der romantischen Briefkultur zu verdanken. Die Romantik befreite den Brief von rein praktischen Verpflichtungen und eröffnete dem Schreiben Raum für Selbsterkundung und poetische Experimente. In der Fachliteratur wird Varnhagen nicht selten als „Revolutionärin des Briefes“ bezeichnet (vgl. Dampc-Jarosz 2010: 14). Trotz der begeisterten Aufnahme ihrer Briefwerke verzichtete Varnhagen beharrlich darauf, in der Öffentlichkeit als Autorin in Erscheinung zu treten. Durch ihre bewusste Distanzierung von den Strukturen des von Männern geprägten Literaturbetriebs erscheint sie oft als Autorin ohne formales Œuvre. Die Briefe von Rahel Varnhagen stellen eine unschätzbare Quelle von Informationen über ihren Gesundheitszustand dar, insbesondere im Hinblick auf ihr Leiden an verschiedenen gesundheitlichen Störungen, zu denen auch Nervenprobleme gehörten. Dabei gelang es Varnhagen, nicht nur über ihre körperlichen Beschwerden zu berichten, sondern auch über ihre emotionalen Empfindungen, Spannungen und inneren Unruhen, die häufig mit ihrer Krankheit einhergingen.
Die Nerven als Schlüsselstruktur: Medizinischer Diskurs der Romantik
Die Briefe von Rahel Varnhagen heben insbesondere die Bedeutung von Sensibilität und Krankheit hervor, zwei Themen, die eng mit den medizinischen Ideen ihrer Zeit verwoben sind. In der Romantik standen die Nerven im Mittelpunkt der medizinischen Diskussion. Sie galten nicht nur als zentrale Struktur des Körpers, die die Körperfunktionen steuerte, sondern auch als Bindeglied zwischen Körper, Geist und Seele. Diese Sichtweise führte dazu, den Menschen als eine Einheit zu betrachten, in der Körper und Psyche miteinander verbunden sind. In dieser Zeit beruhte die Bedeutung der Nerven auf empirischer Evidenz. 1743 gelang es Albrecht von Haller, die entscheidende Rolle der Nerven im Funktionieren des Körpers zu etablieren. Sie wurden als Strukturen identifiziert, die äußere Reize wahrnehmen, interne Signale weiterleiten und für jede Muskelbewegung verantwortlich sind. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die berühmten Experimente von Luigi Galvani und flossen ebenso in die romantische Medizin ein, die sich stark von den Schriften Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings inspirieren ließ. Diese Schriften betonten die Bedeutung der Elektrizität und ihrer Wirkung auf den Körper. Diese Forschungen waren von Bedeutung nicht nur für Medizin und Physiologie, sondern auch für Kultur und Literatur. Die Experimente weckten das Interesse an der Natur des Lebens und des Todes sowie an der Rolle von Seele und Körper und deren Verbindung (vgl. Corbin / Courtine / Vigarello 2020: 38). Die Nerven wurden als entscheidendes Element der menschlichen Psyche, Emotionen und Kreativität betrachtet, sowie als Quelle von Krankheiten und Leiden. Der in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts hochgeschätzte Diskurs über Sensibilität bezog sich in vielen Aspekten auf das neurologische Modell des Körpers. Die Empfindsamkeit wurde mit der Feinheit der Nerven begründet. Die zeitgenössische medizinische Sichtweise führte nahezu sämtliche Krankheitszustände auf die Beschaffenheit der Nerven zurück, sei es durch deren Überreizung oder Verminderung der Aktivität. In naturwissenschaftlichen und medizinischen Schriften dieser Zeit spielten Begriffe wie „Irritabilität“, „Empfindlichkeit“ und „Sensibilität“ eine herausragende Rolle, da sie sowohl die Nerven als auch die Muskeln stimulierten. Im 19. Jahrhundert vollzog sich in der Medizin ein Paradigmenwechsel in der Auffassung von Nervenkrankheiten. Durch die fortschreitende Präzisierung im Verständnis der Nervenfunktion erlangten Mediziner die Fähigkeit, eine Vielzahl von Krankheitsbildern, die zuvor womöglich nicht eindeutig zugeordnet werden konnten, nunmehr exakt zu diagnostizieren und zu systematisieren. In diesem Zusammenhang etablierte sich u. a. der Begriff Nervenfieber als Bezeichnung für eine Vielzahl von Krankheitsbildern, die mit nervösen Symptomen einhergehen (vgl. Bartels 1837: VII–XI). In der Korrespondenz Rahel Varnhagens findet sich eine reichhaltige Sammlung von ausführlichen Beschreibungen dieser Beschwerden.
Die sprachliche Charakteristik der medizinischen Schriften dieser Zeit wird von Katarzyna Jaśtal ausführlich beschrieben.
Wenden sich medizinische Texte in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.s der Beschaffenheit des Nervensystems, bzw. der „Nervenfibern“ zu, operieren sie mit Attributen „schwach“, „zart“, „delicat“, „empfindlich“, „schlaff“, „erschöpft“, bzw. „stark“, „robust“. Wird die Einwirkung eines Stimulus auf das Nervensystem beschrieben, heißt es, die Nerven würden „gereizt“, „erregt“, „irritiert“, „afficiert“. In der Folge kommt es zu „Anstrengung“, „Anspannung“, bzw. „Über(an)spannung“ oder „Überreizung“, die zu „Zuckungen“, „Krämpfen“ oder gar „Convulsionen“ führen können (Jaśtal 2009: 59).
Nerven in der Korrespondenz Rahel Varnhagens
In dem Zeitraum um 1800 waren nervöse Erkrankungen die häufigste Form gesundheitlicher Beeinträchtigung. Die breite Verwendung des Begriffs Nervenleiden in dieser Epoche spiegelte die Schwierigkeiten der Ärzte wider, diese vielfältigen Symptome in enge medizinische Kategorien einzuordnen. Die zeitgenössische medizinische Gemeinschaft konzentrierte sich stark auf die Erforschung des Nervensystems und seiner Rolle bei der Entstehung von Krankheiten. Solche Nervenprobleme wurden als vielschichtig betrachtet, da sie eine breite Palette von körperlichen und geistigen Symptomen umfassten. Anhand eines exemplarischen Briefes Rahel Varnhagens vom 15. Dezember 1811 wird deutlich, wie eng ihre Beschreibungen von körperlichen und seelischen Zuständen mit dem medizinischen Diskurs ihrer Zeit verbunden sind. In diesem Brief schildert sie einen Nervenanfall von bisher ungekannter Intensität. Ihre detaillierte Beschreibung der körperlichen Symptome, begleitet von emotionalen Zuständen wie Angst und Erschöpfung, offenbart eine enge Verbindung zur zeitgenössischen Medizin:
Donnerstag vor acht Tagen bekam ich Nervenanfälle, wie ich sie nie hatte. Zittern und Dröhnen im höchsten Grade: ich wurde gehalten, sprach im Anfang unaufhörlich; von halb 10 ging’s an (…). Oft konnt ich nichts sprechen, mein Gesicht grimassirte. Ich rief nach dir: und in Augenblicken, wo mir Zunge und Gaumen kalt wurden, und das Gehirn aufhören wollte, dacht’ ich zu sterben. Ohne Angst. Vorher in der Nervenangst hatte ich gräßliche: aber noch nicht solche, wie ich schon genossen habe (…). Als Line weg war, kam das Dröhnen auf’s Äußerste! Die Zunge wurde nach einiger Neigung zum Erbrechen – welches wohl an vierzehnmal geschah – ganz kalt; Zittern und Dröhnen hörten plötzlich auf; ich ward wie müde: glaubte, so stirbt man. (…) gegen 7 schlief ich ein. Den ganzen Tag schlief ich krankhaft, mit einem Nebel um’s Gehirn; ich trank schwarzen starken Kaffee um es zu bändigen; kam in Agitation; heilte mich langsam mit Stilliegen und Limonade. Töne konnt’ ich nicht ertragen. Lesen, Töne und Schreiben noch schwer (Varnhagen von Ense 2015: 455f.).[^1 Rahel Varnhagen von Ense an Karl August Varnhagen, Brief v. 15.12.1811.]
Diese Passage zeigt die intensive Auseinandersetzung der Autorin mit einer nervlichen Erkrankung. Sie bedient sich detaillierter Beschreibungen der körperlichen Symptome wie Zittern, Grimassieren, d. h. Verkrampfen des Gesichts, gestörtes Temperaturempfinden, Geräuschempfindlichkeit und Übelkeit. Gleichzeitig vermittelt sie Zustände wie Angst und Erschöpfung. Die Autorin verwendet Adjektive wie „gräßlich“ und „krankhaft“, um die Schwere der nervösen Symptome zu unterstreichen. Auch nach dem Abklingen der Symptome ist der Zustand nicht befriedigend. Es wird festgestellt, dass die Verfasserin keine Geräusche erträgt und Schwierigkeiten beim Lesen, Hören und Schreiben hat. Dies deutet darauf hin, dass sie an einer Übererregung oder einer eingeschränkten kognitiven Funktion leidet. Die Autorin hat das Gefühl, dass ihr Körper und ihr Geist kaum noch funktionsfähig sind. Die Beschreibung von Kältegefühlen an Zunge und Gaumen deutet auf eine gestörte Wahrnehmung hin. Die Autorin macht sich Gedanken über die Funktion des Gehirns, des neurologischen Zentrums des Körpers. Es scheint, dass die Verfasserin mit einer bisher unbekannten Intensität der Beschwerden und einer Art nervöser Angst konfrontiert ist. Das Gefühl der Todesnähe wird in der Passage zweimal betont, was den Verlust der Lebenskraft während der Anfälle implizieren kann. Sie schläft lange, aber krankhaft und „mit einem Nebel um’s Gehirn“. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie an einer Art Erschöpfungszustand oder psychischem Stress leidet, der zu starker Schläfrigkeit führt. Es wird angegeben, dass sie schwarzen, starken Kaffee trinkt, um dieser Müdigkeit entgegenzuwirken. Die Verwendung von Kaffee als Nervenstimulans kann auf den Versuch hindeuten, die geistige Wachheit und Konzentration wiederherzustellen, möglicherweise um wieder schreiben zu können. Aufgrund früherer Erfahrungen mit nervösen Anfällen versucht die Autorin, die Homöostase, d. h. das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen, zu erreichen.
Wie sich der Zustand ihrer Nerven auf ihren Alltag auswirkte, wird in vielen Briefen Rahels deutlich. Immer wieder schildert Rahel Varnhagen Situationen, in denen sich ihr physisches Leiden auf ihren seelischen Zustand auswirkte und umgekehrt. Die Zusammenhänge zwischen dem Nervenapparat und dem Schreiben sind komplex und können sowohl auf die produktiven als auch auf die funktionalen Aspekte des Schreibens bezogen werden. Die nervlich bedingte Schreibunfähigkeit wirkte sich auch auf ihren Schreibstil aus. Sehr häufig werden verschiedene Nervenmetaphern verwendet, z. B: „Kein Wunder der Nerven“ (Varnhagen von Ense 2011: 93).[^2 Rahel Varnhagen von Ense an Karl August Varnhagen, Brief v. 28.3.1814.] In den Phasen, in denen ihre Nerven in Aufruhr waren, kann man beobachten, dass ihre Texte an Intensität und Emotionalität gewinnen. Möglicherweise griff sie auf eine reichere Sprache und tiefere Gefühle zurück, um die inneren Turbulenzen, die sie empfand, zum Ausdruck zu bringen.
Schlussfolgerungen
Die Untersuchung der Briefe Rahel Varnhagens bietet einen erhellenden Einblick in die Verknüpfung von Körpererfahrungen mit dem medizinischen Diskurs des 19. Jahrhunderts. Die präzisen Schilderungen von Nervenleiden und deren Verbindung zur Sensibilität und Krankheit bieten einen einzigartigen Einblick in die literarische Produktion dieser Epoche. Dieses Werk wirft ein neues Licht auf die Art und Weise, wie Schriftstellerinnen und Schriftsteller jener Zeit ihre körperlichen Empfindungen in ihre Werke integrierten und sie als Medium für Ausdruck und Selbstreflexion nutzten. Die Briefe Rahel Varnhagens ermöglichen somit nicht nur eine differenzierte Sicht auf ihr eigenes Leben und ihre Gesundheit, sondern auch auf das kulturelle Umfeld, in dem sie agierte. Ihre Beschreibungen von Nervenleiden reichen über schlichte medizinische Berichte hinaus – sie sind zugleich literarische Artefakte, die tiefe Einblicke in die Psyche der Autorin gewähren. Dabei verdeutlichen sie, wie stark die damalige Medizin und der literarische Diskurs miteinander verknüpft waren. Die umfassende Analyse dieser Briefe verspricht weiterführende Erkenntnisse über dieses bedeutende Werk des 19. Jahrhunderts und die Wechselwirkungen zwischen dem medizinischen Diskurs und der Briefkultur dieser Ära. Es bietet einen reichen Schatz an Informationen nicht nur für Literaturhistoriker, sondern auch für Medizinhistoriker, die an der Verbindung zwischen Körpererfahrungen und der damaligen medizinischen Denkweise interessiert sind.
Primärliteratur
- Varnhagen von Ense, Karl August, 1874. Briefwechsel zwischen Varnhagen und Rahel. Zweiter Band, hg. Ludmila Assing. Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Varnhagen von Ense, Rahel. 2011. Rahel: Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Bd. 2, hg. Barbara Hahn. Göttingen: Wallstein.
- Varnhagen von Ense, Rahel. 2011. Rahel: Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Bd. 3, hg. Barbara Hahn. Göttingen: Wallstein.
- Varnhagen von Ense, Rahel. 2015. Rahel: Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, hg. Inge Brose-Müller. Berlin: Golkonda.
Sekundärliteratur
- Bartels, Ernst Daniel August. 1837. Die gesammten nervösen Fieber: In sich begreifend die eigentlichen Nervenfieber nebst den Fieberseuchen und Wechselfieber theoretisch untersucht und praktisch abgehandelt. Erster Band: Einleitung, Uebersicht mit Tabellen, Pathogenie. Berlin: Rücker und Püchler.
- Dampc-Jarosz, Renata. 2010. Zwierciadła duszy: Estetyka listów pisarek niemieckich epoki klasyczno-romantycznej. Wrocław: Atut Oficyna Wydawnicza.
- Dampc-Jarosz, Renata / Zarychta, Paweł. 2019. „... nur Frauen können Briefe schreiben“: Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750. Bd. 2. Wien: Peter Lang.
- Hahn, Barbara. 2011. „Still und bewegt“: Rahel Levins Konstellationen. MLN 3. 486–494.
- Heischkel, Edith. 1952. Das Wasser als Arzneimittel in der romantischen Medizin. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 36 (3). 119–149.
- Jaśtal, Katarzyna. 2009. Körperkonstruktionen in der frühen Prosa Heinrich Heines. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Lohff, Brigitte. 1980. Die Entwicklung des Experimentes im Bereich der Nervenphysiologie: Gedanken und Arbeiten zum Begriff der Irritabilität und der Lebenskraft. Sudhoffs Archiv 64 (2). 105–129.
- Oldenburg, Dieter. 1981. Georg August Bertele (1767–1818) und die Arzneimittellehre der romantischen Naturphilosophie. Medizinhistorisches Journal 16 (3). 240–256.
- Rommel, Gabriele. 2004. Romanticism and Natural Science. In Mahoney, Dennis F. (Hg.), The Literature of German Romanticism. 209–227. Martlesham: Boydell & Brewer.
- Trejnowska-Supranowicz, Renata. 2011. Die Stellung der Frau in der Romantik und ihre Widerspiegelung in Rahel Varnhagens Briefen. Acta Neophilologica XIII. 303–313.
- Ulrich, Bernd. 2020. Die Nerven- und Nervositätsdebatten vor 1914 – Organische Schwäche oder traumatische Neurose. In Gahlen, Gundula / Gnosa, Ralf / Janz, Oliver (Hg.), Nerven und Krieg: Psychische Mobilisierungs- und Leidenserfahrungen in Deutschland (1900–1939). 21–36. Frankfurt a. M. / New York: Campus.
- Porada, Aleksandra. 2024. Körperdarstellung in der Korrespondenz Rahel Varnhagens: Nerven, Schmerz und Krankheit. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Dualistische Identität
Dualistische Identität Figurenkonzeptionen in den frühen Novellen Thomas Manns[^* Der vorliegende Beitrag bietet einen Einblick in den Inhalt und anthropologischen Ansatz der 2023 unter dem gleichen Titel abgegebenen Bachelorarbeit.]
Der vorliegende Beitrag soll möglichst präzise den Inhalt meiner 2023 fertiggestellten Bachelorarbeit darstellen und den Gehalt des Themas skizzieren. Dabei wird die übergeordnete Frage nach der Vermittlung anthropologischen Wissens durch Literatur, genauer durch die Konzeptionen von literarischen Figuren, aufgeworfen und am Beispiel zweier Protagonisten aus Thomas Manns Frühwerk verhandelt. Was sagen Selbstverständnis, Lebensweg, Erzählerbeschreibung und Lebensende über die Figuren im literarischen Werk aus und inwiefern bereichert Literatur den anthropologischen Diskurs? Kann der Versuch Nietzsches einer Welt- und Lebenskonzeption in Form einer ästhetischen Metaphysik für das Individuum gelten? Den Gegenstand bilden die von Thomas Mann verfassten und im Jahr 1897 veröffentlichten Novellen ‚Der kleine Herr Friedemann‘[^1 Die Novelle wird im Folgenden zitiert nach Mann, Thomas. 2002. Der kleine Herr Friedemann. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 2.1. Frühe Erzählungen 1893–1912. S. 87–119, hg. und textkritisch durchgesehen von Terrence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: S. Fischer.] und ‚Der Bajazzo‘.[^2 Die Novelle wird im Folgenden zitiert nach Mann, Thomas. 2002. Der Bajazzo. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 2.1. Frühe Erzählungen 1893–1912. S. 120–159, hg. und textkritisch durchgesehen von Terrence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: S. Fischer.] Nach einem kurzen geistesgeschichtlichen Abriss und der Inhaltsbeschreibung der Novellen wird anhand von Textbeispielen die Verknüpfung von Friedrich Nietzsches und Thomas Manns anthropologischen Ausführungen aufgezeigt.
Die Frage nach dem Ich
Ein Blick in die Geistes-, Ideen- und Literaturgeschichte lässt das ausgehende 19. Jahrhundert und die Jahrhundertwende als eine Zeit inniger Beschäftigung mit dem Subjekt in Erscheinung treten. Die vorausgehende Entwicklung von der Antike über das Mittelalter zeigt, dass mit dem Angehen anthropologischer Fragen und die Verhandlung des Individuums mit und in seinen „Individualitätskriterien“ (Gerok-Reiter: 2) bereits das anthropologische Potential der Literatur aufgedeckt wurde. Diese Entwicklungen stellen die Funkenschläge dar, mit denen das Feuer entfacht wurde, das als Individualität auf den Begriff gebracht, die Bewusstheit des Individuums in seiner Individualität (vgl. Gerok-Reiter: 1) und die Selbstbestimmung des Individuums meint, die wiederum einen weiteren Entwicklungsstand in der Literaturanthropologie einnehmen. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts erhielt diese Perspektive der Literatur eine zentrale Stellung. Gesellschaftliche und politische Institutionen wurden zusehends in Frage gestellt und der statische Zustand der Tradition und Konvention wich dem dynamischen einer individuellen Mobilität. Das Ich ist seither ein fluides Konstrukt, es ist entwicklungsfähig und nicht mehr an die transzendentale Übermacht eines Gottesplanes gebunden. Im Zuge des Befreiungsschlags des Subjekts und der einhergehenden Abwendung von tradierten Normen wurde jedoch spätestens mit der Französischen Revolution (1789–1795) die Gefahr der Entwurzelung als eine Entfremdungserfahrung offenbar, die die Individualisierung mit sich brachte (vgl. Willems 2015: 331). Die Loslösung von der Umwelt bedeutet die Gefährdung einer äußeren Bindung und eines inneren Halts (vgl. ebd. 331). Daraus entwickelte sich die entscheidende Erkenntnis einer engen Verbindung von Innenwelt und Außenwelt, indem das Selbst seine Festigkeit aus der Gewohnheit bezieht, weil es sich mit den äußeren Umständen tradierter und konventionalisierter Werte auseinandersetzt, sich in die einhergehenden Systeme integriert und sich in ihren Kategorien denkt. Diese Wechselbeziehung aus Selbstentfaltung des Inneren und Anpassung an eine Außenwelt wird zum literarischen Grundthema (vgl. ebd.: 332f.), das bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat. Figuren werden zu Versuchen einer individuellen Entwicklung und Selbstfindung. Ausgehend von Goethes ‚Wilhelm Meister‘ treten die Werke der Klassischen Moderne von Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, Robert Musil und vielen weiteren als Experiment, Studie oder Skizze des menschlichen Seins und Lebens hervor. Dadurch beweist die Literatur den Stellenwert als ein eigenständiger Wissensspeicher und Medium der Wissensvermittlung anthropologischer Inhalte zu sein. Ihr gilt es, das aus Naturwissenschaft, Philosophie, später Psychologie und Soziologie synthetisierte Wissen nicht nur zu veranschaulichen und wortwörtlich mit Leben zu füllen, sondern auch die Erprobung der Theorie am geschriebenen Menschen. Der anthropologische Gehalt in der Literatur wird spätestens damit offenkundig. Sie nimmt sich der Frage nach der Aushandlung von Selbstentfaltung und Anpassung an, spekuliert auf das richtige Verhältnis von Integration und Entfaltung, erprobt, inwiefern eine Anpassung des Ich überhaupt noch mit der zeitgenössischen Gesellschaft kompatibel ist und wann Entfremdung eintritt bzw. wie es sie zu verhindern gilt (vgl. ebd.: 333). Literatur wird damit ebenfalls zunehmend Ausdruck und Reflexion des Individuums. Das geistesgeschichtliche Klima, in welchem Thomas Mann seine Novellen schreibt, ist geprägt von der Suche nach dem Selbst. Entscheidend für sein Schreiben wird die von Arthur Schopenhauer eingeläutete Anthropologische Wende. Nach Einschätzung Georg Simmels sei sie die „Achsendrehung im Begriff des Menschen“ (Simmel 1990: 84), da nun der Mensch von der vernunftabgeneigten Seite, sprich der des Unter- und Unbewusstseins betrachtet wurde. Schopenhauer proklamiert das menschliche Leben als den Willen zum Leben, allein der Trieb zur Selbsterhaltung mache den Menschen aus – „nicht ich denke und handle, sondern es denkt und handelt durch mich“ (Willems 2015: 334). Damit wird nicht nur die vernunftgeleitete Konstruktion eines Selbst, sondern auch die Möglichkeit der Selbstentfaltung destabilisiert. Wie autonom kann das Ich sein, wenn Freud feststellt, „daß das Ich nicht Herr sei im eigenen Haus“ (Freud 2017: 4). Mensch sein, das heißt laut der Philosophie nun gespaltet sein, in der „Vorstellung von einem mehrdimensionalen, aus bewußten und unbewußten Anteilen zusammengesetzten Ich“ (Willems 2015: 335).
Thomas Mann und das Individuum
Die Faszination Thomas Manns für das Thema Menschsein und Selbstverwirklichung bzw. der Konflikt zwischen Individuum und Umwelt wird im gesamten, besonders aber im Frühwerk in der Auseinandersetzung eines Künstlertypus mit dem Milieu des Bürgertums deutlich. Manns Faszination mag einerseits mit dem generellen Zeitgeist, wie oben geschildert, zu tun haben, war aber sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass er selbst bei Veröffentlichung der Novellen erst 22 Jahre alt, also genau in dem Lebensalter der Selbstverwirklichung war, wo dem ideellen Selbstbild eine realistische Lebensweise folgen sollte. Zudem ging den Novellen eine intensive Lektüre Schopenhauers und Nietzsches voraus, die den Autor bannten und die Schicksale seiner Figuren inspirierten. Die Novellen, beide Ergebnisse längerer Arbeitszeit und einer grundlegenden Überarbeitung, erschienen 1897 im Novellenband ‚Der kleine Herr Friedemann‘, bezeichnenderweise gleichnamig der Novelle, die für Thomas Mann den Durchbruch seines literarischen Schaffens bedeutete. In ihnen wird die Gedankenwelt, Inspiration und Konfliktlage des jugendlichen Schriftstellers offenbar und sie künden von der Bürde der Identitätsentfaltung und Selbstbehauptung. In den Novellen können auf mehreren Ebenen Parallelitäten nachgewiesen werden, was den Vergleich umso erstrebenswerter macht. Im Mittelpunkt beider Erzählgeschehen steht ein männlicher Protagonist, der als lebenssinnsuchendes Individuum sein Leben gestaltet. Beide Protagonisten entstammen einer alten Kaufmannsfamilie, sind also im bürgerlichen Milieu geboren und behütet aufgewachsen. Die Mutterfiguren spielen in der Erziehung beider eine zentrale Rolle, indem sie ihre Söhne an die Musik und Kunst als eine Art illusionistische Idealwelt heranführen und ihre künstlerische Begabung geschichtenerzählend und klavierspielend entfachen und fördern. Das geht beim Bajazzo so weit, dass er sich die künstlerische, aber weltfremde Lebensweise seiner Mutter aneignet. Zentral ist ebenfalls der Umstand, dass sich sowohl Johannes Friedemann als auch Bajazzo bereits im Kindesalter als eine Art Abweichung der sozialen Norm einordnen lassen, dieser Abweichungsgrad wird ihr Leben weitgehend bestimmen. Die körperliche Behinderung, die Friedemann im Zuge eines Sturzes vom Wickeltisch erlitt und ihn augenscheinlich mit seiner „spitzen und hohen Brust, seinem weit ausladenden Rükken und den viel zu langen Armen“ (‚Der kleine Herr Friedemann‘, S. 89) vom „vitalistischen Ideal“ abgrenzt, ist genauso lebenszeichnend wie die künstlerische Begabung des Bajazzos. Diese „Bajazzobegabung“ (‚Der Bajazzo‘, S. 127) erscheint weder mit den Werten des altväterlichen Bürgertums (Konvention) noch mit den tradierten Erwartungen der Familiendynastie (Tradition) kompatibel. Bereits auf den ersten Seiten der Erzählungen wird ein Konflikt zwischen Innen und Außen als dem Körperlichen und dem Geistigen, dem Individuum und der Umwelt, auf identitärer Ebene dem Idealistischen und dem Realistischen offenbart. Im weiteren Geschehen begründen die Protagonisten genau auf diesem Umstand ihre Individual- und Lebensentfaltung, die sich als Rückzug ins Innere, bei Friedemann in einer kontemplativen Flucht in die Kunst unter Ausschluss des Sexualtriebes und bei Bajazzo als ein narzisstisch-hochmütiger Akt der Selbsterhöhung unter Abgrenzung von der Gesellschaft, verwirklicht wird. In der Eindimensionalität ihrer Lebensweisen bemerken die Protagonisten nicht, dass ihre Art zu leben ein einziger Selbstbetrug ist. Erst mit dem Auftreten zweier Frauenfiguren, die als Sehnsuchtsobjekt und Lebensallegorie den Protagonisten als Korrektiv dienen, wird ihnen bewusst, dass ihre Individualitätsentfaltung nur der fragile idealistische Schein einer Idee vom Selbst war, der in Konflikt mit ihrer Natur (Sexualtrieb) und Umwelt (Gesellschaftskonvention) steht. Schlussendlich, vom eigenen Körper bezwungen, zieht Friedemann den einzig in der Übermacht seines Geistes logischen Schluss des Suizids, er ertränkt sich im Park der Frau, die die Kontrolle über seine körperlichen Triebe delegitimiert hat. Auch Bajazzo denkt über Suizid nach, entscheidet sich allerdings dagegen und vegetiert desillusioniert in Auflösung seines Inneren (vgl. ebd., S. 20) als inhaltslose Form weiter.
|
Struktur |
‚Der kleine Herr Friedemann‘ |
‚Der Bajazzo‘ |
||
|---|---|---|---|---|
|
I |
Exposition, Einführung ins Geschehen |
S. 87f. |
Exposition, Einführung ins Geschehen |
S. 120 |
|
II |
Kindheit und Jugend |
S. 88f. |
Kindheit und Jugend |
S. 121–131 |
|
III |
Konfrontation mit dem Leben I |
S. 90f. |
Konfrontation mit dem Leben I |
S. 131f. |
|
IV |
Konstruiertes Lebenskonzept |
S. 91–99 |
Konstruiertes Lebenskonzept |
S. 133–143 |
|
V |
Konfrontation mit dem Leben II |
S. 99–103 |
Konfrontation mit dem Leben II |
S. 143–152 |
|
VI |
Krise |
S. 103–115 |
Krise |
S. 152–158 |
|
VII |
Tod |
S. 115–119 |
„Tod“ |
S. 158f. |
Abbildung 1: Tabellarische Veranschaulichung der Novelleninhalte.
Der strukturelle Aufbau der Novellen kann somit in inhaltliche Abschnitte gegliedert werden, die in beiden Novellen bis auf den tödlichen Ausgang identisch sind. An den von Goethe geprägten Bildungsroman erinnernd, wird der gesamte Lebensweg vom Kleinkindalter bis zum Erwachsenendasein verfolgt und beschrieben, was wiederum die Darstellung der Entwicklung beider Protagonisten zulässt. Vermittelt werden diese im ‚Friedemann‘ durch eine heterodiegetische, im Bajazzo durch eine autodiegetische Erzählinstanz, in Form eines tagebuchähnlichen Gedächtnisabrisses, der als „meine ‚Geschichte‘“ (ebd., S. 120) benannt wird. Der Novellencharakter wird durch die „Unerhörte Begebenheit“ (Verweis auf den Novellenbegriff von J. W. v. Goethe) als eine Wendung im Erzählgeschehen beibehalten, die im Erweckungsmoment der Protagonisten als Konfrontation des idealistischen Selbstbildes mit der Lebensrealität die Lebenskrise beider Protagonisten einläutet. Für die Figurenkonzeptionen von besonderem Wert sind allerdings die dichotomen Motivkonstellationen in den Figurenbeschreibungen. So lassen sich über die gesamten Novellen zweiteilige, zumeist antithetische Positionen rund um die Figuren feststellen, allen voran der bereits genannte und übergreifende Gegensatz eines Inneren und Äußeren:
Sehr möglich immerhin, […] daß ich noch ein Viertel- oder Halbjahr fortfahre, zu essen, zu schlafen und mich zu beschäftigen – in der selben mechanischen, wohlgeregelten und ruhigen Art, in der mein äußeres Leben während des Winters verlief und die mit dem wüsten Auflösungsprozeß meines Innern in entsetzlichem Widerstreite stand (‚Der Bajazzo‘, S. 120).
Konkreter wird es, wenn Friedemann, gekränkt durch die Abfuhr eines heimlich verehrten Mädchens, seine körperlich spürbaren Affekte mittels des Verstandes zu unterdrücken sucht und damit den Konflikt zwischen Körper und Geist antizipiert. „[E]in scharfer, drängender Schmerz stieg ihm aus der Brust in den Hals hinauf. Aber er würgte ihn hinunter und richtete sich entschlossen auf“ (‚Der kleine Herr Friedemann‘, S. 90). Der aus der Herzgegend kommende Liebesschmerz erreicht nicht den Kopf als Zentrale des Menschenverstandes und wird symbolisch abgewürgt. Oder wenn sich Bajazzo zwischen den konträren Lebensweisen seiner Eltern entscheidet und keinen Mittelweg findet:
Ich saß in einem Winkel und betrachtete meinen Vater und meine Mutter, wie als ob ich wählte zwischen den beiden. […] Und mein Blick verweilte am Ende auf dem stillen Gesicht meiner Mutter (‚Der Bajazzo‘, S. 123).
Solcherlei Aussagen geben Hinweise auf das mehrdimensionale Ich und die vielseitigen Einflussfaktoren, die auf die Identität einwirken und Aushandlung sowie Verarbeitung in uns bedürften. Beide Figuren sind allerdings dazu nicht in der Lage und positionieren sich zu einer der beiden konfligierenden Seiten.
Identität und Anthropologie in der Literatur
Die Produktion und Rezeption von Literatur sind spezifisch menschliche Tätigkeiten, die immer mit einer Reflexion des Menschendaseins einhergehen. In dieser reflexiven Arbeit wird Menschsein in eine Art narrative „Zwischenwelt“ (Riedel 2014: VIII) zwischen Welt und Individuum rekonstruiert, hinterfragt und weitergedacht (vgl. Urbich 2011: 218f.). Damit kommt Literatur auch die Kompetenz zu, Wissen über den Menschen zu generieren. Die methodische Bedeutung literaturanthropologischen Wissens liegt in der literarischen Darstellung und Bewertung eines vermittelten Welt-, Lebens- und damit auch Menschenkonzepts. Literarisches Wissen manifestiert sich dabei in der Figurenkonstruktion Thomas Manns.
In der Konstitution eines literarischen Identitätsbegriffs geben
Literatur und literarische Anthropologie dem modernen Selbstbewusstsein Raum […], weil sie die objektivierten ‚Anthropologien der dritten Person‘, die die empirischen und theoretischen Disziplinen bereitstellen, unter der Perspektive von Erfahren, Erleben und Fühlen in individualisierte, subjektive, expressive usw. ‚Anthropologien der ersten Person‘ verwandeln. Im literarischen ‚Ich‘, es spreche Vers oder Prosa, ist das ‚Man‘ der Wissenschaften vom Menschen immer schon unterlaufen (Riedel 2014: 380).
Damit kann sowohl von einem literarisch vermittelten anthropologischen Wissensgehalt in den Figurenkonzeptionen als auch von einem den Novellen inhärenten Identitätsbegriff ausgegangen werden. Nicht die schematische Rekonstruktion und der Abgleich vorgefertigter Ideen der Philosophie im literarischen Text, sondern der Diskurs um den Menschen, der sich in der Form der Figurenidentität abbilden lässt, wird somit Fokus der Analyse und literarischer Wert.
Dualistische Identität
Der Leitdiskurs, mit dem sich die Figurenkonzeptionen verbinden lassen, ist die Lebensphilosophie Nietzsches. Im ersten seiner Werke ‚Die Geburt der Tragödie‘ stellt er ein ästhetisches Weltmodell vor, die „Artisten-Metaphysik“ (Nietzsche 1980: 17), aus dem die attische Tragödie als Kunstwerk des Lebens aus der gelegentlichen Symbiose zweier Ur-Kräfte entsprungen ist. So sei die
Fortentwicklung der Kunst an die Duplicität des Apollinischen und des Dionysischen gebunden […]: in ähnlicher Weise, wie die Generation von der Zweiheit der Geschlechter, bei fortwährendem Kampfe und nur periodisch eintretender Versöhnung, abhängt (ebd., 25).
In diesem ästhetischen und biologischen Gleichnis der Geburt der Tragödie aus dem Zusammenspiel zweier ästhetischer Triebkräfte und der Geburt des Menschen aus der Vereinigung eines Paares ist das Potential des ästhetischen Weltbildes als ein auf Symbiose mehrerer Einflussfaktoren basierendes Menschenbild zu erkennen. So ist auch der Mensch (die Figur) bei Thomas Mann eine abhängige Symbiose zweier Kräfte, die sich nicht auf das biologische Geschlecht bezieht, sondern jenen Kunsttrieben Nietzsches ausgesetzt ist. Dabei bildet das Apollinische die Kraft der Selbsterkenntnis ab, indem es das Individuum zwingt, sich und seine Umwelt zu ordnen und zu formen. In Reflexion stellt sich das Individuum immer die Frage, wer es ist und was es ausmacht. Dieses beispielsweise aus persönlichen Interessen, Neigungen, Charaktereigenschaften, aber auch sozialen Umständen bestehende Selbstbild ist eine statische und begrenzte Form des Ich. Diese Form ist existenziell notwendig, um Individuum zu sein. Allerdings hat nicht nur die geistige Ideenkonstruktion, wer Ich ist, Einfluss auf das, was Ich tatsächlich ist, sondern auch Umweltfaktoren, die bei Nietzsche als inhärenter Sinn von allem im Dionysischen auftreten. Wird das Apollinische als das ordnende Prinzip benannt, ist das Dionysische eine chaotische und zerstörende Kraft, die das Individuum immer von Neuem zwingt, sich als solches unter neuen Umständen zu erkennen und zu begrenzen – sich selbst also Form zu geben. Die Protagonisten Manns sind damit ab der ersten Seite konfrontiert, wenn Johannes Friedemann körperlich beeinträchtigt nicht die gleichen Lebenschancen wie ein körperlich gesundes Individuum hat und Bajazzo nicht der Konvention und Tradition eines bürgerlichen Kaufmanns, sondern eines Künstlers zu entsprechen scheint. Nietzsches Lösungsvorschlag zielt nun auf die Aushandlung beider Seiten, indem sich das Apollinische unter den Umständen des Dionysischen neuformiert:
[B]eide so verschiedene Triebe gehen nebeneinander her, zumeist im offnen Zwiespalt mit einander und sich gegenseitig zu immer neuen kräftigeren Geburten reizend, um im Kampf jenes Gegensatzes zu perpetuieren […] bis sie […] mit einander gepaart erscheinen und in dieser Paarung zuletzt das ebenso dionysische als apollinische Kunstwerk, der attischen Tragödie zeugen (ebd., 25).
Diese Paarung des Inneren als die Idee des Selbst und dem Äußeren der Lebensrealität wäre als eine identitäre Weiterentwicklung zu benennen: äußere Einflussfaktoren, wie beispielsweise Abweisung, der Tod einer geliebten Person, aber natürlich auch freudige Ereignisse lassen uns ein anderer Mensch sein als zuvor. Die dahinterstehende Dynamik nennt sich Dialektik. Vereinfacht gesagt gibt es eine Position I und eine Gegenposition II, die in Aushandlung eine weitere Position (III) generieren. Die Idee vom Ich (P I) wird durch Einflussfaktoren (P II) verändert und das Ich entwickelt sich weiter (P III). Dieses weiterentwickelte Ich kann wiederum zur Position I werden und es ergibt sich somit eine fortschreitende Dynamik in der Individualentwicklung. In den Novellen hingegen gilt eine Unvereinbarkeit zwischen der konstruierten Form des Selbst und den äußeren Einflussfaktoren, die eine identitäre Weiterentwicklung bedingen würden. Am Text ließe sich die Diskrepanz und Positionierung zum Inneren an folgenden Beispielen belegen: Unmittelbar nach der schmerzhaften Abfuhr eines Mädchens entscheidet sich Johannes Friedemann, sexuelle Begierde und körperliche Nähe aus seinem Leben zu verbannen, diese Seite vollends zu unterdrücken und sich den „geistigen Freuden“ zuzuwenden: „Den anderen gewährt es Glück und Freude, mir aber vermag es immer nur Gram und Leid zu bringen. Ich bin fertig damit. Es ist abgethan. Nie wieder“ (‚Der kleine Herr Friedemann‘, S. 91). Auch Bajazzo grenzt sich als Außenseiterfigur in einer sozialen Sonderstellung von der Gesellschaft erhaben ab, wenn er „ohne die Leute“ (‚Der Bajazzo‘, S. 142) sein Glück zu finden versucht.
Das Prinzip des Dualismus besagt, dass zwei Seiten als unvereinbar gelten und nicht auf denselben Ursprung zurückgehen, die also voneinander getrennt existieren. Daraus resultiert nicht nur eine Stagnation in der Weiterentwicklung des Ich, sondern auch eine wachsende Diskrepanz der nicht auszuhandelnden Seiten. Das führt bei den Protagonisten dazu, dass sie sich in ein künstliches Identitätsideal flüchten und sich von ihrer Umwelt abgrenzen.

Abbildung 2: Lebenskurven der Protagonisten.
In den skizzierten Lebenskurven ist das als horizontal-geradliniger Verlauf erkennbar – ein vermeintlicher Status quo. Das ist ebenfalls auf Erzählerebene nachzuweisen, indem das Erzähltempo entschleunigt wird. Auf den ersten zehn Seiten beider Novellen wird die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen beschrieben, die mit allerlei unterschiedlichen Tätigkeiten im jeweiligen Lebensalter hochdynamisch ist und mit dem 30. Lebensjahr, eben dem Alter, in dem sie sich in die Innerlichkeit zurückziehen, abrupt endet. Thomas Mann benennt diesen Zustand in seinem Essay ‚Form‘ als „Überform“ (‚Form‘, S. 982),[^3 Der Essay wird im Folgenden zitiert nach Mann, Thomas. 2002. Form. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 15.1. Essays II. 1914–1926. S. 730, hg. und textkritisch durchgesehen von Terrence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: S. Fischer.] der die Gefahr in sich birgt, in einer idealistischen Traumwelt die Lebenswelt nicht mehr korrekt wahrzunehmen, ihre Veränderungen und Einflüsse auf das Selbst nicht zu akzeptieren, was ein Leben unmöglich macht. Das Äquivalent zur „Überform“ ist die „Unform“ (ebd.). Beherrscht sie den Menschen, würde das Individuum seine Form und Begrenzung eines Ichs und die Selbstreflexion aufgeben und somit ohne Selbstverständnis vegetieren müssen. Weder dem einen noch dem anderen Extrem zu erliegen, wird zur Gratwanderung für die Figuren in Manns Novellen. Wie an den Lebenskurven deutlich zu erkennen, währt der sichere Status nicht lang, denn mit der Konfrontation der Frauenfiguren Gerda von Rinnlingen und Anna Rainer erwachen die Protagonisten aus ihrer Scheinwelt – „Ich aber, meinesteils? […] Ausgeschlossen, unbeachtet, unberechtigt, fremd, hors ligne, deklassiert[.]“ (‚Der Bajazzo‘, S. 151); Glück? – „das war Lüge und Einbildung“ (‚Der kleine Herr Friedemann‘, S. 117). Die unerhörte Begebenheit, die Heimsuchung des Dionysischen als Eros in dieser Frau bricht die Dämme sexueller Enthaltsamkeit. Die körperlichen Triebe siegen über Friedemanns asketische Lebensweise. Aus Selbstekel, Resultat der Abweisung durch Gerda, findet Friedemann nur im Tod den Triumph über seine Triebwelt. Die Wendung, die Bajazzos innere Auflösung zur Folge hat, ist hingegen ein komplexer, im Text immanent erkennbarer Prozess einer zerfallenden Idee von sich. Diese Identitätskonstruktion basiert einzig auf der Übernahme anderer Künstlerpersönlichkeiten sowie der Auslebung eigener Neigungen, die jedoch im Konflikt mit den gesellschaftlichen Lebensformen steht. Bajazzo vermag nicht zu sagen, was er ist, ob Bürger oder Künstler, und bleibt damit eine inhaltslose „Überform“. Er kann sich nicht in seine Umwelt integrieren, die er im Umgang mit der gutbürgerlichen, glücklichen und sorgenlosen Anna Rainer so ersehnt.
Schlussbetrachtung
„[M]an weiß, was man ist, weiß aber nicht, ob man es werden wird“ (Banuls 2001: 7).
Die dialektische Aushandlung von Apollinischem (dem Geistigen, dem Inneren, der Individualexistenz) und dem Dionysischen (dem Körperlichen, der Erfahrung, den Trieben und Instinkten) stellt sich in den frühen Novellen als unüberwindbare Aufgabe heraus. Ist die Friedemann-Novelle noch nahe an der vitalistischen, schon durch Schopenhauer proklamierten Aussage, dass Urinstinkt, Trieb und Affekt, aber nicht die Vernunft das Leben bedingen, wird die Problematik von Selbstverständnis und Umwelt im Bajazzo auf die soziale Ebene abstrahiert, wo das Individuum sich nicht unbegrenzt selbstentfalten kann, sondern Individualität in strenger Verbundenheit mit normierten Werten des Menschseins steht. Weder in der Unterdrückung der Naturtriebe noch in der Loslösung von Konvention und Tradition ist Individualexistenz möglich. Thomas Mann wählt in seinen Novellen keinen lösungsorientierten, sondern einen problemorientieren Zugang zum anthropologischen Diskurs der Lebensphilosophie: Was geschieht, wenn das Selbstverständnis nicht mit der Umwelt auszuhandeln ist? Diese Skepsis, mit der Thomas Mann die Lebensphilosophie Nietzsches mittels seiner Figurenkonzeption betrachtet, äußert sich darin, dass er seine Figuren auf dem literarischen Experimentierfeld scheitern lässt. Der anthropologische Wert der Novellen resultiert aus der literarischen Betrachtung des Entfaltungsprozesses der Selbsterkenntnis und -auslebung eines Individuums, den Thomas Mann als den Fixpunkt eines gelungenen oder gescheiterten Lebens bestimmt.
Ebenso geht aus den Novellen hervor, dass sich Individuen den Einflüssen der Menschennatur oder ihrer Umwelt niemals gänzlich entziehen können und somit gezwungenermaßen immer in einem Aushandlungsprozess und einer Erprobung der eigenen Stellung in der Welt konfrontiert sind.
Primärliteratur
- Freud, Sigmund. 2017. Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. 1917. In: Imago 5 (1917 / 19), Online-Ausg. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg. S. 1–7. DOI.10.11588/diglit.25679.1. (14.10.2023).
- Mann, Thomas. 2002. Der kleine Herr Friedemann. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 2.1. Frühe Erzählungen 1893–1912. S. 87–119, hg. und textkritisch durchgesehen von Terrence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: S. Fischer.
- Mann, Thomas. 2002. Der Bajazzo. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 2.1. Frühe Erzählungen 1893–1912. S. 120–159, hg. und textkritisch durchgesehen von Terrence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: S. Fischer.
- Mann, Thomas. 2002. Form. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 15.1. Essays II. 1914–1926. S. 730, hg. und textkritisch durchgesehen von Terrence J. Reed unter Mitarbeit von Malte Herwig. 2. Auflage. Frankfurt a. M.: S. Fischer.
- Nietzsche, Friedrich. 1980. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hg. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München / New York: dtv / De Gruyter.
- Simmel, Georg. 1990. Schopenhauer und Nietzsche. Tendenzen im deutschen Leben und Denken seit 1870. Hamburg: Junius.
Sekundärliteratur
- Banuls, André. 2001. Leben und Persönlichkeit. In Koopmann, Helmut (Hg.): Thomas-Mann-Handbuch. 3., aktualisierte Aufl., S. 1–17. Stuttgart: Kröner.
- Gerok-Reiter, Annette. 2006. Individualität. Studien zu einem umstrittenen Phänomen mittelhochdeutscher Epik. Basel / Tübingen: Francke.
- Riedel, Wolfgang. 2014. Nach der Achsendrehung. Literarische Anthropologie im 20. Jahrhundert. Würzburg: Könighausen & Neumann.
- Urbich, Jan. 2011. Literarische Ästhetik. Köln: Böhlau. DOI.10.36198/9783838535432. (13.10.2023).
- Willems, Gottfried. 2015. Geschichte der deutschen Literatur. Band 5: Moderne. Wien / Köln / Weimar: Böhlau.
- Klemm, Anna Luise. 2024. Dualistische Identität: Figurenkonzeptionen in den frühen Novellen Thomas Manns. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Translatologische Biografie und übersetzerisches Werk von Lisa Palmes
Translatologische Biografie und übersetzerisches Werk von Lisa Palmes (geb. 1975)[^* Der vorliegende Beitrag bietet einen Einblick in die 2023 abgegebene und verteidigte Masterarbeit.]
Einleitung
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Übersetzung, genauer gesagt mit der Person der herausragenden Übersetzerin Lisa Palmes, ihrem Beruf und allen damit einhergehenden Aspekten. Lisa Palmes übersetzt polnische Literatur ins Deutsche. Von 2001 bis 2007 studierte sie Polonistik und Germanistik mit Schwerpunkt Linguistik an der Humboldt-Universität Berlin und der Universität Warschau (vgl. Unrast Berlin 2022). Im Jahr 2017 wurde Lisa Palmes mit dem Karl-Dedecius-Preis ausgezeichnet. Der vorliegende Beitrag präsentiert nur einen Teil ihrer Biografie; die Abschnitte des zugrundeliegenden Vortrags wurden gekürzt und modifiziert.
Das Modell von Renata Makarska
In meiner Arbeit, die ich im Sommer 2023 an der Jagiellonen-Universität abgeschlossen habe, habe ich vor allem das biografische Modell von Renata Makarska angewendet, um eine Biografie von Lisa Palmes zu erstellen (vgl. Makarska 2016). Bei der Suche nach biografischen Informationen habe ich hauptsächlich Online-Quellen verwendet, darunter natürlich die Website von Lisa Palmes (vgl. Palmes 2022). Das vorgeschlagene Modell von Makarska besteht aus den folgenden vier Segmenten: Sprachbiografie, Netzwerke, Übersetzungskritik und Kontext.
In Makarskas sprachbiografischem Modell sind die Aspekte der Muttersprache und der Arbeitssprache des:der Übersetzer:in am wichtigsten. Es können durchaus mehr als eine Muttersprache relevant sein, denn Übersetzer:innen können auch mehrsprachige Bewohner:innen von polykulturellen Räumen sein. Makarska verwendet das „Vier-Sprachen-Modell“ von Henri Gobard, um eine sprachliche Lebensgeschichte zu beschreiben. Dieses Modell unterscheidet zwischen vier Arten von Sprache: vernakular, vehikular, referential und mythisch. Die erste bezieht sich auf das Umfeld, in der das Individuum seine ersten Kindheitsjahre verbrachte. Es ist die Sprache, die man als Kind benutzt, gehört und gelernt hat. Die zweite bezieht sich auf die Bewegung des:der Übersetzer:in, z. B. zu Ausbildungszwecken. Die referentiale Sprache ist mit dem kulturellen Hintergrund des:der Übersetzer:in verbunden. Die vierte, mythische Sprache leitet sich von Glauben und Religion ab. Innerhalb der Kriterien, die sich auf die Sprachbiografie beziehen, berücksichtigt Makarska auch das Konzept der Topobiografie, bzw. der Geobiografie (vgl. Makarska 2016: 217). Sie beschreibt weiterhin eine Bewegung des:der Übersetzer:in in anderen Ländern, die Überschreitung territorialer Grenzen und den inneren Persönlichkeitswandel (vgl. Makarska 2016: 217).
Das Netzwerke-Kriterium beschreibt Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Beruf des:der Übersetzer:in stehen. Der:die moderne Übersetzer:in ist in seinem:ihrem Beruf nicht allein, sondern arbeitet mit vielen Institutionen und Personen zusammen. Dieses Kriterium bezieht sich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Verlagen, Literaturjournalist:innen, Zeitschriften und natürlich mit Buchautor:innen. Darüber hinaus hat der:die Übersetzer:in auch Erfahrungen mit der kulturellen Welt und mit Wissenschaftler:innen. Die heutigen Übersetzer:innen gehen darüber hinaus auch häufig „bürgerlichen“ Berufen nach, d. h. sie können selbst als Verleger:innen, Hochschullehrer:innen oder Schriftsteller:innen tätig sein (vgl. Makarska 2016: 218). Dieses Kriterium umfasst nicht nur berufliche Kontakte, sondern auch Bekanntschaften und Freundeskreise (vgl. Makarska 2016: 220). Diese oben beschriebenen Netze erleichtern und ermöglichen die Arbeit des:der Übersetzer:in. Das Übersetzungskritik-Segment ist bei der Erstellung von Lebensgeschichten sehr wichtig. Es erläutert auch den Rezeptionsbereich der Übersetzung und beschreibt den Einfluss des übersetzten Werks auf eigenständige Literaturproduktion, d. h. eine innovative Rolle in einem neuen Polysystem (vgl. Makarska 2016: 218). Das letzte Kriterium ist der Kontext und bezieht sich auf das eigene literarische Werk des:der Übersetzer:in und auf seinen:ihren „bürgerlichen“ Beruf (vgl. Eberharter 2020: 107). Es geht insbesondere um andere berufliche Tätigkeiten des:der Übersetzer:in, die auch seine:ihre Übersetzungstätigkeit beeinflussen. Als Beispiele für diese „bürgerlichen“ Berufsgruppen führt Renata Makarska an: Journalist:innen, Autor:innen, Lehrer:innen, Verleger:innen und Wissenschaftler:innen (vgl. Makarska 2016: 218).
Sprach- und Topobiografie der Übersetzerin
Lisa Palmes wurde 1975 geboren. Sie ist in einer deutschen Familie aufgewachsen, ihre vernakulare Sprache ist also Deutsch. In den Jahren 1995 bis 1996 studierte Lisa Palmes Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft in Wien (vgl. Nakanapie 2022). Sie stellte jedoch fest, dass eine akademische Laufbahn nicht ihr Weg war, weil sie die Universität als zu realitätsfern wahrgenommen hat. Die Mitstudent:innen waren älter, über 30, und Lisa Palmes hatte Angst, dass sie nach 10 oder 15 Jahren immer noch am selben Ort sein würde. Sie beschloss, etwas Praktischeres zu machen und entschied sich für eine Ausbildung zur Friseurin. Die Ausbildung im Friseurhandwerk sowie die darauffolgende berufliche Tätigkeit erstreckten sich von 1996 bis 2001 (vgl. Frei 2020). Auf diese Weise lernte sie ihre Arbeitskollegin kennen, eine Polin aus Kattowitz. Dank ihr reiste Lisa Palmes nach Polen, nach Kattowitz (vgl. Benning 2021). Dieses Ereignis hat sich auf ihren weiteren Lebensweg ausgewirkt. So begann ihre Leidenschaft für die polnische Sprache, Polnisch ist für Lisa Palmes zu einer Art Faszination geworden. Im Alter von 25 Jahren begann sie, Polnisch zu lernen (vgl. Benning 2021). Von 2001 bis 2007 studierte sie Polonistik und Germanistik mit Schwerpunkt Linguistik an der Humboldt-Universität Berlin und der Universität Warschau (vgl. Unrast Berlin 2022). Polnisch ist für Lisa Palmes sowohl eine Berufssprache als auch eine Leidenschaft. Polnisch erfüllt somit die Kriterien einer vehikularen und referentalen Sprache.
Netzwerke
Im Rahmen der Netzwerke von Lisa Palmes ist die Buchhandlung „Buchbund“ zu erwähnen. Dies ist die einzige polnisch-deutsche Buchhandlung in Berlin. Die Buchhandlung ist auch ein Treffpunkt für diejenigen, die aus Polen kommen oder sich für Polen und die polnische Sprache interessieren. Sie gilt als „der intellektuelle Treffpunkt des polnischen Berlins“ (Buchbund 2022a). Der Inhaber der Buchhandlung ist Marcin Piekoszewski, der zusammen mit Lisa Palmes zahlreiche Veranstaltungen zur polnischen Literatur organisiert. Nachfolgend werden einige der wichtigsten Veranstaltungen, die Lisa Palmes mit dem deutsch-polnischen Buchladen „Buchbund“ in Berlin mitorganisiert hat, genannt und beschrieben.
Im Jahr 2013 fand unter dem Titel „Reportagen ohne Grenzen“ eine Reihe von Treffen mit bekannten polnischen Reportern:innen statt. In zehn Gesprächen, die von Februar bis Dezember stattfanden, stellten Autor:innen ihre Werke vor und lasen ins Deutsche übersetzte Auszüge daraus vor (Buchbund 2022b). Die verschiedenen Reportagen beschrieben aktuelle gesellschaftspolitische Ereignisse aus Polen und der ganzen Welt, worauf der Name der Veranstaltung „Reportagen ohne Grenzen“ anspielt. Eine weitere Veranstaltungsreihe fand im Jahr 2014 von April bis November statt. Dies war eine Serie von Treffen und Gesprächen mit sechs polnischen Biograf:innen (vgl. Buchbund 2022c). Thematisiert wurden die Personen in den Biografien, die Autor:innen sowie die Gattung selbst. Aus den oben genannten Initiativen und anderen Veranstaltungen – natürlich fanden noch weitere Treffen und Veranstaltungen dieser Art statt – und der Zusammenarbeit von Lisa Palmes mit der Buchhandlung „Buchbund“ lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen. Durch ihre Zusammenarbeit mit einer polnisch-deutschen Buchhandlung hat Lisa Palmes ein großes Netzwerk an Bekanntschaften mit Autor:innen und anderen Übersetzer:innen aufgebaut. Nicht zu vergessen ist das riesige Netz von Kontakten zu Verleger:innen. Bei solchen kulturellen Veranstaltungen hatte Lisa Palmes natürlich auch die Gelegenheit, Leser:innen zu treffen. Als Mitorganisatorin und Initiatorin der oben genannten Projekte hat Lisa Palmes einen Beitrag zur Förderung der polnischen Literatur und Geschichte in Berlin und Deutschland geleistet. Dank ihrer Aktivitäten zur Verbreitung der polnischen Kultur und Literatur wird Lisa Palmes auch als „Kulturvermittlerin und Organisatorin von Gesprächsreihen mitpolnischen SchriftstellerInnen“ bezeichnet (Unrast Berlin 2022). Neben der Zusammenarbeit mit der Buchhandlung „Buchbund“ hat Lisa Palmes auch mit anderen Institutionen und Organisationen wie z. B. dem „Buchinstitut“ (poln. Instytut Książki) in Krakau zusammengearbeitet (vgl. Instytut Książki 2022). Lisa Palmes nimmt auch an übersetzungsbezogenen Konferenzen teil. Exemplarisch sei hier eine virtuelle Übersetzungskonferenz erwähnt, die der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk und deren Übersetzer:innen gewidmet war. Die Konferenz fand am 25.09.2020 in New York statt und wurde von PEN America veranstaltet (vgl. PEN America 2022). Zehn Übersetzer:innen von Büchern der polnischen Nobelpreisträgerin aus neun Ländern nahmen daran teil (vgl. Dobrowolski 2020). Abschließend ist anzumerken, dass sich Lisa Palmes durch die Teilnahme an der Konferenz ein breites Netzwerk von Kontakten zu Übersetzer:innen nicht nur für die deutsche Sprache aufgebaut hat. Ein weiteres Ereignis von besonderer Bedeutung ist der Weltkongress der Übersetzer:innen polnischer Literatur (poln. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej) (vgl. Kongres Tłumaczy 2022a). Diese Veranstaltung wird alle vier Jahre in Krakau organisiert. Es werden Übersetzer:innen aus verschiedenen Ländern eingeladen. Das Ziel des Kongresses ist die Stärkung und Integration der Gemeinschaften von Übersetzer:innen der polnischen Literatur. Die fünfte Veranstaltung fand vom 2.–4.06.2022 in Krakau statt. Die Übersetzerin Lisa Palmes war eingeladen, nahm an der Paneldiskussion teil und erörterte die effektive Veröffentlichung und Förderung von Büchern. Der Titel des Panels lautete: „Warsztat tłumacza: Jak skutecznie szukać wydawcy i jak dobrze promować książkę już wydaną?” (dt. „Workshop für Übersetzer: Wie sucht man effektiv nach einem Verlag und wie kann man ein bereits veröffentlichtes Buch gut vermarkten?”) (vgl. Kongres Tłumaczy 2022b). Lisa Palmes betonte in der Diskussion, dass es bei der Förderung der Bücher auf dem Markt sehr wichtig ist, Leser:innen und Verleger:innen mit dem:der Autor:in bekannt zu machen.
Die kulturellen Veranstaltungen, an denen Lisa Palmes teilnimmt, zeugen von ihrem großen Engagement für das kulturelle Leben. Auch die Tatsache, dass sie häufig als Rednerin eingeladen wird, zeugt von ihrer Beliebtheit. Es ist auch Ausweis eines riesigen Netzwerks von Freundschaften mit Persönlichkeiten aus der Übersetzungsbranche.
Ein weiterer Aspekt ist die Erfahrung von Lisa Palmes in der Tandem-Übersetzung: Die Übersetzerin arbeitete mit Lothar Quinkenstein zusammen. Zwei Bücher wurden auf diese Weise von ihnen übersetzt: Ludwik Hirszfeld: Geschichte eines Lebens (poln. Historia jednego życia) und ein Buch der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk Die Jakobsbücher (poln. Księgi Jakubowe) (vgl. Prüfer 2019).
Das übersetzerische Werk von Lisa Palmes
Bei der Erstellung einer Biografie ist es unerlässlich, die Übersetzungsleistung zu untersuchen. Angefangen bei Buchautor:innen übersetzt Lisa Palmes ganz unterschiedliche Personen – neben der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk auch Journalist:innen, Wissenschaftler:innen, Schriftsteller:innen, Forscher:innen und sogar Mediziner:innen. Lisa Palmes hat auch Stammautor:innen wie Olga Tokarczuk, Joanna Bator, Wojciech Jagielski, Filip Springer, Mariusz Czubaj (vgl. Palmes 2022). Heterogen ist nicht nur der Kreis der Autor:innen, die Lisa Palmes übersetzt, sondern auch die Themenwahl der übersetzten Werke. Lisa Palmes konzentriert sich nicht nur auf einen Bereich, im Gegenteil, die übersetzten Bücher thematisieren den Holocaust, Krieg, Literatur, Fußball, Medizin und sogar Architektur. Dies ist ein Beweis für ein umfassendes Wissen und einen weiten Horizont der Übersetzerin. Viele Bücher erfordern auch Fachwortschatz und eine spezielle Sprache, die Lisa Palmes beherrscht. Ein weiterer Aspekt ist die Besonderheit der Gattungen. Lisa Palmes beschäftigt sich überwiegend mit Belletristik. Zur schönen Literatur gehören etwa die Romane der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk oder die Romane von Joanna Bator und Kaja Malanowska. Es ist allerdings erwähnenswert, dass das übersetzerische Werk Lisa Palmes neben der Belletristik auch eine Vielzahl anderer Texte umfasst. Dazu gehören wissenschaftliche Sachtexte wie Reportagen, Biografien, Autobiografien, Essays oder Sammlungen von Artikeln.
Abschließend sind die Auszeichnungen und Preise zu erwähnen. Die Auszeichnungen sind ein fester Bestandteil des Porträts von Übersetzer:innen, da sie mit ihrer Arbeit verbunden sind. Preise und Nominierungen sind ein Beweis für die Wertschätzung von Übersetzer:innen und ihre Sichtbarkeit in der literarischen Welt. Lisa Palmes hat viele Preise erhalten, aber in diesem Beitrag wird nur einer von ihnen beschrieben – der Karl-Dedecius-Preis. Der Karl-Dedecius-Preis ist eine renommierte Auszeichnung für Literaturübersetzer:innen. Er wird seit 2003 alle zwei Jahre von dem Deutschen Polen-Institut und der Robert Bosch Stiftung an zwei Übersetzer:innen verliehen – je an eine:n deutsche:n Übersetzer:in polnischer Literatur und eine:n polnische:n Übersetzer:in deutschsprachiger Literatur. Sie werden für ihre hervorragenden Leistungen und ihr Engagement für die Vermittlung zwischen den Nachbarländern geehrt (vgl. Karl-Dedecius-Preis 2023). Im Jahr 2017 wurde Lisa Palmes gemeinsam mit Eliza Borg mit dem Karl-Dedecius-Preis ausgezeichnet (vgl. Europa-Universität 2022).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lisa Palmes eine zeitgemäße Übersetzerin ist. Lisa Palmes geht mit dem Zeitgeist, was sich nicht zuletzt darin zeigt, dass sie eine eigene Website hat, die ständig aktualisiert wird. Ihre Aktivitäten zeugen davon, dass der:die moderne Übersetzer:in eine Person ist, die über ein riesiges Netzwerk von Kontakten und Kooperationen verfügt und ein:e Verkäufer:in ist, der:die Verlage von der Veröffentlichung überzeugen will. Lisa Palmes nimmt aktiv an Konferenzen und kulturellen Veranstaltungen teil. Bewunderung verdient auch ihre Zusammenarbeit mit der Buchhandlung „BuchBund“. Es handelt sich um eine Tätigkeit, die zur Popularisierung der polnischen Literatur in Deutschland und zur Förderung polnischer Autor:innen auf dem deutschen Markt beiträgt und auch für die deutschen Leser:innen wichtig ist, die auf diesem Weg neue Genres, Bücher, Autor:innen und Kultur aus Polen kennenlernen können. Lisa Palmes ist auch offen für die Zusammenarbeit mit anderen Übersetzer:innen, was ihre erfolgreichen Tandem-Übersetzungen bestätigen.
Ganz zum Schluss sei noch erwähnt, dass die Arbeit an Porträts von Übersetzer:innen deren Sichtbarkeit und Anerkennung fördert.
- Benning, Günter. 2021. Übersetzen ist wie Haareschneiden. https://www.muensterschezeitung.de/lokales/staedte/greven/ubersetzen-ist-wie-haareschneiden-1091750?npg= (15.11.2022).
- [Buchbund]. 2022a. Über uns. https://buchbund.de/uber-uns/ (20.11.2022).
- [Buchbund]. 2022b. Reportagen ohne Grenzen. https://buchbund.de/reportagen-ohne-grenzen/ (20.11.2022).
- [Buchbund]. 2022c. Biografien. https://buchbund.de/biografien/ (20.11.2022).
- Eberharter, Markus. 2020. Biografia translatorska Alberta Zippera. In Kita-Huber, Jadwiga / Makarska, Renata (Hg.),Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych, 93–109. Kraków: Universitas.
- [Europa-Universität]. 2022. Karl-Dedecius-Preis. https://www.ub.europa-uni.de/de/benutzung/bestand/kd_stiftung/karl_dedecius_preis/index.html#:~:text=Lisa%20Palmes%20debütierte%20in%202010,und%20ihrer%20„Jakobsbücher“%20beteiligen (16.04.2023).
- Dobrowolski, Andrzej. 2020. Tłumacze z dziewięciu krajów o przekładach książek Olgi Tokarczuk na konferencji PEN America. https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,tlumacze-z-dziewieciu-krajow-o-przekladach-ksiazek-olgi-tokarczuk-na-konferencji-pen-america,5594.html (25.11.2022).
- Frei, Gallus. 2020. Olga Tokarczuk „Der liebevolle Erzähler“, Kampa. https://literaturblatt.ch/tag/lisa-palmes/ (15.11.2022).
- [Instytut Książki]. 2022a. https://www.instytutksiazki.pl/ (20.11.2022).
- [Karl-Dedecius-Preis]. 2023. Karl-Dedecius-Preis: Ein Preis für polnische Übersetzer deutschsprachiger Literatur und deutsche Übersetzer polnischer Literatur. https://www.karl-dedecius-preis.de/der-preis/ (15.04.2023).
- Kelletat, Andreas F. / Tashinskiy, Aleksey / Boguna, Julija (Hg.). 2016. Übersetzerforschung: Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Übersetzens. Berlin: Frank & Timme.
- [Kongres Tłumaczy]. 2022a. O kongresie. https://www.kongrestlumaczy.com/o-kongresie (01.12.2022).
- [Kongres Tłumaczy]. 2022b. Program. https://www.kongrestlumaczy.com/program (01.12.2022).
- Makarska, Renata. 2016. Translationsbiographische Forschung: Am Beispiel von Siegfried Lipiner und Grete Reiner. In Kelletat, Andreas F. / Tashinskiy, Aleksey / Boguna, Julija (Hg.). 2016. Übersetzerforschung: Neue Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Übersetzens, 215–232. Berlin: Frank & Timme.
- [Nakanapie]. 2022. Lisa Palmes. https://nakanapie.pl/autorzy/lisa-palmes (15.11.2022).
- Palmes, Lisa. 2022. http://lisapalmes.de/ (17.11.2022),
- [PEN America]. 2022. https://pen.org/ (22.11.2022).
- Prüfer, Natalia. 2019. Tokarczuk im Tandem: Natalia Prüfer im Gespräch mit den Übersetzern Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. https://forumdialog.eu/2019/12/17/tokarczuk-im-tandem-natalia-pruefer-im-gespraech-mit-lisa-palmes-und-lothar-quinkenstein/ (02.02.2023).
- [Unrast Berlin]. 2022. Gäste: Lisa Palmes. https://unrast-berlin.de/de/gaeste/lisa-palmes-de/ (05.05.2022).
- Pruciak-Suska, Olga. 2024. Translatologische Biografie und übersetzerisches Werk von Lisa Palmes (geb. 1975). In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Stille Perturbationen
Stille Perturbationen (Kon)Figurationen der Instabilitäten im Schaffen Judith Hermanns[^* Der vorliegende Beitrag bietet Einblick in die 2023 fertiggestellte und sich im Druck befindende Dissertation ‚Stille Perturbationen. (Kon)Figurationen der Instabilitäten im Schaffen Judith Hermanns‘.]
Die von mir verfasste Dissertation trägt den Titel ‚Stille Perturbationen. (Kon)Figurationen der Instabilitäten im Schaffen Judith Hermanns‘. Die vorliegende Arbeit versucht, die Welt in den Texten der 1970 geborenen deutschen Schriftstellerin Judith Hermann anhand von vier Bänden ihrer Kurzprosa zu analysieren: ‚Sommerhaus, später‘ (1998), ‚Nichts als Gespenster‘ (2003), ‚Alice‘ (2009) und ‚Lettipark‘ (2016). Meine Forschungsperspektive wurde durch Niklas Luhmanns „Theorie sozialer Systeme” bestimmt. Mit dem Ziel, meine Analysen methodologisch zu stabilisieren, habe ich mich an den Literaturwissenschaftlern Carsten Gansel, Norman Ächtler, Linda Simonis, Paweł Zimniak und Wolfgang Brylla orientiert. Wie diese habe ich mich auf die Luhmann’schen Konzeptionen des Systems und seine Dynamik konzentriert, unter besonderer Berücksichtigung der Kategorie Störung. Ich habe versucht zu zeigen, wie dieses von dem deutschen Soziologen vorgeschlagene Konzept bei der Beschreibung der dargestellten Welt in den Texten der Berliner Autorin genutzt werden kann, wobei ich ein besonderes Augenmerk auf die instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen und die innere Welt der in ihren Werken dargestellten weltverlorenen Protagonisten richte.
Hermanns Protagonisten sind Vertreter der Generation der Autorin. Sie leben in der heutigen Welt, die von ständigem Wandel und damit von Instabilität geprägt ist. Ihre Lebenssituation ist eine ‚Zwischensituation‘, ein Zustand des Übergangs, der einer ständigen Dynamik unterliegt, die sich auf die Beziehungssysteme auswirkt. Diese sind oft unsicher, labil, manchmal unberechenbar und unzuverlässig, denn die in Hermanns Werken dargestellten Personen haben keine festen Prinzipien, leben in der Schwebe und sind unentschlossen, was sie anfällig für Manipulationen macht. Als der Bereich der tiefgreifendsten Störung erweist sich die – für gesunde Beziehungen unentbehrliche – zwischenmenschliche Kommunikation. Mit der Fokussierung der Arbeit auf Konfigurationen, d. h. auf literarischen Strategien zur Darstellung menschlicher Instabilität, konzentriere ich mich auf Hermanns Wiedergabe der instabilen Existenzen ihrer Generation, die darüber hinaus durch verschiedene Perturbationen destabilisiert werden, d. h. unvorhergesehene Situationen, wie zum Beispiel unerwartete Begegnungen, Besuche oder Reisen, aber auch Krankheiten oder den Tod der nahestehenden Menschen.
In der Einleitung meiner Dissertation habe ich auf die Veränderungen der zeitgenössischen Mentalität hingewiesen, die für die Biografie der Autorin und die Schicksale ihrer Figuren von Bedeutung sind. Sie spiegeln die Veränderungen wider, die durch die Entwicklung der Technologie, die zunehmende Mobilität und die Umgestaltung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse hervorgerufen werden. Sie bringen die Negierung etablierter kultureller Bezugspunkte oder Denkweisen und die Umgestaltung traditioneller Formen der Selbstdarstellung mit sich, was häufig zu Konflikten führt.
Bei der Darstellung des Profils der Autorin im folgenden Kapitel habe ich nicht nur ihre Kurzprosa, sondern auch ihre Romane und die in dem Band ‚Wir hätten uns alles gesagt‘ (2023) vereinten poetologischen Äußerungen sowie die ihr zuerkannten Auszeichnungen mitberücksichtigt. Da die Texte Hermanns als einer Vertreterin der sogenannten Golf-Generation einem literarischen Phänomen zugerechnet werden, das mit dem umstrittenen Begriff „Fräuleinwunder / literarisches Fräuleinwunder“[^1 1999 verwendete der SPIEGEL Redakteur Volker Hage in seinem Artikel ‚Ganz schön abgedreht‘ den Begriff „literarisches Fräuleinwunder”, um den überraschenden Erfolg einer Reihe junger Autorinnen auf dem Literaturmarkt zu etikettieren. Judith Hermann wird neben Sibylle Berg, Tanja Dückers, Karen Duve, Jenny Erpenbeck, Julia Franck, Alexa Henning von Lange, Zoë Jenny und Juli Zeh als die „Ikone” dieser schriftstellernden Generation proklamiert. Der Terminus gilt als umstritten nicht nur wegen der Verniedlichungsform in der Anrede, sondern auch deswegen, dass es sich keine ästhetische Kategorie finden lässt, die die unterschiedlichen Stile und Intentionen der Autorinnen vereinen könnte. In meiner Dissertation ‚Stille Perturbationen. (Kon)Figurationen der Instabilitäten im Schaffen Judith Hermanns‘ widme ich dem Begriff „Fräuleinwunder“ ein ganzes separates Kapitel.] bezeichnet wird, habe ich das nächste Kapitel der Dissertation dieser Strömung gewidmet. Dabei habe ich den Versuch unternommen, sie vor dem Hintergrund der Entwicklung anderer literarischer Strömungen der letzten Jahrhundertwende darzustellen, wie der ‚Popliteratur‘, der ‚Berliner Literatur‘, der ‚Durchbruchsliteratur‘ oder aber der sogenannten Wendeliteratur. Ich habe auch auf Arbeiten verwiesen, die Judith Hermann der „Single-Generation“, der „Generation X“ oder der „68er-Generation“ zurechnen. Neben Judith Hermann sind hier Autorinnen wie Jenny Erpenbeck (geb. 1967), Felicitas Hoppe (geb. 1960), Zoë Jenny (geb. 1974), Juli Zeh (geb. 1974) oder Julia Franck (geb. 1970) zu nennen, die die thematische und ästhetische Vielfalt des Phänomens „Fräuleinwunder“ demonstrieren. Die berücksichtigten Autorinnen, deren Verlage das umstrittene „Etikett“ mitunter geschickt vermarkten, vereinen die Kriterien von Geschlecht und Alter. Gemeinsam scheint ihren Werken auch der Wunsch zu sein, die von Veränderlichkeit und Vergänglichkeit geprägt Dynamik menschlicher Beziehungen festzuhalten.
Da die repräsentativen Kurzprosatexte von Judith Hermann in der Sekundärliteratur sowohl als Erzählungen als auch als Kurzgeschichten / Short Stories eingeordnet werden, habe ich beide Gattungen im nächsten Kapitel, das sich mit genologischen Fragen beschäftigt, definiert. Die überwiegende Mehrheit der in meiner Dissertation analysierten Texte hat Kurzgeschichtencharakter, obwohl die Autorin selbst drei Bände ‚Sommerhaus, später‘, ‚Nichts als Gespenster‘ und ‚Lettipark‘ mit dem Gattungsattribut ‚Erzählungen‘ bezeichnet. (Die im vierten Band ‚Alice‘ veröffentlichten Texte, der diese Bezeichnung nicht trägt, unterscheiden sich jedoch strukturell nicht von den Texten in den drei genannten Bänden, abgesehen davon, dass in allen fünf Geschichten die Erzählerin dieselbe Person ist – Alice). Da die Autorin selbst die Grenzen zwischen den genannten Kurzprosagattungen verwischt und einige Wissenschaftler (u. a. Julia Catherine Sander, Christina Ujma, Florence Feiereisen, Ines Koreck, Annette Mingels) beide Begriffe verwenden, habe ich mich für eine analoge Strategie entschieden, unter Rückgriff auf die Definition aus dem ‚Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft‘, das „Erzählung“ als neutralen Sammelbegriff eines „narrativen literarischen Textes kürzeren bis mittleren Umfangs“ (Braungart u. a. 2000: 519) definiert und damit, wie wir lesen, sowohl die klassische Kurzgeschichte, die Novelle als auch die Short Story umfasst.
Im folgenden Kapitel habe ich den Versuch unternommen, Judith Hermanns Texte vor dem Hintergrund von Strömungen in der Gegenwartsliteratur einzuordnen und den aktuellen Stand der Forschung zu ihren Kurzgeschichten aufzuzeigen. Judith Hermanns Texte, insbesondere die ersten beiden Erzählbände: ‚Sommerhaus, später‘ und ‚Nichts als Gespenster‘, sind des Öfteren Gegenstand der Literaturwissenschaft gewesen. Sie beschreiben Protagonist:innen in ihrer Müdigkeit, Leere, distanzierten Haltung zu ihrer Umgebung, der Ungewissheit der eigenen Identität, Entscheidungsunfähigkeit sowie Passivität. Dabei wird darauf hingewiesen, dass diese Eigenschaften aus einer fehlenden Beziehung zu sich selbst und zur Welt resultieren und manchmal auch das Ergebnis misslungener emotionaler und erotischer Beziehungen sind, die durch die vagen Sehnsüchte der Figuren, ihre ständige Suche nach etwas Unbestimmtem und ihre (meist vergeblichen) Hoffnungen auf eine gelungene Beziehung verursacht werden (und manchmal auch daraus resultieren).
Im darauffolgenden Kapitel habe ich die Forschungsmethodik vorgestellt. Um die Leser:innen in die Systemtheorie des deutschen Soziologen Niklas Luhmann einzuführen, habe ich versucht, verschiedene von ihm verwendete Schlüsselbegriffe wie: System, Autopoiesis, Kontingenz oder Emergenz zu erklären. Um die Literatur zu diesem Thema anhand von Luhmanns Begriffsapparat zu untersuchen, habe ich mich auf den Begriff der „Kommunikation“ konzentriert, der auch in Hermanns Texten thematisiert wird sowie auf das Phänomen, das der Soziologe als integralen Bestandteil von Systemen betrachtet, nämlich die das System destabilisierende Störung. Der Begriff „Störung“ wird in der Forschung mit Irritation und Perturbation gleichgesetzt. Nach Luhmann ist jedes Ereignis, das nicht dem erwarteten Verhalten des Systems entspricht, für dessen Entwicklung notwendig. In diesem Sinne kann eine Störung positive Folgen haben, denn sie kann zu Veränderungen im System führen, die es ihm ermöglichen, sein Potenzial besser auszuschöpfen oder sich besser an seine Umwelt anzupassen.
Unter Verweis darauf, dass sowohl Luhmann als auch seine Anhänger den Begriff der „Störung‘ / ‘Irritation / ‘Perturbation“ als Möglichkeit der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung in Form literarischer Texte vorschlagen (Gansel / Ächtler 2013: 10), habe ich versucht, die gewonnenen Erkenntnisse zur Beschreibung der Darstellungswelt von Hermanns Texten zu nutzen, wobei ich mich besonders auf die (oft innerlich zerrissenen) Figuren und ihre instabilen Beziehungen konzentrierte.
Besonderes Augenmerk habe ich der Frage geschenkt, wie die in Hermanns Texten dargestellten (Kon)Figurationen von Perturbationen betroffen sind, d. h. von zusätzlichen Faktoren wie Krankheit oder Verlust, die bereits instabile Beziehungen noch mehr stören. Auf diese Weise habe ich die Bedeutung von Störungen für die von Hermann konstruierten individuellen (Figur) und kollektiven (Gruppe) Systeme untersucht. Wichtig war auch die Beantwortung der Frage, mit welchen literarischen Strategien Judith Hermann ihren Leser:innen systemische Störungen und deren Auswirkungen präsentiert. Dazu gehören der Verzicht auf Psychologisierung, die Verwendung sogenannter Leerstellen sowie die Konzentration auf sinnliche Details und Minimalismus.
In Anlehnung an Luhmann habe ich im dritten Kapitel die Erzählungen von Judith Hermann auf folgende Aspekte untersucht: figuraler Gefühlshaushalt [gestörte / verhinderte Kommunikation, (fehlende) Identifikation, Distanzierung, Irritation]; existenzielle Instabilitäten [Schwebezustände, existenzielle Unterbrechungen am Beispiel von Krankheiten; Kontrollverluste und Kompensationen] und Strukturmerkmale der Vermittlungsebene [Erzähltechnik, minimalistisches Figurenensemble und Figurenkonstellationen ausgewählter Erzählungen; Rolle von Leerstellen].
Im Kapitel „Figuraler Gefühlshaushalt in ausgewählten Erzählungen Judith Hermanns“ habe ich die Kategorien von Kommunikation, Identifikation, Distanzierung und Irritation zur Grundlage meiner Analyse gemacht.
Im Hinblick auf (fehlende) Identifikation habe ich zwei Aspekte untersucht: den Körper, mit besonderem Augenmerk auf der Sexualität und mit den Frauengenealogien und anderen familiären Bezügen. Die Kategorie der Distanzierung habe ich in Bezug auf die topografische Ebene, die Beziehungsebene und Auseinandersetzung mit dem Tod analysiert. Auf das Konzept der Irritation bin ich in einem separaten Unterkapitel eingegangen. Es ist anzumerken, dass diese Kategorien – ähnlich wie Systeme – miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Anhand derselben Geschichten Hermanns können verschiedene Aspekte erörtert werden, wie z. B. gestörte Kommunikation, fehlende Identifikation, Distanzierung, Kompensationen, existenzielle Instabilität oder Irritation.
In meinen Analysen habe ich mich auf Luhmanns Studie ‚Liebe als Passion:
zur Codierung von Intimität‘ (1982) gestützt, in der er eine Theorie der Kommunikation beschreibt, die auf seiner Theorie selbstreferentieller autopoietischer Systeme aufbaut und vieles von dem übernimmt, was er später in sein Hauptwerk ‚Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie‘ (1984) aufnahm.
Luhmann behandelt Liebe nicht als ein Gefühl, sondern als einen kommunikativen Code, durch den Gefühle ausgedrückt werden können. Die Liebe kann also als ein reproduzierbares Modell betrachtet und auch zum Gegenstand von Ablehnung oder Sehnsucht werden.
Die in dieser Arbeit analysierten literarischen Texte von Judith Hermann porträtieren Vertreter ihrer Generation, wobei die Autorin die Erfahrung des Lebens in einer Großstadt reflektiert, in der die Leser:innen Berlin leicht wiedererkennen.
Hermanns Figuren identifizieren sich kaum mit ihrem Beruf. Ihre vorherrschende Beschäftigung, vor allem in den ersten beiden Bänden, ist ihre Freizeitgestaltung. Ihre Leben sind auf oberflächliche Vergnügungen ausgerichtet. Die meisten Protagonist:innen des ersten Erzählbandes ‚Sommerhaus, später‘ kommen aus dem Berliner Künstlermilieu, wobei der Bereich ihrer Arbeit unbestimmt bleibt, obwohl die in einigen Texten enthaltenen Informationen ihre Identifizierung als Schauspieler oder Maler ermöglichen. Die Titelgeschichte von ‚Sommerhaus, später‘ verortet die junge „neue Bohème“ der 1990er Jahre topografisch eindeutig in den Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Ihr eigentümlicher Lebensstil ist antibürgerlich und antimaterialistisch. Hermanns Figuren leben in einer Großstadt, was einerseits zu ihrer Einsamkeit und Verwirrung beiträgt, während sie andererseits dank der demografischen Vielfalt der Großstadt familienähnliche Gruppen (Systeme) bilden können, die nicht durch Blutsverwandtschaft, sondern durch gemeinsame Interessen oder einen ähnlichen Lebensstil miteinander verbunden sind. Ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung dieser Gemeinschaften ist die Entwicklung einer neuen spezifischen Kultur der Intimität. Die Protagonist:innen wirken kühl und distanziert gegenüber der Außenwelt. Die Dynamik der von ihnen geschaffenen Systeme wird von gegensätzlichen Sehnsüchten bestimmt: auf der einen Seite von der Sehnsucht nach Freiheit, auf der anderen Seite von der Sehnsucht nach Liebe (Luhmann), verstanden als Leidenschaft (Luhmann) und Geborgenheit (vgl. Luhmann 1984:175).
Hermanns Kurzprosa konzentriert sich auf zentrale existenzielle Themen: Liebe, gescheiterte Beziehungen, die damit einhergehende Einsamkeit und – in dem Erzählband ‚Alice‘ – den Tod. Indem die Autorin diese Themen aufgreift, macht sie deutlich, wie das Leben an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert den Umgang der Figuren mit diesen grundlegenden Themen beeinflusst. In fast allen Texten von Judith Hermann bleiben Probleme im Bereich der Kommunikation ein zentrales Thema (vgl. die Kurzgeschichten ‚Rote Korallen‘, ‚Sonja‘, ‚Diesseits der Oder‘ aus dem Band ‚Sommerhaus, später‘, ‚Ruth (Freundinnen)‘, ‚Kaltblau‘, ‚Zuhälter‘ aus dem Erzählband ‚Nichts als Gespenster‘, ‚Zeugen‘, ‚Träume‘, ‚Rückkehr‘ aus ‚Lettipark‘).
Es scheint bemerkenswert, dass die Autorin das Format der Kurzprosa wählt, um die oben beschriebenen Probleme darzustellen. Das bedeutet, dass das Erfassen der Realität in der Regel auf eine einzige Figur, Situation oder ein einziges Ereignis konzentriert wird. Anders als der Roman bietet die Kurzprosa weder Raum für die Entwicklung von Figuren oder für die Verfolgung ihrer Schicksale. Die von der Autorin gewählte Form der Narration erlaubt weder eine detaillierte Beschreibung des Schauplatzes noch eine eingehende analytische Untersuchung der Situation. Die Konzentration auf das Hier und Jetzt passt zur Schnelllebigkeit der Gegenwart und erlaubt selektive Einblicke in einzelne Aspekte der heutigen Realität, wobei der Blick der Autorin auf die Alltagsszenen der beschriebenen Quasi-Familien gerichtet ist.
Hermann konzentriert sich in ihren Texten auf die komplexe Beziehungsdynamik zwischen den Vertreter:innen ihrer eigenen Generation, aber – wie ich in den Analysen zu zeigen versuche – konfrontiert sie diese in einigen Texten auch mit ihrer Herkunftsfamilie.
Dieser Bereich der literarischen Reflexion wird von der Autorin sowohl positiv als auch negativ bewertet. Manchmal erscheint die Familie, aus der die Figuren der Autorin stammen, als ein stabiles System, als ein Raum der Geborgenheit. In einigen ihrer Texte entwickelt die Familie der älteren Generation ein Beziehungsmodell für die Vertreter:innen der jüngeren Generation, das diese selbst nicht realisieren (z. B. in der Erzählung ‚Acqua alta‘ aus dem Band ‚Nichts als Gespenster‘). Auch wenn die Familie in Hermanns Texten als dysfunktionales, von inneren Konflikten belastetes System erscheint (z. B. ‚Rote Korallen‘ und ‚Ende von Etwas‘ aus dem Erzählband ‚Sommerhaus, später‘), wird ihr Identifikationspotenzial positiv bewertet. Einige Erzählungen Hermanns verweisen auf Familienbande als Kraftquelle oder zeigen die Familie als Einheit, die den Figuren ein Gefühl von Kontinuität und Zusammengehörigkeit gibt (die Erzählungen ‚Kohlen‘ und ‚Mutter‘ aus ‚Lettipark‘).
Eine der vorherrschenden Strategien Hermanns ist es, besonders wichtige Details oder Hintergründe von Ereignissen auszulassen und somit vor den Leser:innen zu verbergen. Die so erzeugte Spannung trägt wesentlich zur Stimmung ihrer Texte bei. Dinge und Beziehungen, Vorgänge und Bewegungen, Gefühle und Affekte werden in Form von ‚snap-shots‘ / ‚Momentaufnahmen‘ festgehalten. In solchen ‚Schnappschüssen‘ werden nicht nur bestimmte Bedingungen der räumlichen Umgebung inszeniert, sondern auch emotionale und affektive Zustände. Zum einen wird eine konkrete Raumerfüllung geschaffen, und ihre Idee ergibt sich aus der Gesamtheit der Dinge, die den Raum füllen. Zum anderen sind es die Beziehungen, die dem gegebenen Arrangement eine eigene situative Konkretheit verleihen, zu der auch Störungen und Irritationen gehören (vgl. die Staubflocken im Zimmer und die Perturbationen zwischen der Ich-Erzählerin und ihrem Liebhaber in ‚Rote Korallen‘).
Der Raum ist ein ebenso wichtiges Element der Texte wie die Figurenkonstellationen oder die Handlung. Die von Judith Hermann dargestellten Räume sind keine bloßen ‚Kulissen‘ für die Geschichten und bilden daher nicht nur den Hintergrund, sondern bleiben stark semantisch aufgeladen. Die Figuren agieren, begegnen und kommunizieren in einer spezifischen Umgebung, die oft das Potenzial zur Störung in sich trägt. Der Raum trägt zum Ausbruch und zur Eskalation von Konflikten bei (vgl. die Einrichtung der Mietwohnung in der Erzählung ‚Micha‘ aus dem Band ‚Alice‘ und das Verhalten des Vermieters). In Hermanns Texten kann der Raum also zu Störungen und Konflikten beitragen und die Motivationen und Körperlichkeit der Figuren beeinflussen.
Die von Judith Hermann dargestellten scheinbar alltäglichen Situationen, die durch Störungen unterbrochen werden, stellen die gesamte Existenz der Figuren in Frage – ihre Beziehungen, ihren bisherigen Lebensweg, ihre Zukunft. Mit Ausnahme der Texte, die die Konfrontation der Protagonist:innen mit dem Tod reflektieren, wirkt das Dargestellte alltäglich und banal, und gleichzeitig erweckt die Erzählweise (wie der Titel dieser Dissertation andeutet) den Eindruck, „gedämpft“ zu sein. Die unaufdringliche, zurückhaltende Erzählweise erlaubt es den Leser:innen, sich auf die Komplexität und Subtilität der dargestellten Welt zu konzentrieren.
Judith Hermann arbeitet meisterhaft mit einem offenen Ende, das als eines der wichtigsten Merkmale der Kurzgeschichte / Short Story gilt. Indem sie wichtige Fragen in ihren Texten ungelöst lässt, baut sie Spannung auf. Durch das offene Ende ihrer Texte verweist sie auch auf die Komplexität des scheinbar unspektakulären Lebens, auf das sie sich bezieht, und zeigt, dass es nicht immer eine klare Lösung oder einen einfachen Ausweg aus einer konfliktreichen Situation gibt. Sie verzichtet auf moralische Urteile über ihre Figuren und überlässt es den Leser:innen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.
Die vorgelegte Dissertation bezieht sich auf frühere Veröffentlichungen zum Werk der Berliner Autorin, doch wollte ich ein neues Licht auf Judith Hermanns Texte werfen – indem ich mich auf eine Textanalyse im Hinblick auf Kommunikation, Störung und Irritation konzentriert habe. Bisher bin ich noch nicht auf ein anderes Forschungsvorhaben gestoßen, das die (Kon)Figurationen der Instabilitäten in Judith Hermanns Werk unter Bezugnahme von Niklas Luhmanns ‚Theorie der sozialen Systeme‘ und seinen Nachfolgern beschreibt. In den von Hermann geschaffenen Erzählräumen werden die Leser:innen mit konflikthaften Situationen konfrontiert, die sich auf die Störung der Kommunikation auswirken, welche die Grundlage von Beziehungen ist. Die von der Autorin geschaffenen Situationen illustrieren und bestätigen Luhmanns These, die besagt, dass es ohne Störungen, Krisen und Konflikte keine Entwicklung gäbe. Störungen und Irritationen ermöglichen die Selbstbeobachtung des Systems (im Diskurs ist es der Erzähler / die Erzählerin, der / die zum Beobachter der Störungen / Konflikte wird) und in der Folge seine autopoietische Entwicklung. Unter der Perspektive der Autopoiesis lässt sich bei der Analyse von Hermanns Werken ein konservatives Merkmal ihrer Texte feststellen: Störungen sind in den von der Autorin vorgestellten Systemen nicht generell ein Grund für deren revolutionäre Transformation oder Auflösung. Nicht in allen, aber in vielen von ihnen regeneriert sich das System nach der Störung selbst. Es bleibt zwar instabil und labil, aber das ist sein Zustand von Anfang an.
Trotz der umfangreichen Analysen deckt die von mir vorgelegte Arbeit sicherlich nicht alle möglichen Aspekte von Hermanns Prosa ab und lässt Raum für weitere Forschungen, wie z. B. die sprachliche Gestaltung durch die Schriftsteller:innen oder das Verhältnis zwischen der von mir analysierten Kurzprosa und den Romanen sowie den poetologischen Äußerungen der Schriftstellerin. Diese sind in dem Band ‚Wir hätten uns alles gesagt‘ enthalten, der nach Abschluss der Dissertation 2023 erschienen ist.
Meine Dissertation wird im WUJ (Verlag der Jagiellonischen Universität) gedruckt.
Primärliteratur
- Hermann, Judith. 2009. Acqua alta. In Dies., Nichts als Gespenster. S. 121–151. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2014. Aller Liebe Anfang. Frankfurt a. M.: Fischer 2014.
- Hermann, Judith. 2009. Bali-Frau. In Dies., Sommerhaus, später. S. 97–113. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Brief. In Dies., Lettipark. S. 122–128. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Camera Obscura. In Dies., Sommerhaus, später. S. 157–165. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2010. Conrad. In Dies., Alice. S. 49–95. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Die Liebe zu Ari Oskarsson. In Dies., Nichts als Gespenster. S. 273–318. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Diesseits der Oder. In Dies., Sommerhaus, später. S. 167–188. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Ende von Etwas. In Dies., Sommerhaus, später. S. 85–96. -Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Fetisch. In Dies., Lettipark. S. 13–24. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Gedichte. In Dies., Lettipark. S. 35–42. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Gehirn. In Dies., Lettipark. S. 110–121. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Hunter-Tompson-Musik. In: Dies., Sommerhaus, später. S. 115–137. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Hurrikan (Something farewell). In Dies., Sommerhaus, später. S. 31–54. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Inseln. In Dies., Lettipark. S. 74–83. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith 2009. Kaltblau. In Dies., Nichts als Gespenster. S. 61–120. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Kohlen. In Dies., Lettipark. S. 7–12. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Kreuzungen. In Dies., Lettipark. S. 164–175. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Lettipark. In Dies., Lettipark. S. 43–51. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2010. Malte. In Dies., Alice. S. 127–157. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Manche Erinnerungen. In Dies., Lettipark. S. 94–109. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2010. Micha. In Dies., Alice. S. 5–48. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Mutter. In Dies., Lettipark. S. 176–187. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Nichts als Gespenster. In Dies., Nichts als Gespenster. S. 195–232. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Osten. In Dies., Lettipark. S. 141–152. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Papierflieger. In Dies., Lettipark. S. 63–73. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Pappelpollen. In Dies., Lettipark. S. 84–93. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2010. Raymond. In Dies., Alice. S. 159–189. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2010. Richard. In Dies., Alice. S. 97–125. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Rote Korallen. In Dies., Sommerhaus, später. S. 11–29. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Ruth (Freundinnen). In Dies., Nichts als Gespenster. S. 11–59. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Rückkehr. In Dies., Lettipark. S. 153–163. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Solaris. In Dies., Lettipark. S. 25–34. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Sommerhaus, später. In Dies., Sommerhaus, später. S. 139–156. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Sonja. In Dies., Sommerhaus, später. S. 55–84. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Träume. In Dies., Lettipark. S. 129–140. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2023. Wir hätten uns alles gesagt. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Wohin des Wegs. In Dies., Nichts als Gespenster. S. 33–271.
- Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2016. Zeugen. In Dies., Lettipark. S. 52–62. Frankfurt a. M.: Fischer.
- Hermann, Judith. 2009. Zuhälter. In Dies., Nichts als Gespenster. S. 153–193. Frankfurt a. M.: Fischer.
Sekundärliteratur
- Baraldi, Claudio / Corsi, Giancarlo / Esposito, Elena. 1997. GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Berghaus, Margot. 2011. Luhmann leicht gemacht. Eine Einführung in die Systemtheorie. 3., überarbeitete und ergänzte Auflage. Köln / Weimar / Wien: Böhlau.
- Beushausen, Jürgen. Ein Überblick über die Theorie sozialer Systeme. https://www.systemagazin.de/bibliothek/texte/beushausen-systemtheoretische-grundlagen.pdf
- (Zugriff am 30.10.2020).
- Böttinger, Helmut. 2004. Judith Hermann und ihre Gespenster. In Helmut Böttinger (Hg.): Nach den Utopien. Eine Geschichte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. S. 286–310. Wien: Paul Zsolnay 2004.
- Böttiger, Helmut. 2004. Nach den Utopien. Eine Geschichte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. https://dokumenty.osu.cz/ff/journals/studiagermanistica/2007-2/SG_2_7_Zemanikova.pdf (Zugriff am 12.09.2022).
- Böttiger, Helmut. 2004. Nichts als Gespenster. https://www.deutschlandfunk.de/nichts-als-gespenster-erzaehlungen-100.html (Zugriff am 14.03.2022).
- Braungart, Georg u. a. (Hg.). 2000. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Band I, A-G. 3. Neubearbeitete Auflage. Berlin: Walter de Gruyter.
- Dennerlein, Katrin. 2009. Narratologie des Raumes. Berlin: De Gruyter.
- Dorsch, Friedrich / Häcker, Hartmut / Stapf, Kurt H. (Hg.). 1994. Dorsch Psychologisches Wörterbuch. Bern / Göttingen / Toronto / Seattle: Huber.
- Durzak, Manfred. 2002. Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. Autorenporträts, Werkstattgespräche, Interpretationen. 3. erw. Aufl., Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Durzak, Manfred. 2006. Die Erzählprosa der neunziger Jahre. In Wilfried Barner (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. 2. akt. und erw. Aufl. S. 964–1007. München: Beck.
- Durzak, Manfred. 1989. Die Kunst der Kurzgeschichte. Zur Theorie und Geschichte der deutschen Kurzgeschichte. München: Wilhelm Fink.
- Feiereisen, Florence. 2006. Liebe als Utopie? Von der Unmöglichkeit menschlicher Näheräume in den Kurzgeschichten von Tanja Dückers, Julia Franck und Judith Hermann. In: Ilse Nagelschmidt / Lea Müller-Dannhausen / Sandy Feldbacher (Hg.), Zwischen Inszenierung und Botschaft. Zur Literatur deutschsprachiger Autorinnen ab Ende des 20. Jahrhunderts. S. 179–196. Berlin: Frank & Timme.
- Gansel, Carsten / Ächtler, Norman (Hg.). 2013. Das ‚Prinzip Störung‘ in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Berlin / Boston: De Gruyter.
- Gansel, Carsten / Ächtler, Norman (Hg.). 2013. Das ‚Prinzip Störung‘ in den Geistes- und Sozialwissenschaften – Einleitung. In Carsten Gansel / Norman Ächtler (Hg.): Das ‚Prinzip Störung‘ in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Berlin / Boston: De Gruyter.
- Gansel, Carsten / Zimniak, Paweł (Hg.). 2012. Störungen im Raum – Raum der Störungen. S. 183–202. Heidelberg: Winter.
- Gorycka, Beata. 2020. Leerstellen in der Erzählung Judith Hermanns Sommerhaus, später. In Zofia Berdychowska / Frank Liedtke (Hg.), Aspekte multimodaler Kurzformen: Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268905 S. 219–229. Berlin: Lang. (Zugriff am 20.02.2023).
- Gorycka, Beata. 2017. Umgang mit Dingen, die einen hilflos machen. Begegnungen mit dem Tod im Erzählband Alice Judith Hermanns. In Lech Kolago (Hg.), Studien zur Deutschkunde, Band 59. S. http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42269 S. 465–475
- Hage, Volker. 1999. Ganz schön abgedreht. Der Spiegel. 22.03.1999, S. 244-246.
- Löw, Martina / Sturm, Gabriele. 2005. Raumsoziologie. In von Kessl, Fabian u. a. (Hg.), Handbuch Sozialraum. S. 31–48. Wiesbaden: VS.
- Löw, Martina. 2001. Raumsoziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1997. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Erster und zweiter Teilband. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1997. Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1992. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1990. Glück und Unglück der Kommunikation in Familien: Zur Genese von Pathologien. In Soziologische Aufklärung 5. S. 218–227. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-322-97005-3_10
- (Zugriff am 30.04.2022).
- Luhmann, Niklas. 1984. Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1996. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. 6. Auflage. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas. 1995. Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen: Westdeutscher Verlag 1995.
- Luhmann, Niklas. 1995. Soziologische Aufklärung. Band 6. Die operative Geschlossenheit psychischer und sozialer Systeme. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, Niklas. 2009. Soziologische Aufklärung. Konstruktivistische Perspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Marx, Leonie. 2005. Die deutsche Kurzgeschichte. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart / Weimar: Metzler.
- Meise, Helga. 2005. Mythos Berlin. Orte und Nicht-Orte bei Julia Frank, Inka Parei und Judith Hermann. In Caemmerer, Christiane / Delabar, Walter / Meise, Helga (Hg.), Fräuleinwunder literarisch. Literatur von Frauen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. S. 125–150. Inter-Lit, Band 6. Frankfurt a. M.: Lang.
-
Mingels, Annette. 2006.
Das Fräuleinwunder ist tot – es lebe das Fräuleinwunder. Das
Phänomen der ‚Fräuleinwunder-Literatur’ im literaturgeschichtlichen Kontext. In Ilse Nagelschmidt / Lea Müller-Dannhausen / Sandy Feldbacher (Hg.), Zwischen Inszenierung und Botschaft. Zur Literatur deutschsprachiger Autorinnen ab Ende des 20. Jahrhunderts. S. 13–38. Berlin: Frank&Timme. - Nagelschmidt, Ilse / Müller-Dannhausen, Lea / Feldbacher, Sandy (Hg.): Zwischen Inszenierung und Botschaft. Zur Literatur deutschsprachiger Autorinnen ab Ende des 20. Jahrhunderts. Berlin: Frank&Timme 2006.
- Nünning, Ansgar. 2001. Art. Raum / Raumdarstellung, literarische[r]. In Nünning, Ansgar (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. S. 536. Stuttgart / Weimar: J.B. Metzler.
- Sander, Julia Catherine. 2015. Zuschauer des Lebens. Subjektivitätsentwürfe in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bielefeld: Transcript.
- Seidler, Miriam. 2010. Figurenmodelle des Alters in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. S. 84–90. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Simonis, Linda. 2011. Irritation - Jean de La Fontaine und Jean Crotti. In Werber, Niels (Hg.), Systemtheoretische Literaturwissenschaft: Begriffe – Methoden – Anwendungen. S. 195–205. Berlin / New York: Walter de Gruyter.
- Werner, Martin: Die Kälte-Metaphorik in der modernen deutschen Literatur. https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DocumentServlet?id=3513 S. 13. (Zugriff am 31.12.2021).
- Gorycka, Beata. 2024. Stille Perturbationen: (Kon)Figurationen der Instabilitäten im Schaffen Judith Hermanns. In Franke, Sebastian; Klemm, Anna Luise; Krabi, Richard; Toth, Raphael; Zajac, Wojciech (Hgg.), Studieren und Promovieren in Krakau und Leipzig: Beiträge der Sommerschule 2023. 7–9. Leipzig (textdynamiken 3).
Team
Unser Team stellt sich vor
Das Leitungsteam der GIP setzt sich aus Sprach- und Literaturwissenschaftler:innen des Instituts für Germanistik der Jagiellonen-Universität Krakau und des Instituts für Germanistik der Universität Leipzig zusammen.

Prof. Dr. Sabine Griese
Prof. Dr. Sabine Griese, Professorin für Ältere deutsche Literatur am Institut für Germanistik an der Universität Leipzig. zur Person

Prof. Dr. Zofia Berdychowska
Professorin am Institut für Germanistik der Jagiellonen-Universität in Krakau (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Linguistik, Leiterin der Abteilung Germanische Sprachwissenschaft. zur Person

Prof. em. Dr. Frank Liedtke
Professor i.R. für Germanistische Linguistik/Pragmatik am Institut für Germanistik der Universität Leipzig. zur Person

Dr. Stephanie Bremerich
Dr. phil., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie am Institut für Germanistik der Universität Leipzig. zur Person

Dr. phil. habil. Magdalena Filar
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Germanistische Sprachwissenschaft am Institut für Germanistik der Jagiellonen Universität Krakau. zur Person

Dr. Robert Mroczynski
Dr. phil., Professurvertretung im Fachbereich Pragmalinguistik am Institut für Germanistik der Universität Leipzig. zur Person
Sabine Griese – Team

Prof. Dr. Sabine Griese
Professorin für Ältere deutsche Literatur am Institut für Germanistik an der Universität Leipzig.
Studium der Germanistik und Philosophie in Regensburg. 1995 Promotion an der Universität Regensburg mit einer Arbeit zu Salomon und Markolf – Ein literarischer Komplex im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Tübingen: Niemeyer 1999). 2007 Habilitation an der Universität Zürich mit einer Arbeit über Text-Bilder und ihre Kontexte (Zürich: Chronos 2011).
Forschungsschwerpunkte: Deutsche Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Text-Bild-Beziehungen, Medialität von Literatur, Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts, handschriftliche und gedruckte Überlieferung von Literatur, Textbegriff, entstehender Buchmarkt, Diebold Lauber und seine Literaturproduktion
Zofia Berdychowska – Team

Prof. Dr. Zofia Berdychowska
Professorin am Institut für Germanistik der Jagiellonen-Universität in Krakau (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Linguistik, Leiterin der Abteilung Germanische Sprachwissenschaft.
Studium der Germanistik in Kraków. 1986 Promotion zum Thema Zu syntaktischen Besonderheiten der deutschen Fachsprache Medizin. Thema-Rhema-Gliederung und Textablauf.
2003 Habilitation (Personaldeixis. Typologie, Interpretation und Exponenten im Deutschen und im Polnischen. Kraków: Universitas 2002). 2010 Univ.-Professorin, 2015 Professorin (Personendeixis. Kontraste Deutsch-Polnisch und ihre translatorischen Aspekte. Kraków: WUJ 2013).
Forschungsschwerpunkte: Deixis, Fachkommunikation, Übersetzungswissenschaft, Text- und Diskurslinguistik.
Katarzyna Jastal – Team
Frank Liedtke – Team

Prof. em. Dr. Frank Liedtke
Professor i.R. für Germanistische Linguistik/Pragmatik am Institut für Germanistik der Universität Leipzig.
Studium der Germanistik, Romanistik, Philosophie, Allgemeinen Sprachwissenschaft an der Heinrich-Heine-Univerfsität Düsseldorf. Promotion 1987, Habilitation 1992. Professuren an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, RWTH Aachen, Universität Leipzig. Gastprofessuren an der Jagiellonen-Universität Krakau, Université Sorbonne Nouvelle-Paris
Arbeitsschwerpunkte: Grammatik-Pragmatik-Verhältnis; Sprachphilosophie; Sprache der Öffentlichkeit.
Publikationen u.a.: Grammatik der Illokution (1998), Moderne Pragmatik (2016), Metzler Handbuch Pragmatik (2018).
Stephanie Bremerich – Team

Dr. Stephanie Bremerich
Dr. phil., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie am Institut für Germanistik der Universität Leipzig.
Studium der Germanistik, Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Leipzig und Prag. 2016 Promotion an der Universität Leipzig zum Thema Erzähltes Elend – Autofiktionen von Armut und Abweichung (Stuttgart: Metzler 2018).
Forschungsschwerpunkte: Literatur der Moderne und Avantgarde, Armut und Abweichung in Bild und Text, Gender Studies, Narratologie, Fiktionstheorie.
Magdalena Filar – Team

Dr. phil. habil. Magdalena Filar
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Germanistische Sprachwissenschaft am Institut für Germanistik der Jagiellonen Universität Krakau.
Studium der Germanistik an der Jagiellonen Universität, 2009 Promotion an der Jagiellonen Universität zum Thema Kategoria niekreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu. Studium kognitywne/ Die Kategorie der Indefinitheit in der Perspektivierung des Textes und dessen Translats. Eine kognitive Studie. (Krakau: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2014), 2020 Habilitation zum Thema Kognitive Untersuchungen zur Textsemantik in der angloamerikanischen und germanistischen Linguistik – von Referenz bis zur Informationsstrukturierung im Text.
Forschungsschwerpunkte: Semantik (kognitive Sprachtheorien), Text- und Diskurslinguistik, Translatorik und Translationsdidaktik.
Robert Mroczynski – Team

Dr. Robert Mroczynski
Dr. phil., Professurvertretung im Fachbereich Pragmalinguistik am Institut für Germanistik der Universität Leipzig.
Studium der Germanistik und Philosophie in Düsseldorf. 2012 Promotion an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zum Thema Grammatikalisierung und Pragmatikalisierung. Zur Herausbildung der Diskursmarker wobei, weil und ja im gesprochenen Deutsch.
Forschungsschwerpunkte: Gesprächslinguistik, Pragmatik, Sprachwandel
Pawel Zarychta – Team

Dr. Pawel Zarychta
Impressum
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Institut für Germanistik, Universität Leipzig
Prof. Dr. Sabine Griese
Beethovenstraße 15
04107 Leipzig
Kontakt:
Franziska Röder (Sekretariat)
Telefon: +49 341 97 37 390
E-Mail: franziska.roeder@uni-leipzig.de
Konzeption, Gestaltung und Umsetzung:
GRUETZNER TRIEBE und Mathias Dragon
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Auf unseren Seiten werden auch automatisiert keine personenbezogenen Daten erhoben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Einleitung
Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als „Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, in mobilen Applikationen sowie innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als „Onlineangebot“).
Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch.
Verantwortliche
Institut für Germanistik, Universität Leipzig
Prof. Dr. Sabine Griese
Beethovenstraße 15
04107 Leipzig
Kontakt:
Franziska Röder (Sekretariat)
Telefon: +49 341 97 37 390
E-Mail: franziska.roeder@uni-leipzig.de
Übersicht der Verarbeitungen
Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke ihrer Verarbeitung zusammen und verweist auf die betroffenen Personen.
Arten der verarbeiteten Daten
- Bestandsdaten
- Kontaktdaten
- Inhaltsdaten
- Nutzungsdaten
- Meta-/Kommunikationsdaten
Kategorien betroffener Personen
- Kommunikationspartner:innen
- Nutzer:innen
Zwecke der Verarbeitung
- Kontaktanfragen und Kommunikation
- Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit
Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Rechtsgrundlagen der DSGVO, auf deren Basis wir personenbezogene Daten verarbeiten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass neben den Regelungen der DSGVO nationale Datenschutzvorgaben in Ihrem bzw. unserem Wohn- oder Sitzland gelten können. Sollten ferner im Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich sein, teilen wir Ihnen diese in der Datenschutzerklärung mit.
- Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO) - Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
- Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Zusätzlich zu den Datenschutzregelungen der Datenschutz-Grundverordnung gelten nationale Regelungen zum Datenschutz in Deutschland. Hierzu gehört insbesondere das Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Das BDSG enthält insbesondere Spezialregelungen zum Recht auf Auskunft, zum Recht auf Löschung, zum Widerspruchsrecht, zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Verarbeitung für andere Zwecke und zur Übermittlung sowie automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling. Des Weiteren regelt es die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses (§ 26 BDSG), insbesondere im Hinblick auf die Begründung, Durchführung oder Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Einwilligung von Beschäftigten. Ferner können Landesdatenschutzgesetze der einzelnen Bundesländer zur Anwendung gelangen.
Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen und elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, die Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.
Bereitstellung des Onlineangebotes und Webhosting
Um unser Onlineangebot sicher und effizient bereitstellen zu können, nehmen wir die Leistungen eines Webhosting-Anbieters in Anspruch, von dessen Servern (bzw. von ihm verwalteten Servern) das Onlineangebot abgerufen werden kann. Zu diesen Zwecken können wir Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste sowie Sicherheitsleistungen und technische Wartungsleistungen in Anspruch nehmen.
Zu den im Rahmen der Bereitstellung des Hostingangebotes verarbeiteten Daten können alle die Nutzer:innen unseres Onlineangebotes betreffenden Angaben gehören, die im Rahmen der Nutzung und der Kommunikation anfallen. Hierzu gehört regelmäßig die IP-Adresse, die notwendig ist, um die Inhalte von Onlineangeboten an Browser ausliefern zu können.
- Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen)
- Betroffene Personen: Nutzer:innen (z.B. Webseitenbesucher:innen, Nutzer:innen von Onlinediensten)
- Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit
- Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO)
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
- E-Mail-Versand und -Hosting: Die von uns in Anspruch genommenen Webhosting-Leistungen umfassen ebenfalls den Versand, den Empfang sowie die Speicherung von E-Mails. Zu diesen Zwecken werden die Adressen der Empfänger sowie Absender als auch weitere Informationen betreffend den E-Mailversand (z.B. die beteiligten Provider) sowie die Inhalte der jeweiligen E-Mails verarbeitet. Die vorgenannten Daten können ferner zu Zwecken der Erkennung von SPAM verarbeitet werden. Wir bitten darum, zu beachten, dass E-Mails im Internet grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden. Im Regelfall werden E-Mails zwar auf dem Transportweg verschlüsselt, aber (sofern kein sogenanntes Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren eingesetzt wird) nicht auf den Servern, von denen sie abgesendet und empfangen werden. Wir können daher für den Übertragungsweg der E-Mails zwischen dem Absender und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen.
- Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Unser Webhostinganbieter erhebt automatisiert Daten zu jedem Zugriff auf den Server (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Serverlogfiles können die Adresse und Name der abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören. Die Serverlogfiles können zum einen zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt werden, z.B., um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken) und zum anderen, um die Auslastung der Server und ihre Stabilität sicherzustellen; Löschung von Daten: Logfile-Informationen werden für die Dauer von maximal 30 Tagen anonymisiert gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
- ALL-INKL: Leistungen auf dem Gebiet der Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur und verbundenen Dienstleistungen (z.B. Speicherplatz und/oder Rechenkapazitäten); Dienstanbieter: ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inhaber: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Deutschland; Website: https://all-inkl.com/; Datenschutzerklärung: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/; Auftragsverarbeitungsvertrag: mit Anbieter abgeschlossen .
Kontakt- und Anfragenverwaltung
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. E-Mail, Telefon oder via soziale Medien) sowie im Rahmen bestehender Nutzer- und Geschäftsbeziehungen werden die Angaben der anfragenden Personen verarbeitet soweit dies zur Beantwortung der Kontaktanfragen und etwaiger angefragter Maßnahmen erforderlich ist.
Die Beantwortung der Kontaktanfragen sowie die Verwaltung von Kontakt- und Anfragedaten im Rahmen von vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehungen erfolgt zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten oder zur Beantwortung von (vor)vertraglichen Anfragen und im Übrigen auf Grundlage der berechtigten Interessen an der Beantwortung der Anfragen und Pflege von Nutzer- bzw. Geschäftsbeziehungen.
- Verarbeitete Datenarten: Inhaltsdaten (z.B. Text einer E-Mail-Anfrage), Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern)
- Betroffene Personen: Kommunikationspartner:innen
- Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation
- Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO)
Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.
Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen.
Stand: 7. Februar 2022
Rechtstext von Dr. Schwenke
Letzte Änderungen
Letzte Änderungen
Link mit der Versionsnummer im Footer wird nur im Entwicklungsbereich angezeigt
Was ist neu in dieser Version V22-06-29 (LIVE)
- Online-Journal #1 PDF-Download
- Eintrag in Aktuelles zum Journal Release
Was kommt als nächstes:
- Anpassungen entsprechend Feedback
- CMS (Redaktionssystem) anbinden
- Seiteninhalte erst bei Klick über API aus CMS nachladen oder aus dem Zwischenspeicher
Was kommt danach:
- Anpassungen entsprechend Feedback
- Online-Journal (Inhalte: 1. Ausgabe, alle dafür benötigten Elemente)
- Suche für Journal-Inhalte
- Anpassungen entsprechend Feedback
- Animation auch bei Vor- und Zurück-Navigation im Browser
- (optionaler Bildwechsel bei Umschaltung hell / dunkel)
- (Bildformatwechsel im Vergrößerungsmodus)
Aktuelle Farbwerte:
| #FFC800 | gelb | Schriftfarbe (Meta, Links, Logo-Text/Navigation:hover auf dunklem Hintergrund), Trennlinien auf dunklem Hintergrund, Hintergrund von Textmarkierungen, Footer-Hintergrund im dunklen Modus |
|
| #E5A700 | messing | Schriftfarbe für Metadaten und Logo-Text/Navigation:hover im hellen Modus, Trennlinien im hellen Modus |
|
| #00E600 | neon | Schriftfarbe für Hauptnavigation in beiden Modi, Schriftfarbe für Footer-Nav:hover und Text-Links:hover in beiden Modi |
|
| #DCFFA5 | hellgrün | Schriftfarbe auf dunklen Hintergründen | |
| #EEFEDE | hell | Hintergrund (Seiten im hellen, Boxen im dunklem Modus) | |
| #003C4B | dunkel | Schriftfarbe auf hellen oder gelben Hintergründen, Hintergrund (Seiten im dunklen, Boxen und Footer im hellen Modus) |
|
| #FFFFFF | weiß | Uni-Logos im hellen Modus | |
| #000000 | schwarz | Uni-Logos im dunklen Modus |
Frühere Änderungen
V22-06-25
- Online-Journal Übersicht
- Online-Journal-Unterseiten
- Online-Journal #1 Inhalt
- Fehlerkorrekturen auf Aktuelles und in Artikeln
V22-05-24
- Aktuelles-Beitrag 24.05.2022: Workshop am 30.06.2022 in Leipzig mit PDF
V22-02-17-1712 (RC2)
- Mobile Navigation: Buttons für Mail und Instagram repariert
- Aktuelles und Unterseiten: Datumsangaben korrigiert
- Impressum vervollständigt
- Website veröffentlicht
V22-02-17 (RC1)
- Mobile Navigation fertiggestellt
- Footer wird im Tablet-Modus nun wie auf größeren Screens hereingefahren, wenn die Seiteninhalte nicht den gesamten Screen ausfüllen
- Optimierungen/Lazy Loading: Bilder werden nun erst nach Bedarf nachgeladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommen (dadurch wird die Website insgesamt schneller geladen)
- Warnhinweise bei ausgeschaltetem Javascript oder veralteten Browsern, die die Website nicht korrekt darstellen können
- Anpassungen, dass auch bei deaktiviertem Javascript wenigstens alle Textinhalte sichtbar sind; alle Inhalte werden untereinander aufgelistet
V22-02-16
- Mouse/Hover-Effekt bei Bildern: Semi-Transparenz statt Graustufenfilter
- Mouse/Hover-Effekt wird bei allen Link-Elementen einer Karte gleichzeitig aktiviert (Überschrift, Bild, Pfeil), solange eines aktiv ist
- Anpassung der Position des Top-Links nach Footer-Sichtbarkeit auch in Tablet-Größen wie auf größeren Displays
- Darstellung für Mobile Browser repariert, Inhalte werden auf der rechten Seiten nicht mehr abgeschnitten (u.a. in Firefox auf iOS
- Darstellung der 2-spaltigen Layouts im Team repariert, Inhalte wurden manchmal bei verschiedenen Fensterzwischengrößen nur 1-spaltig dargestellt
- Optimierung: Responsive Bilder: Browser wählen Bildgröße je nach Bildschirm-/Fenstergröße
- zusätzlich neben dem JPEG-Format werden nun alle Bilder auch im Format WebP angeboten (Dateigröße nur rund 30% des JPEGs bei gleicher Qualität)
- (Dadurch beträgt die Gesamtgröße der Seite mit allen Inhalten nur max. 1,6MB statt 6MB in Browsern die WebP unterstützen, sonst max. 3,3MB.)
V22-02-15
- Footer: Elemente im Tablet Modus besser ausgerichtet, um Höhe zu reduzieren (Breite 560–960px); Links, Logos nebeneinander etc.
- Favicon für Browsertabs und Mobile Homescreens etc. eingebunden
V22-02-14
- Link mit der Versionsnummer im Footer wird nur im Entwicklungsbereich angezeigt
- Neue Funktion: Text-Vergrößerung , Status wird für nächsten Seitenaufruf im Browser gespeichert
- Wahl des Farbschemas (hell/dunkel) wird im Browser für den nächsten Besuch oder Neuladen gespeichert
- Schaltfäche für die Suche ausgeblendet (bis die Funktionalität zur Verfügung steht)
V22-02-13
- HTML-Seiten-Titel passen sich entsprechend der ausgewählten Seite dynamisch an (Browser-Tab)
- Pfeil (nach oben springen, Top-Link) wird erst einblendet, wenn es auch etwas zu Springen gibt
- Der „Sprung“ nach oben wird nun leicht animiert auf die letzten 100 Pixel
- Desktop: Navigationselemente und Top-Link passen ihre Positon an die Sichtbarkeit des Footers an, sodass sie dann wieder vertikal zentriert im Raum über dem Footer stehen
V22-02-12
- Anordnung der Blogposts in Aktuelles passt sich der Geräte-/Fenstergröße automatisch an
- Ab Smartphone Querformat (wenn >= 560px) werden Posts in Aktuelles in 2 unabhängigen Spalten angeordnet und fließen dort in festen Abständen untereinander
- Foto von Zofia Berdychovska ergänzt (ist aber leider zu niedrig aufgelöst)
V22-02-07
- Impressum
- Datenschutzerklärung mittels RA Schwenkes datenschutz-generator.de
- Fotorechte der Teamfotos hinterlegt
- SSL-Verschlüsselung aktiviert (https://)
V22-01-16
- Link-Farben für MouseOver angepasst: Textlinks -> neon, Navigation, Icons -> gelb, bronze, Logo -> Text -> gelb/bronze, Linien -> neon
- Mobile-Navigation: mehr Platz unter dem Hamburger-Icon
- Mobile-Navigation: Seitenübergang vertikal (statt horizontal)
- Bilder in Links werden bei Hover/MouseOver entfärbt
V22-01-15
- animierte Link-Pfeile
- link--top verschlankt mit fester Größer und 2px Linienstärke
- nicht mehr benötigtes Login aus den Navigationen entfernt
V22-01-10
- Routing: Jede Unterseite hat eine eigene URL (Adresse), Links können geteilt werden
V21-12-22
- Tablet Version (im Bereich der Bildschirmbreiten 560px–959px):
- Vertikale Navigation wird durch mobiles Menü ersetzt
- dafür erhält der Inhaltsbereich mehr Platz und kann 2-spaltige Layout analog zum Desktop-Modus anzeigen
- die Inhalte werden dabei linkbündig ausgerichtet
- der Pfeil (nach oben springen) wird hier analog außerhalb des Menüs fixiert
- Header und Footer werden weiterhin wie im mobilen Layout dargestellt
- der Pfeil (nach oben springen) wird auf Tablet und Desktop ausgerichtet in Größe und Position am aktuellen Raster
- Textlinkfarbe (gelb, messing)
Was kommt als nächstes:
🎄 ☃️ 🧑🎄 🍪 🦦
V21-12-21
- neue Farbfläche bei Teammitgliedern, die kein Porträt haben
- © vor die Bildunterschriften
- Hover: 50% Farbintensität reduziert
- Instagram-Link zeigt nun auf das Profil
- E-mail-Adresse eingetragen (kodiert, Spamschutz)
Generator - Testbild in Workshopankündigung entfernt
- alle Textdaten übernommen und 2 weitere Personen im Team angelegt
V21-12-20
- Mobiles Layout justiert
- Schriftgrößen im Detail der mobilen Ansicht
- Markup für Team so umgebaut, sodass Desktop und Mobil differenziert gestylt werden kann
- Icon-Links (E-Mail, Tel.) hinzugefügt
- Mobiler Footer
V21-12-19
- Textmarkierung mit gelben Hintergrund (funktioniert nur auf Mausgeräten, Farbe wirkt in Safari durch Halbtransparenz dunkler)
- Bilder für Aktuelles eingefügt
- Acumin Italic eingebunden
- Font-Smoothing für Mac OS X Browser im dunklen Modus umgeschaltet, damit die Schrift nicht so klobig wirkt
- Bug in der Navigation behoben
- Pfeil (nach oben springen) vergrößert
- Komponenten für Bildelemente
- Erste Bilder eingefügt
- Hover-Styles
- Desktop: Justierung Header, Schriftgrößen und Abstände in Aktuelles und dessen Unterseiten
V21-12-16
- Linenfarbe im hellen Modus: von dunkel auf messing gewechselt
- Texte in Aktuelles auf Unterseiten ausgelagert und auf Snippets gekürzt
- Sortierung geändert auf chronologisch absteigend (alles noch manuell ;)
- Schriftgrößen teilweise angepasst: verkleinert: Team-Details, Vorlesungsprogamm/Texte, vergrößert: Unterseiten/Fließtext
- Pfeilgröße an jeweils berechnete Schriftgröße angeglichen
- Top Link umpositioniert, temporär auf vertikale Mitte wie Menü, justiert sich horizontal entsprechend aktueller Seitenansicht neu
V21-12-15
- Alle Textinhalte und Bildinhalte (Stand: 15.12.21) übernommen
- Bugfixes in der Navigation
V21-12-14-1
- mobile Navigation fixiert und Styles angepasst (noch ohne Aus-Ixung der aktuellen Seite)
- Top Link Bug gefixt und ins Menü gesetzt (erstmal dauerhaft eingeblendet)
- Release Notes sind nun auch mobil zugänglich
V21-12-14
- mobile Navigation (basic, ohne Aus-Ixung der aktuellen Seite)
- top link (basic)
V21-12-13
- mobile Seitenlayouts (basics)
- mobile variable Schriftgrößen
- Team: responsive Anordnung von Foto und Textbox gemäß Design
V21-12-10
- Schriften Acumin Pro und Pitch Sans
- Farbwerte neu übernommen für vert. Trennlinien (gelb bei dunklem Hintergrund, dunkel bei hellem Hintergrund)
V21-12-09
- Schriftschnittwechsel Courier New Regular -> Courier New Semibold
Letzte Änderungen
E-mail-Adressen kodieren
Zum Schutz vor Spam bitte keine E-Mail-Adressen im Klartext einfügen, sondern erst kodieren und diesen Code dann an der gewünschten Stelle platzieren. Beim Anzeigen der Seite wird die Adresse automatisch dekodiert. (Das machen viele Spambots nicht und können daher mit ein abgegrasten Adresse nichts anfangen.)
Diese Website ist für moderne Web-Browser konzipiert und kann in Ihrem Browser leider nicht korrekt dargestellt werden.
Bitte nutzen Sie zur Ansicht eine aktuelle Version eines modernen Browser wie Mozilla Firefox, Opera oder Brave, Safari, Chrome oder Edge.Eine aktuelle Liste mit Download-Möglichkeiten finden Sie hier. →